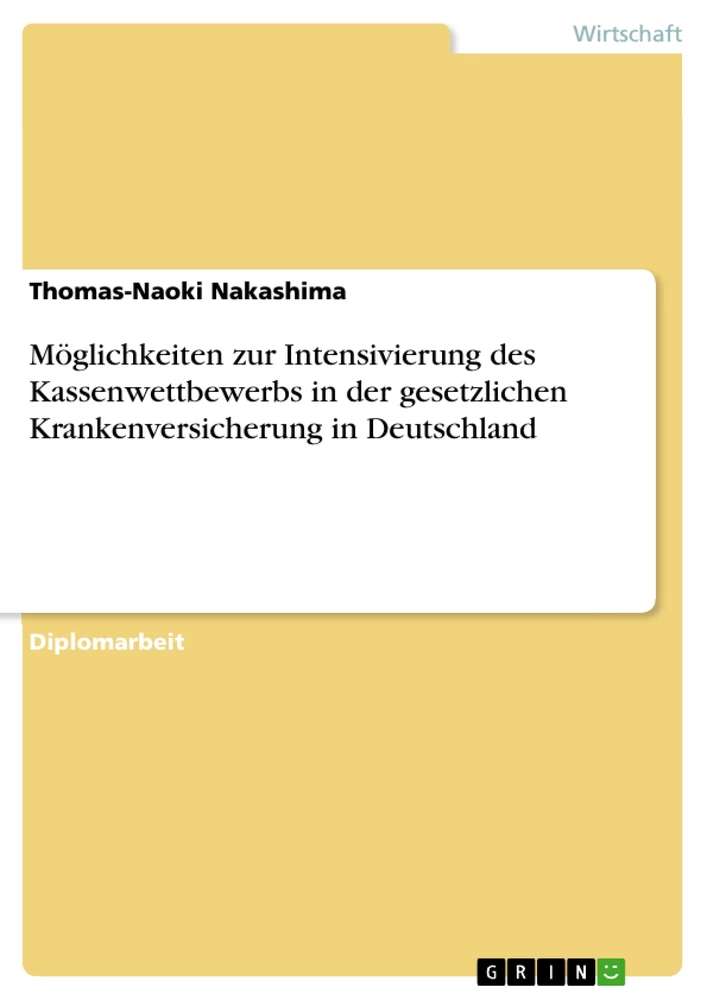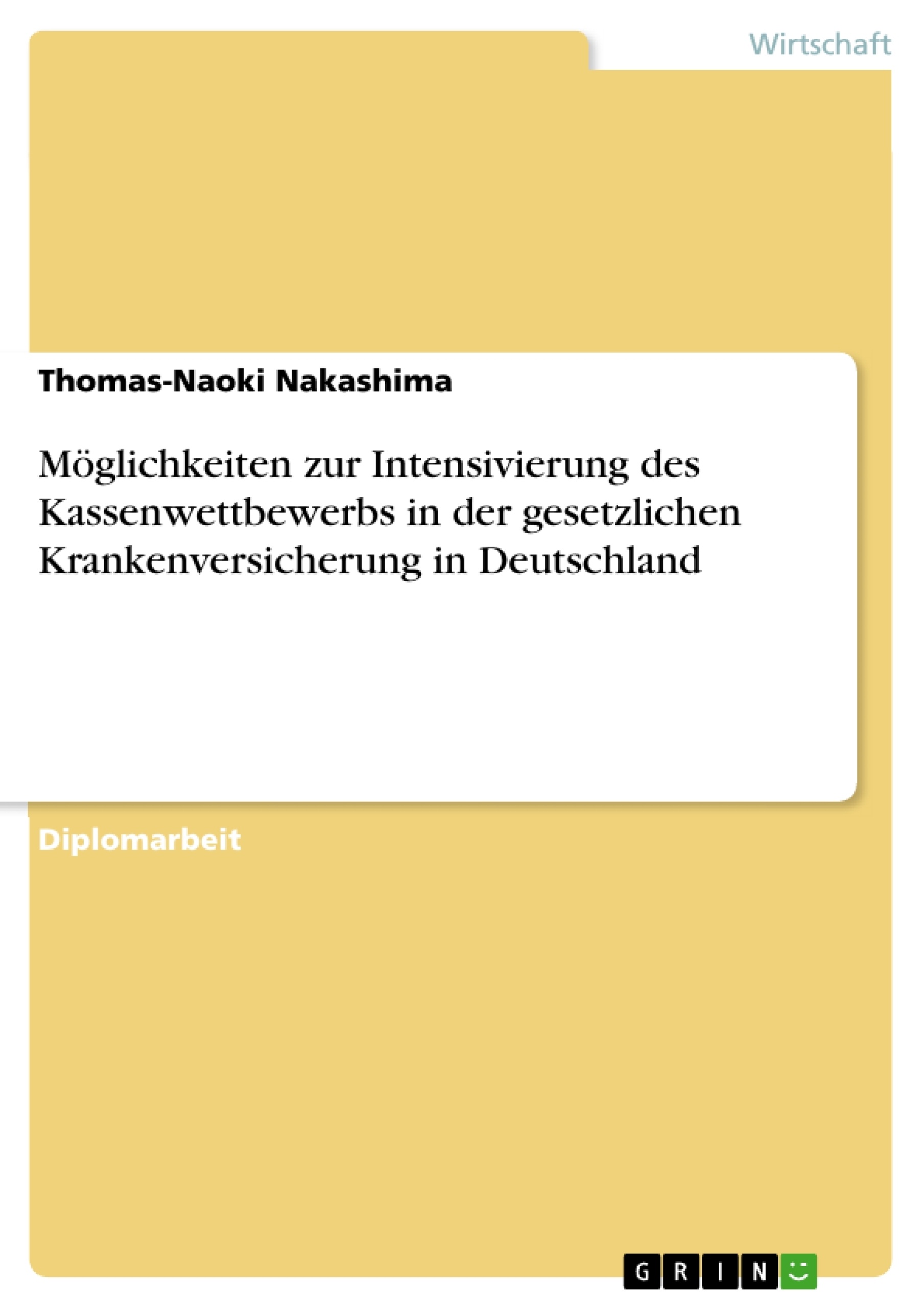Die zentrale Fragestellung dieser Arbeit ist, welche Wettbewerbsinstrumente und -strategien betriebswirtschaftlich und gesamtwirtschaftlich gegenwärtig von Bedeutung sind und wie sie sich unter möglichen zukünftigen Reformen und Änderungen des Gesundheitssystems in Deutschland verändern könnten. Um diese Frage zu beantworten, wird zunächst der Begriff des Wettbewerbs theoretisch erläutert und im Anschluss auf die GKV übertragen. Dabei sollen vor allem die Ziele und Zwecke des Wettbewerbs erläutert werden. Im nächsten Schritt werden die wettbewerbsbeschränkenden Regelungen der GKV analysiert und ihre Auswirkungen auf den Kassenwettbewerb erläutert. Das dritte Kapitel widmet sich darauf aufbauend den gegenwärtig bedeutsamen und zum Einsatz gebrachten Wettbewerbsinstrumenten und -strategien der KKn unter Berücksichtigung der Wettbewerbsbeschränkungen.
Im vierten Kapitel wird zunächst auf das Konstrukt des Gesundheitsfonds als geplante Reform der GKV eingegangen. Die systematischen Veränderungen dieses Gesundheitsfonds werden Auswirkungen auf den Kassenwettbewerb haben. Daher sollen die wichtigsten potentiellen Änderungen und ihre Auswirkungen auf die Wettbewerbsstrategien theoretisch hergeleitet werden. Hierbei werden ebenfalls die gesamtwirtschaftlichen Aspekte des Gesundheitsfonds skizziert. Daran anschließend sollen im fünften Kapitel weitere exemplarische Reformoptionen, die immer wieder in der politischen und wissenschaftlichen Diskussion auftauchen, auf ihre möglichen Auswirkungen auf den Kassenwettbewerb hin untersucht werden.
Im letzen Kapitel der Arbeit soll vor diesem Hintergrund ein Fazit aus den vorangegangenen Analysen und Diskussionen gezogen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung und Zielsetzung der Arbeit
- Einführung in die Thematik
- Zielsetzung und Aufbau der Arbeit
- Regulierung des Wettbewerbs zwischen gesetzlichen Krankenkassen im gegenwärtigen System
- Erläuterung des Begriffes Wettbewerb und seine Bedeutung für den Krankenversicherungsmarkt
- Wettbewerbsregulierung durch den Kontrahierungszwang
- Wettbewerbsregulierung durch den einheitlichen Leistungskatalog
- Wettbewerbsregulierung durch den Risikostrukturausgleich
- Funktionsweise des Risikostrukturausgleichs
- Risikoselektion in der Gesetzlichen Krankenversicherung
- Gegenwärtige Situation und Möglichkeiten des Wettbewerbs in der Gesetzlichen Krankenversicherung
- Preispolitik der Krankenkassen
- Der Versicherungsbeitrag als Wettbewerbsinstrument
- Instrumente der Preispolitik
- Risikoselektion durch Preispolitik
- Produktpolitik der gesetzlichen Krankenversicherungen
- Instrumente der Produktpolitik
- Risikoselektion durch Produktpolitik
- Distributionspolitik
- Instrumente der Distributionspolitik
- Risikoselektion durch Distributionspolitik
- Kommunikationspolitik
- Instrumente der Kommunikationspolitik
- Risikoselektion durch Kommunikationspolitik
- Möglichkeiten zu verstärktem Wettbewerb im Rahmen des geplanten „Gesundheitsfonds“
- Auswirkungen der Modifizierung des Beitragseinzugs, zusätzliche Beitragserhebung und Beitragserstattung
- Auswirkung einer Verringerung der Anzahl der gesetzlichen Krankenkassen auf den Wettbewerb
- Auswirkungen des geplanten morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs
- Risikoselektion im zukünftigen System des Gesundheitsfonds
- Weitere Möglichkeiten zur Intensivierung des Kassenwettbewerbs und deren „soziale Verträglichkeit“
- Auflockerung des einheitlichen Leistungskataloges
- Auflockerung der einheitlichen Beitragsbemessung
- Beseitigung des kollektiven Sicherstellungsauftrags und Ermöglichung individuellen Kontrahierens mit Leistungserbringern
- Schlussbemerkung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Analyse des Wettbewerbs zwischen den gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland und untersucht Möglichkeiten zur Intensivierung dieses Wettbewerbs. Ziel ist es, die Funktionsweise des gegenwärtigen Systems und seine Auswirkungen auf den Wettbewerb zu beleuchten, sowie alternative Modelle zu erforschen, die einen stärkeren Wettbewerb fördern könnten.
- Regulierung des Wettbewerbs im gegenwärtigen System
- Möglichkeiten zur Intensivierung des Wettbewerbs
- Auswirkungen des „Gesundheitsfonds“ auf den Wettbewerb
- Soziale Verträglichkeit von Maßnahmen zur Wettbewerbsintensivierung
- Risikoselektion im Gesundheitswesen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den aktuellen Stand des Wettbewerbs im deutschen Krankenversicherungssystem beleuchtet. Anschließend werden die verschiedenen Regulierungsmechanismen des Wettbewerbs im Detail analysiert, darunter der Kontrahierungszwang, der einheitliche Leistungskatalog und der Risikostrukturausgleich. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Analyse der verschiedenen Wettbewerbsinstrumente der Krankenkassen, wie Preispolitik, Produktpolitik, Distributionspolitik und Kommunikationspolitik. Abschließend werden Möglichkeiten zur Intensivierung des Wettbewerbs im Rahmen des geplanten „Gesundheitsfonds“ sowie weitere alternative Ansätze erörtert, die eine Auflockerung des gegenwärtigen Systems ermöglichen könnten.
Schlüsselwörter
Gesetzliche Krankenversicherung, Wettbewerb, Gesundheitsfonds, Risikostrukturausgleich, Leistungskatalog, Beitragsbemessung, Kontrahierungszwang, Risikoselektion, soziale Verträglichkeit.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird der Wettbewerb in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) reguliert?
Durch Instrumente wie den Kontrahierungszwang, den einheitlichen Leistungskatalog und den Risikostrukturausgleich (RSA).
Was ist der Risikostrukturausgleich?
Ein Mechanismus, der finanzielle Unterschiede zwischen Krankenkassen ausgleicht, die durch unterschiedliche Versichertenstrukturen (Alter, Geschlecht, Krankheit) entstehen.
Was versteht man unter Risikoselektion?
Risikoselektion (oder „Rosinenpickerei“) ist der Versuch von Versicherern, vorwiegend „gute Risiken“ (gesunde, junge Mitglieder) anzuwerben und „schlechte Risiken“ zu vermeiden.
Welche Rolle spielt der Gesundheitsfonds für den Wettbewerb?
Der Gesundheitsfonds zentralisiert den Beitragseinzug und verteilt die Mittel nach einem morbiditätsorientierten Schlüssel neu, was die Wettbewerbsstrategien der Kassen verändert.
Welche Wettbewerbsinstrumente nutzen Krankenkassen?
Kassen nutzen Preispolitik (Zusatzbeiträge), Produktpolitik (Zusatzleistungen), Distributionspolitik (Service-Netz) und Kommunikationspolitik (Marketing).
Was bedeutet „soziale Verträglichkeit“ im Kassenwettbewerb?
Es hinterfragt, ob verstärkter Wettbewerb und Marktmechanismen die solidarische Grundversorgung und den gerechten Zugang für alle Versicherten gefährden.
- Citation du texte
- Thomas-Naoki Nakashima (Auteur), 2007, Möglichkeiten zur Intensivierung des Kassenwettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83743