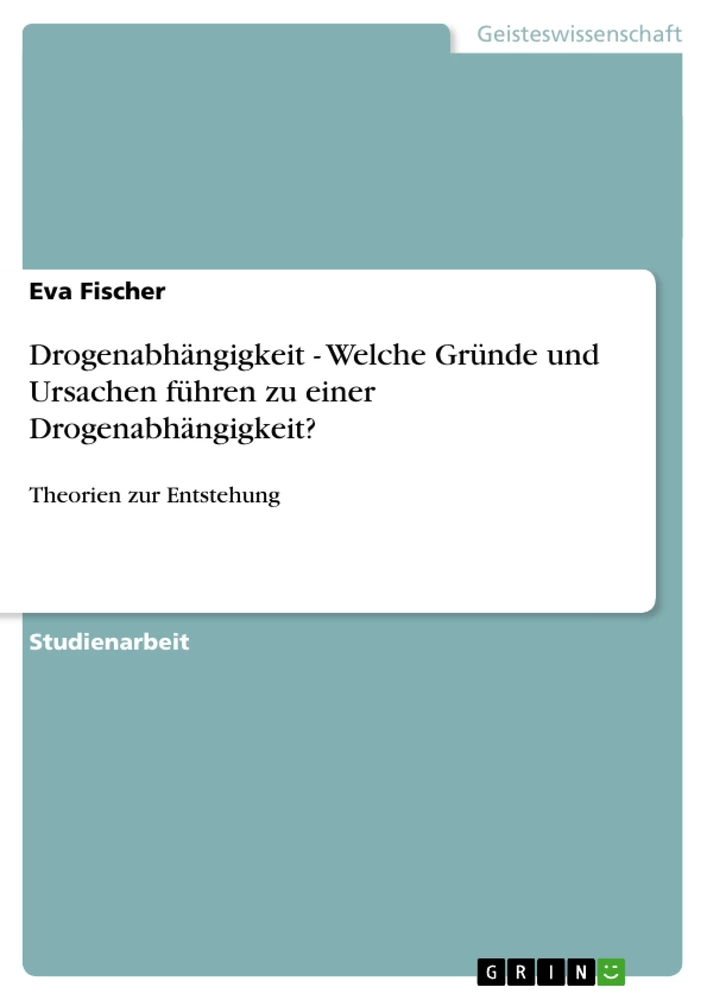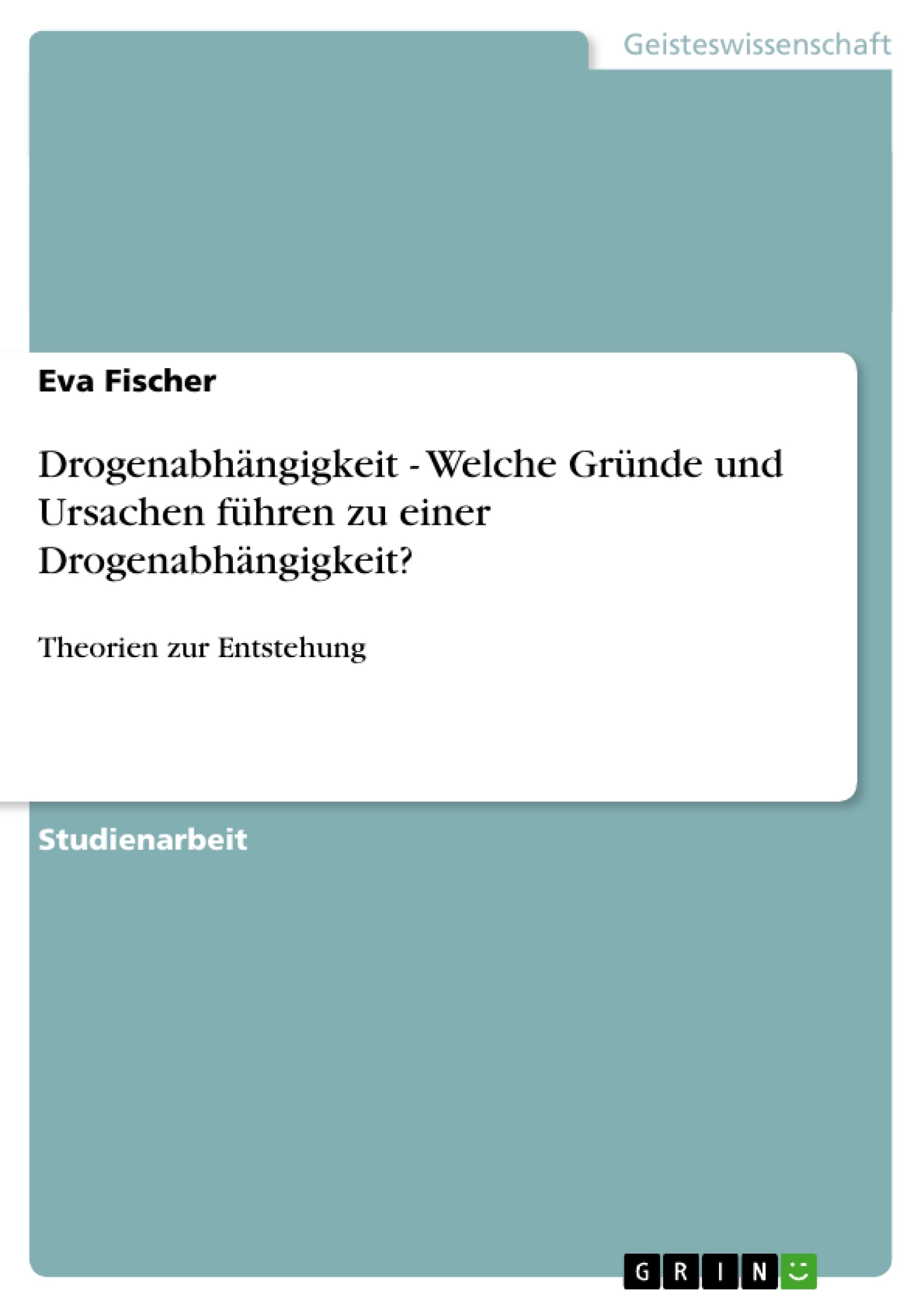Drogenprobleme bzw. Drogenabhängigkeit gehören zu den in der Öffentlichkeit am heftigsten diskutierten Themen.
Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) handelt es sich bei dem Begriff Drogenabhängigkeit „um eine Gruppe körperlicher, Verhaltens- und kognitiver Phänomene, bei denen der Konsum einer Substanz oder einer Substanzklasse für die betroffene Person Vorrang hat gegenüber anderen Verhaltensweisen, die von ihr früher höher bewertet wurden“. Ein entscheidendes Merkmal der Abhängigkeit ist der häufig stärke, manchmal übermächtige Wunsch, psychotrope Substanzen oder Medikamente, Alkohol oder Tabak zu konsumieren. Die Abhängigkeit kann sich auf einen einzelnen Stoff, eine Gruppe von Substanzen oder ein weiteres Spektrum unterschiedlicher Substanzen beziehen.
(vgl. Remschmidt/Schmidt/Poustka 2001, S. 115)
Doch was sind die Gründe und Ursachen dafür? Warum werden einige Menschen süchtig und abhängig, andere aber nicht?
Mit dieser Frage möchte ich mich im Rahmen der vorliegenden Hausarbeit beschäftigen. In der Literatur findet man hierzu die unterschiedlichsten Theorien und Ansätze. Um den Rahmen dieser Hausarbeit nicht zu sprengen, soll im Folgenden lediglich ein Überblick der Theorien aus psychoanalytischer, lerntheoretischer, systemischer, molekularbiologischer sowie politisch-ökonomischer Sicht gegeben werden.
Am Ende der Arbeit soll nochmals auf die Eingangsfrage eingegangen und zusammengefasst werden, welche Faktoren eine besondere Rolle bei der Entstehung einer Drogenabhängigkeit spielen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Psychoanalytische Theorien
- 1.1 Psychische Instanzen
- 1.2 Abwehrmechanismen
- 2. Lerntheorien
- 2.1 Konditionierung
- 2.2 Modell-Lernen
- 2.3 Die Wirkung von Strafmaßnahmen nach lerntheoretischer Sicht
- 3. Systemische Theorien
- 4. Molekularbiologische Theorien
- 4.1 Körpereigene Suchtstoffe
- 4.2 Genetisch bedingtes Suchtverhalten
- 5. Politisch-ökonomische Theorien
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert die verschiedenen Theorien zur Entstehung von Drogenabhängigkeit. Ziel ist es, ein tieferes Verständnis für die Ursachen und Gründe dieser komplexen Thematik zu entwickeln.
- Psychodynamische Ansätze und die Rolle der Persönlichkeitsentwicklung
- Lernprozesse und die Entstehung von Suchtverhalten
- Systemische Einflussfaktoren auf die Drogenabhängigkeit
- Biologische Faktoren und die Rolle der Genetik
- Politisch-ökonomische Ursachen und die Auswirkungen auf Drogenkonsum
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit legt den Fokus auf die Ursachen und Gründe für Drogenabhängigkeit. Sie beleuchtet verschiedene Theorien und Ansätze aus unterschiedlichen Perspektiven.
- 1. Psychoanalytische Theorien: Diese Theorien betrachten die Entstehung der Sucht als Störung der Persönlichkeitsentwicklung. Sie betonen die Bedeutung frühkindlicher Beziehungsstrukturen und die Rolle der psychischen Instanzen „Es“, „Ich“ und „Über-Ich“.
- 2. Lerntheorien: Die Lerntheorien fokussieren auf die Rolle von Konditionierung, Modelllernen und der Wirkung von Strafmaßnahmen bei der Entwicklung von Suchtverhalten.
- 3. Systemische Theorien: Systemische Theorien untersuchen die komplexen Zusammenhänge innerhalb von Familien und sozialen Systemen, die zur Entstehung von Drogenabhängigkeit beitragen können.
- 4. Molekularbiologische Theorien: Diese Theorien befassen sich mit dem Einfluss von körpereigenen Suchtstoffen und genetischen Faktoren auf die Entstehung von Suchtverhalten.
- 5. Politisch-ökonomische Theorien: Politisch-ökonomische Theorien analysieren die Auswirkungen sozialer und ökonomischer Bedingungen auf den Drogenkonsum und die Entstehung von Suchtproblemen.
Schlüsselwörter
Drogenabhängigkeit, Psychoanalytische Theorien, Lerntheorien, Systemische Theorien, Molekularbiologische Theorien, Politisch-ökonomische Theorien, Persönlichkeitsentwicklung, Suchtverhalten, Soziale Faktoren, Biologische Faktoren.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert die WHO den Begriff Drogenabhängigkeit?
Als Gruppe körperlicher und kognitiver Phänomene, bei denen der Konsum einer Substanz Vorrang vor früher höher bewerteten Verhaltensweisen hat.
Welchen Erklärungsansatz bietet die Psychoanalyse zur Sucht?
Die Psychoanalyse sieht Sucht oft als Störung der Persönlichkeitsentwicklung, die in frühkindlichen Beziehungsstrukturen und Konflikten zwischen Es, Ich und Über-Ich wurzelt.
Wie erklären Lerntheorien das Entstehen einer Abhängigkeit?
Durch Mechanismen wie Konditionierung (Belohnungseffekt der Droge) und Modell-Lernen (Nachahmung von Bezugspersonen).
Welche biologischen Faktoren spielen bei Sucht eine Rolle?
Molekularbiologische Theorien untersuchen genetisch bedingtes Suchtverhalten und die Rolle körpereigener Suchtstoffe (Neurotransmitter).
Was ist der Fokus systemischer Theorien zur Drogenabhängigkeit?
Sie betrachten die Sucht im Kontext des gesamten Familiensystems und sozialer Netzwerke, in denen die Abhängigkeit eine bestimmte Funktion erfüllen kann.
Welchen Einfluss haben politisch-ökonomische Bedingungen?
Diese Theorien analysieren, wie soziale Ungleichheit, Armut oder ökonomischer Druck den Drogenkonsum in bestimmten Bevölkerungsgruppen fördern können.
- Citation du texte
- Eva Fischer (Auteur), 2006, Drogenabhängigkeit - Welche Gründe und Ursachen führen zu einer Drogenabhängigkeit?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83746