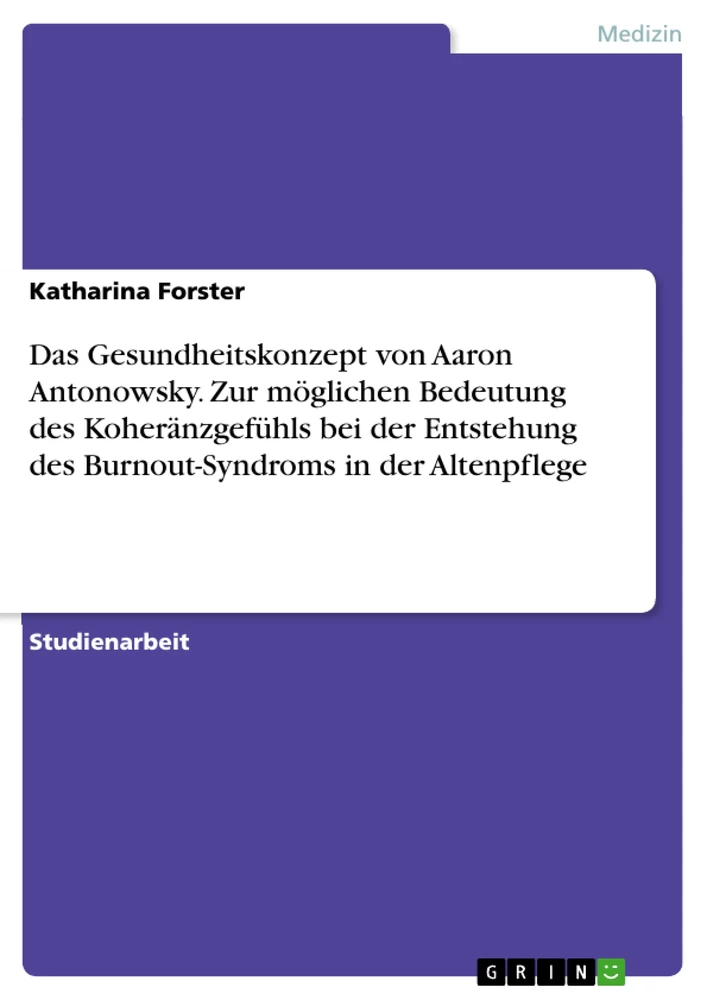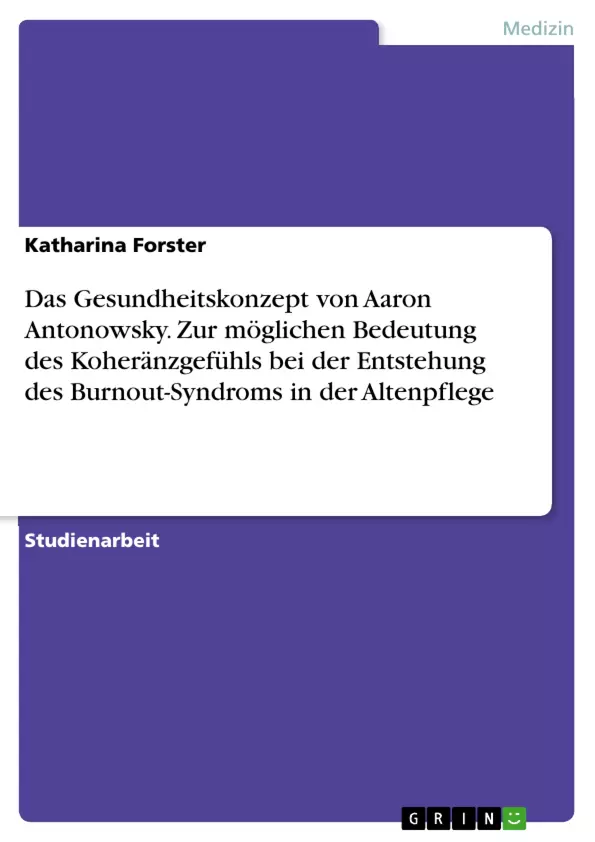In der Vergangenheit wurde durch die Dominanz der naturwissenschaftlichen Medizin das Thema Gesundheit geprägt durch den Begriff der Krankheit. Diese ".. pathologische Orientierung versucht(e) zu erklären, warum Menschen krank werden (und) sie unter eine gegebene Krankheitskategorie fallen." (Antonowsky 1997, 15)
Demgegenüber steht die neuere Tendenz, die sich nicht der Heilung von Krankheit verschreibt, sondern vielmehr die Wiederherstellung und Erhaltung von Gesundheit fokussiert, die "salutogenetische Orientierung, die sich auf die Ursprünge der Gesundheit konzentriert ..." (Antonowsky 1997, 15). Die Fragen, die hier zu klären sind, lauten: "Warum befinden sich Menschen auf der positiven Seite des Gesundheits-Krankheits-Kontinuums oder warum bewegen sie sich auf den positiven Pol zu, unabhängig von ihrer aktuellen Position?" (Antonowksy 1997, 15)
Den Kerngedanken des salutogenetischen Modells stellt die Theorie des Koheränzgefühls dar, das sich nach Antonowsky im Lauf des Lebens entwickelt und auch verändern kann. Seiner Aussage nach trägt die Stärke des Koheränzgefühls maßgeblich dazu bei, wie Menschen mit Einwirkungen von außen umgehen und wo sie sich auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum wahrnehmen. (vgl. Antonowsky 1997, 33)
Aus diesen Gedanken lässt sich schließen, dass eine Veränderung des Koheränzgefühls ihre Position verändern und sie somit mehr auf den einen oder anderen Pol des Gesundheits-Krankheitskontinuum zubewegen könnte.
Er geht weiter davon aus, dass eine Person mit einem starken SOC (= Koheränzgefühl) "..eher als eine mit einem schwachen SOC einen Stressor als glücklicher, weniger konfliktreich oder weniger gefährlich bewertet." (Antonowsky 1997, 128/129)
Diese Annahme soll im Folgenden auf die mögliche Wirksamkeit bei der Vermeidung einer im Gesundheitswesen - hier exemplarisch in der Altenpflege - zunehmend auftretenden Einschränkung des Wohlbefindens, dem Burnout-Syndrom, betrachtet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Themenabgrenzung
- 2 Das Gesundheitskonzept von Aaron Antonowsky
- 2.1 Begriffe
- 2.1.1 Salutogenese und Pathogenese
- 2.1.2 Stressoren
- 2.2 Das Konzept des Koheränzgefühls
- 2.2.1 Definition Koheränzgefühl
- 2.2.2 Komponenten des Koheränzgefühls
- 2.2.3 Zusammenhang zwischen den Komponenten
- 2.2.4 Bedeutung von Grenzen für das Koheränzgefühl
- 2.3 Wege zu erfolgreichem Coping und zu Gesundheit
- 2.1 Begriffe
- 3 Das Burnout-Syndrom
- 3.1 Definition Burnout
- 3.2 Entstehung des Burnout-Syndroms
- 3.3 Phasen und Symptomatik des Burnout-Syndroms
- 3.4 Burnout und Altenpflege
- 4 Mögliche Bedeutung des Koheränzgefühls bei der Entstehung des Burnout-Syndroms in der Altenpflege
- 4.1 Ausgangspunkt
- 4.2 Mögliche Bedeutung
- 5 Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Bedeutung des Koheränzgefühls nach Aaron Antonowsky im Kontext der Entstehung von Burnout in der Altenpflege. Sie beleuchtet das salutogenetische Modell und seine zentralen Konzepte, um die Frage zu beantworten, inwiefern ein starkes oder schwaches Koheränzgefühl die Entstehung von Burnout beeinflusst.
- Das salutogenetische Modell von Aaron Antonowsky und der Begriff der Salutogenese
- Das Koheränzgefühl als zentraler Bestandteil des salutogenetischen Modells
- Das Burnout-Syndrom und seine Erscheinungsformen in der Altenpflege
- Der Zusammenhang zwischen Koheränzgefühl und dem Risiko, an Burnout zu erkranken
- Mögliche Implikationen für präventive Maßnahmen in der Altenpflege
Zusammenfassung der Kapitel
1 Themenabgrenzung: Die Arbeit grenzt sich von der traditionellen pathogenen Sichtweise auf Gesundheit ab, die sich auf Krankheit konzentriert, und wählt stattdessen einen salutogenetischen Ansatz. Der Fokus liegt auf der Frage, warum Menschen gesund bleiben oder gesund werden, anstatt warum sie krank werden. Die Arbeit untersucht die Rolle des Koheränzgefühls als zentralen Faktor im salutogenetischen Modell und dessen mögliche Bedeutung bei der Entstehung von Burnout in der Altenpflege.
2 Das Gesundheitskonzept von Aaron Antonowsky: Dieses Kapitel stellt das salutogenetische Modell von Antonowsky vor und definiert zentrale Begriffe wie Salutogenese und Pathogenese. Es erläutert die Unterscheidung zwischen diesen beiden Ansätzen und betont die Bedeutung von Stressoren als allgegenwärtige Herausforderungen, deren Bewältigung – abhängig vom individuellen Koheränzgefühl – zu Gesundheit oder Krankheit führen kann. Das Kapitel führt das Konzept des Koheränzgefühls ein und beschreibt dessen Komponenten: Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit.
3 Das Burnout-Syndrom: Dieses Kapitel definiert das Burnout-Syndrom und beschreibt seine Entstehung, Phasen und Symptomatik. Es beleuchtet speziell die Herausforderungen und Belastungen in der Altenpflege, die das Risiko für die Entwicklung eines Burnout-Syndroms erhöhen. Der Fokus liegt auf den Faktoren, die zum Burnout beitragen und wie diese im Kontext der Altenpflege besonders relevant sind.
Schlüsselwörter
Salutogenese, Pathogenese, Aaron Antonowsky, Koheränzgefühl (SOC), Burnout-Syndrom, Altenpflege, Stressoren, Gesundheit, Krankheit, Coping, Resilienz, Prävention.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Koheränzgefühl und Burnout in der Altenpflege
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen dem Koheränzgefühl nach Aaron Antonowsky und der Entstehung von Burnout in der Altenpflege. Sie betrachtet das salutogenetische Modell und analysiert, wie ein starkes oder schwaches Koheränzgefühl die Entwicklung von Burnout beeinflusst.
Welches Modell steht im Mittelpunkt der Arbeit?
Das salutogenetische Modell von Aaron Antonowsky bildet die Grundlage der Arbeit. Dieses Modell konzentriert sich auf die Faktoren, die zur Gesundheit beitragen, im Gegensatz zum traditionellen pathogenen Ansatz, der sich auf Krankheit konzentriert.
Was ist das Koheränzgefühl (SOC)?
Das Koheränzgefühl (Sense of Coherence) ist ein zentrales Konzept im salutogenetischen Modell. Es beschreibt das Ausmaß, in dem eine Person das Leben als verstehbar, handhabbar und sinnvoll erlebt. Die Arbeit analysiert die drei Komponenten des Koheränzgefühls (Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, Sinnhaftigkeit) und ihren Einfluss auf die Entstehung von Burnout.
Wie wird Burnout in der Arbeit definiert und betrachtet?
Die Hausarbeit definiert das Burnout-Syndrom und beschreibt seine Entstehung, Phasen und Symptome. Sie beleuchtet insbesondere die spezifischen Belastungen und Herausforderungen in der Altenpflege, die das Burnout-Risiko erhöhen. Die Arbeit untersucht, wie die Arbeitsbedingungen in der Altenpflege die Entwicklung von Burnout beeinflussen können.
Welchen Zusammenhang untersucht die Arbeit zwischen Koheränzgefühl und Burnout?
Die Arbeit untersucht, wie ein starkes oder schwaches Koheränzgefühl die Entstehung von Burnout in der Altenpflege beeinflusst. Es wird analysiert, ob ein geringes Koheränzgefühl ein Risikofaktor für die Entwicklung von Burnout darstellt und welche Rolle das Koheränzgefühl bei der Bewältigung von Stressoren spielt.
Welche Schlussfolgerungen werden in der Arbeit gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen zum Zusammenhang zwischen Koheränzgefühl und Burnout-Risiko in der Altenpflege. Die Ergebnisse könnten Implikationen für präventive Maßnahmen und die Gestaltung von Arbeitsbedingungen in der Altenpflege haben, um das Burnout-Risiko zu senken.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Themenabgrenzung, Das Gesundheitskonzept von Aaron Antonowsky (mit Unterkapiteln zu Salutogenese, Pathogenese, Koheränzgefühl und seinen Komponenten), Das Burnout-Syndrom, Mögliche Bedeutung des Koheränzgefühls bei der Entstehung des Burnout-Syndroms in der Altenpflege und Literaturverzeichnis.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Salutogenese, Pathogenese, Aaron Antonowsky, Koheränzgefühl (SOC), Burnout-Syndrom, Altenpflege, Stressoren, Gesundheit, Krankheit, Coping, Resilienz und Prävention.
- Arbeit zitieren
- Katharina Forster (Autor:in), 2007, Das Gesundheitskonzept von Aaron Antonowsky. Zur möglichen Bedeutung des Koheränzgefühls bei der Entstehung des Burnout-Syndroms in der Altenpflege, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83852