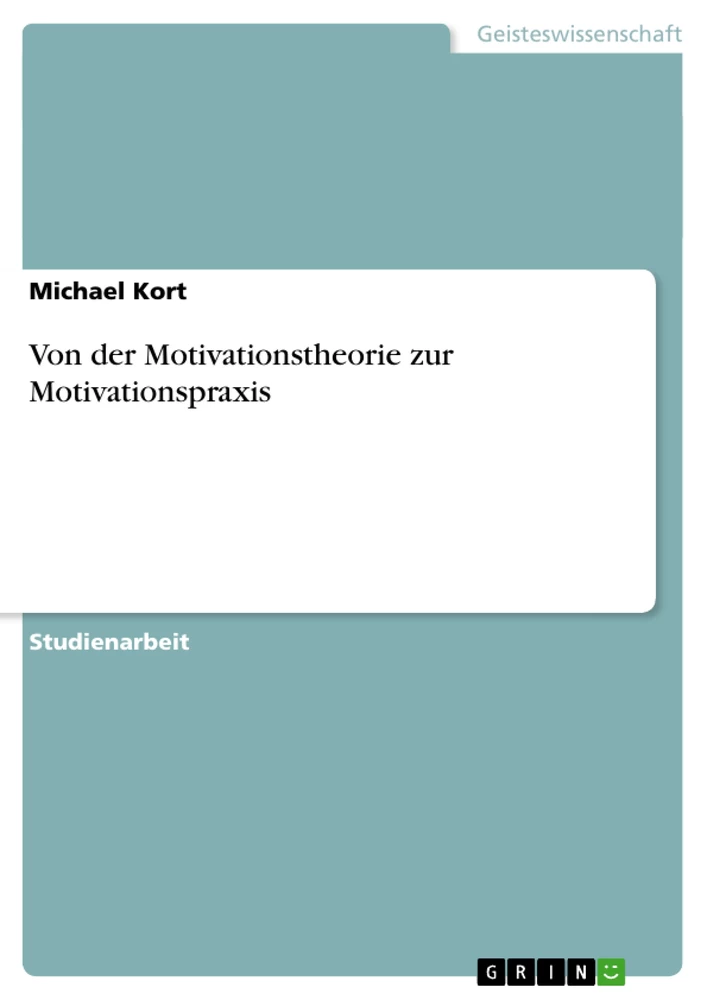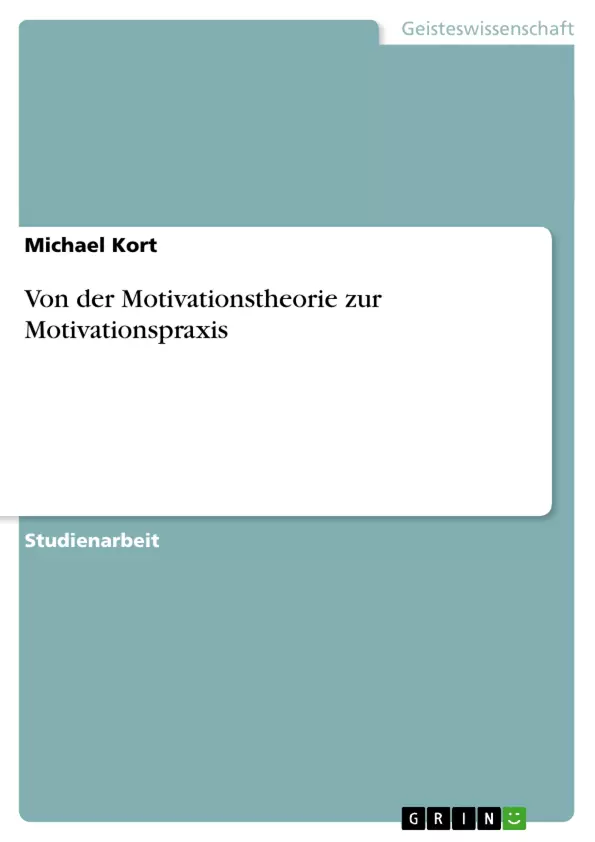Die Hausarbeit widmet sich dem Thema: „Von der Motivationstheorie zur Motivationspraxis“. Der erste Teil der Hausarbeit wird sich der Abgrenzung wichtiger Begriffe widmen, die für das Verständnis der Thematik von Bedeutung sind. Im zweiten Teil wird ein Überblick über die Motivationstheorien erarbeitet, wobei aufgrund des durch die Aufgabenstellung begrenzten Umfanges darauf hingewiesen werden muss, dass es sich nur um ausgewählte Theorien handelt und nicht alle bekannten Motivationstheorien aufgeführt und erläutert werden.
Der dritte Teil der Hausarbeit widmet sich der Darstellung eines Praxisbeispiels, das im Folgenden analysiert und auch zur Erstellung eines Handlungsleitfadens dienen wird. Die im Punkt 3 genannten Motivationstheorien sollen zur Fallanalyse herangezogen werden um in Punkt 5 einen Handlungsleitfaden zur Problemlösung zu entwickeln.
Die Hausarbeit wird mit einem persönlichen Schlusswort über die praktische Umsetzbarkeit der Motivationstheorien enden.
Inhaltsverzeichnis
I. Abkürzungsverzeichnis
II. Abbildungsverzeichnis
1. Ziel der Hausarbeit
2. Motivation
2.1 Abgrenzung der Begrifflichkeiten
2.1.1 Motiv
2.1.2 Motivation
2.1.3 Valenz
2.2 intrinsische Motivation vs. Extrinsische Motivation
3. Motivationstheorien
3.1 Inhaltstheorien der Motivation
3.1.1 Maslowsche Bedürfnispyramide
3.1.2 Die ERG-Theorie nach Alderfer
3.1.3 Zwei-Faktoren-Theorie von Herzberg
3.2 Prozesstheorien der Motivation
3.2.1 Die Leistungsmotivationstheorie
3.2.2 Die VIE-Theorie von Vroom
4. Praxisfall
4.1 Beschreibung des Falles
4.2 Analyse des Falles
5. Handlungsempfehlung
6. Fazit – persönliches Wort
III. Quellenverzeichnis
Eidesstattliche Erklärung
I. Abkürzungsverzeichnis
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
II. Abbildungsverzeichnis
Abb. 1: Bedürfnispyramide nach Maslow
Abb. 2: Herzbergs Faktoren
1. Ziel der Hausarbeit
Die Hausarbeit widmet sich dem Thema: „Von der Motivationstheorie zur Motivationspraxis“. Der erste Teil der Hausarbeit wird sich der Abgrenzung wichtiger Begriffe widmen, die für das Verständnis der Thematik von Bedeutung sind. Im zweiten Teil wird ein Überblick über die Motivationstheorien erarbeitet, wobei aufgrund des durch die Aufgabenstellung begrenzten Umfanges darauf hingewiesen werden muss, dass es sich nur um ausgewählte Theorien handelt und nicht alle bekannten Motivationstheorien aufgeführt und erläutert werden.
Der dritte Teil der Hausarbeit widmet sich der Darstellung eines Praxisbeispiels, das im Folgenden analysiert und auch zur Erstellung eines Handlungsleitfadens dienen wird. Die im Punkt 3 genannten Motivationstheorien sollen zur Fallanalyse herangezogen werden um in Punkt 5 einen Handlungsleitfaden zur Problemlösung zu entwickeln.
Die Hausarbeit wird mit einem persönlichen Schlusswort über die praktische Umsetzbarkeit der Motivationstheorien enden.
2. Motivation
2.1 Abgrenzung der Begrifflichkeiten
2.1.1 Motiv
Das Motiv beschreibt in der Psychologie Beweggründe menschlichen Handelns, die auf das Erreichen eines Handlungsziels abzielen. Motive sind in Natura individuell verschieden ausgeprägt und hängen von den Bedürfnissen als auch den Zielen der Individuen ab. „Handlungsziele werden … nach gemeinsamen Themen zusammengefasst und mit allgemeinen Begriffen wie zum Beispiel „Leistung“, „Macht“ oder „sozialer Anschluss“ umschrieben“ (NERDINGER, 2003, 3). Motive sind somit der Antrieb menschlichen Handelns.
2.1.2 Motivation
Handlungen und Entscheidungen eines jeden Individuums werden durch deren Motive geprägt. Als Motivation ist somit die Gesamtheit aller Motive zu verstehen, die das menschliche Handeln beeinflussen. Im Rückkehrschluss ist also das Motiv die entscheidende Determinante der individuellen Motivation. „`Es wird heute kaum noch bestritten, daß [!] ein großer Teil (zumindest) der menschlichen Motivationen sich im Laufe des Lebens bildet und ändert`(HECKHAUSEN 1963, 5)[1].“ Motivation wird durch die Umwelt beeinflusst und kann langfristig in der Umwelt gelernt und durch Situationen geprägt werden. Betrachtet man die Motivation in einem kurzen Zeitraum, so können die Motive und deren innere Strukturen durch wahrgenommene Anregungsbedingungen aktiviert werden, man spricht dann von aktivierten Motiven (vgl. VON ROSENSTIEL, 1975, 55 f).
2.1.3 Valenz
Die Valenz umschreibt individuelle Wertungen von emotionalen Zuständen, die Individuen nach eigener Maßgabe als erstrebenswert oder eben nicht erstrebenswert einschätzen. Eine positive Valenz gibt den Grad eines erstrebenswerten Zustandes an. Ist eine Valenz mit einem negativen Vorzeichen vorhanden, so wird dieser Zustand als nicht erstrebenswert angesehen und wird von den Individuen vermieden (vgl. WIKIPEDIA (2007), Valenz. Online im Internet: URL: „http://de.wikipedia.org/wiki/Valenz-Instrumentalit%C3%A4ts-Erwartungs-Theorie [Stand 05.07.2007]).
2.2 intrinsische Motivation vs. Extrinsische Motivation
Das Wort intrinsisch stammt aus dem englischen Wort „intrinsic“ und bedeutet übersetzt „innerlich“, „eigentlich“ oder „wahr“. Intrinsische Motivation bewirkt ein Verhalten aufgrund von innerer Lust, welches sich in Form von Spaß oder Interesse an der Handlung auszeichnet und somit zum Selbstzweck ausgeführt wird. Intrinsische Motivation bedarf keinem äußerlichen zutun, sie entsteht aus eigenem Antrieb (vgl. RHEINBERG, 2004, 150).
Das Wort extrinsisch stammt ebenfalls aus dem Englischen „extrinsic“ und bedeutet „äußerlich“ oder „nicht wirklich dazugehörend“. Extrinsische Motivation wird als induzierte Motivation bezeichnet, deren Motiv als Mittel zum Zweck beschrieben werden kann. Eine Handlung wird somit aufgrund eines gewollten Ziels vollzogen und kann von außen gesteuert oder beeinflusset werden (vgl. RHEINBERG, 2004, 150). Extrinsische Anreize haben die Charakteristik, dass sie in der Regel nur kurzfristig auf die Motivation wirken (vgl. NERDINGER, 2003, 22).
3. Motivationstheorien
3.1 Inhaltstheorien der Motivation
Inhaltstheorien untersuchen die Substanz der Motivation, widmen sich ferner der Fragestellung, welche Faktoren in Individuen und deren Umwelt Verhalten erzeugen und dieses aufrecht erhalten.
3.1.1 Maslowsche Bedürfnispyramide
Maslow untergliedert die Bedürfnisse in fünf Motivgruppen und unterstellt, dass diese Motive/Bedürfnisse nacheinander geweckt werden. Nach Maslow verspürt der Mensch zuerst physiologische Bedürfnisse (Hunger, Durst etc.), die er an erster Stelle befriedigen wird. Sofern diese Bedürfnisse befriedigt sind, wird der Mensch nach Sicherheit in Form von Vorsorge, Schutz, einem geregeltem Einkommen etc. streben. Die weiteren Motivklassen sind der Grafik zu entnehmen. Maslow unterteilt
[...]
[1] HECKHAUSEN, 1963, 5 (zitiert nach VON ROSENSTIEL 1975, 55)
Häufig gestellte Fragen zur Motivationstheorie und -praxis
Was ist der Unterschied zwischen Motiv und Motivation?
Ein Motiv ist ein individueller Beweggrund (Antrieb), während Motivation die Gesamtheit aller Motive beschreibt, die eine Handlung beeinflussen.
Was unterscheidet intrinsische von extrinsischer Motivation?
Intrinsische Motivation kommt aus eigenem Antrieb (Spaß an der Sache), extrinsische Motivation wird durch äußere Anreize (Mittel zum Zweck) erzeugt.
Was besagt die Maslowsche Bedürfnispyramide?
Sie unterteilt menschliche Bedürfnisse in fünf Stufen, die nacheinander befriedigt werden müssen: von physiologischen Bedürfnissen bis zur Selbstverwirklichung.
Was sind Herzbergs zwei Faktoren in der Motivation?
Herzberg unterscheidet zwischen Hygienefaktoren (verhindern Unzufriedenheit) und Motivatoren (erzeugen echte Zufriedenheit und Leistungswillen).
Was beschreibt die VIE-Theorie von Vroom?
Sie ist eine Prozesstheorie, die Motivation als Ergebnis aus Valenz (Wertigkeit), Instrumentalität und Erwartung erklärt.
- Quote paper
- Michael Kort (Author), 2007, Von der Motivationstheorie zur Motivationspraxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83883