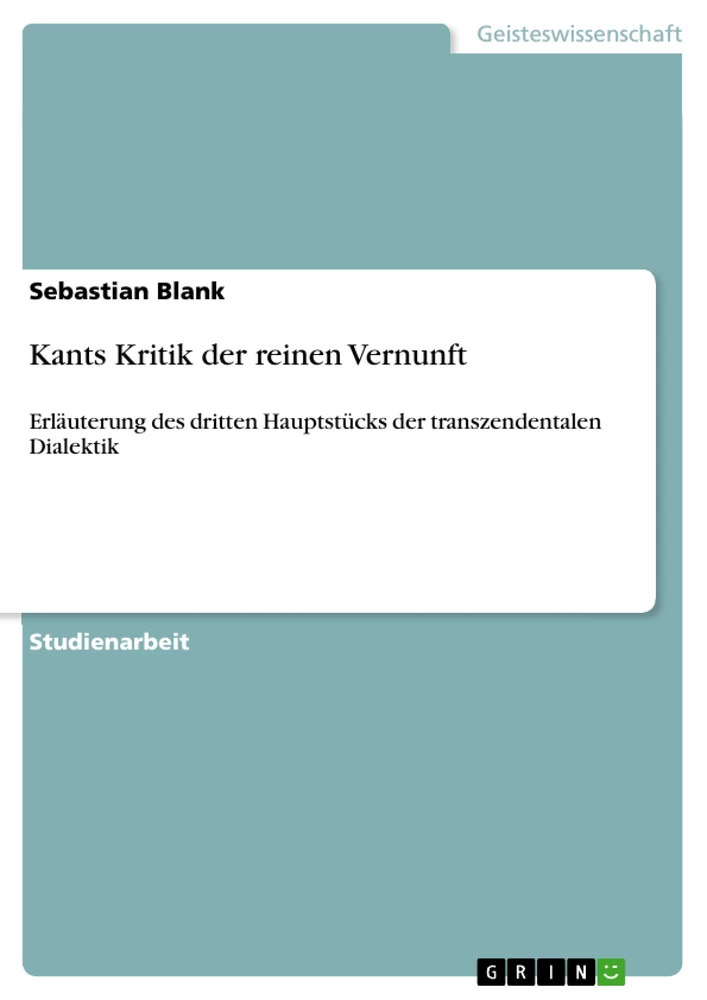In der Vorrede zu beiden Auflagen der Kritik reinen Vernunft spricht Immanuel Kant bereits im ersten Satz von der Untersuchung der Vernunft und der in diesem Zuge auftretenden Problematik. Erst einige hundert Seiten später jedoch wird er sich in seinem Werk genauer mit diesem Thema befassen.
Zunächst widmet er sich in der transzendentalen Ästhetik und der transzendentalen Analytik (als erster Abteilung der transzendentalen Logik) dem Verstand. Er erläutert, dass für den Menschen Erkenntnis durch sinnliche Anschauung in Raum und Zeit, Bildung von Begriffen und der Bildung von Urteilen anhand der Verbindung von Kategorien und Begriffen durch die Schemata möglich ist. In der transzendentalen Dialektik (als zweiter Abteilung der transzendentalen Logik) untersucht Kant dann die Vernunft, die im Gegensatz zum Verstand versucht, über die Welt der Erscheinungen hinauszugehen, um zu Erkenntnis zu gelangen, was zum Schein führt.
In der vorliegenden Arbeit wird das dritte Hauptstück der transzendentalen Dialektik erläutert und versucht die Gedankengänge Kants deutlich zu machen. Die Widerlegungen sowohl des ontologischen, des kosmologischen als auch des physikotheologischen Gottesbeweises bilden den Kern des dritten Hauptstücks und brachten dem Königsberger Philosophen unter Anderem Beinamen wie „Alleszermalmer“ und Vergleiche mit dem Revolutionär Robespierre ein.
Jeder Abschnitt des dritten Hauptstücks sowie der Anhang werden in dieser Arbeit in der von Kant angewandten Reihenfolge erklärt. Nachdem Kant in der Widerlegung der vierten Antinomie erläuterte, dass ein von der Zufälligkeit der Sinnenwelt befreiter und intelligibeler Grund der Erscheinungen denkbar ist, fragt er nun im dritten Hauptstück nach der Beweisbarkeit dieses Grundes bzw. Gottes. Bevor er die Widerlegung der Gottesbeweise in Angriff nimmt, rekonstruiert Kant jedoch zunächst den Weg und die Vorraussetzungen, die zur Schaffung des Begriffs „Gott“ nötig sind und beginnt dies im ersten Abschnitt, den er „Von dem Ideal überhaupt“ nennt.
Inhalt
1 Einleitung
2 Von dem Ideal überhaupt
3 Von dem transzendentalen Ideal
4 Von den Beweisgründen der spekulativen Vernunft, auf das Dasein eines höchsten Wesens zu schließen
5 Von der Unmöglichkeit eines ontologischen Beweises vom Dasein Gottes
6 Von der Unmöglichkeit eines kosmologischen Beweises vom Dasein Gottes
7 Von der Unmöglichkeit des physikotheologischen Beweises
8 Kritik aller Theologie aus spekulativen Prinzipien der Vernunft
9 Anhang zur transzendentalen Dialektik
10 Richard Dawkins: Gott als Mem-Produkt
11 Schlussbemerkung
1
In der Vorrede zu beiden Auflagen der Kritik reinen Vernunft[i] spricht Immanuel Kant bereits im ersten Satz von der Untersuchung der Vernunft und der in diesem Zuge auftretenden Problematik. Erst einige hundert Seiten später jedoch wird er sich in seinem Werk genauer mit diesem Thema befassen.
Zunächst widmet er sich in der transzendentalen Ästhetik und der transzendentalen Analytik (als erster Abteilung der transzendentalen Logik) dem Verstand. Er erläutert, dass für den Menschen Erkenntnis durch sinnliche Anschauung in Raum und Zeit, Bildung von Begriffen und der Bildung von Urteilen anhand der Verbindung von Kategorien und Begriffen durch die Schemata möglich ist. In der transzendentalen Dialektik (als zweiter Abteilung der transzendentalen Logik) untersucht Kant dann die Vernunft, die im Gegensatz zum Verstand versucht, über die Welt der Erscheinungen hinauszugehen, um zu Erkenntnis zu gelangen, was zum Schein führt.
In der vorliegenden Arbeit wird das dritte Hauptstück der transzendentalen Dialektik erläutert und versucht die Gedankengänge Kants deutlich zu machen. Die Widerlegungen sowohl des ontologischen, des kosmologischen als auch des physikotheologischen Gottesbeweises bilden den Kern des dritten Hauptstücks und brachten dem Königsberger Philosophen unter Anderem Beinamen wie „Alleszermalmer“[ii] und Vergleiche mit dem Revolutionär Robespierre ein.
Jeder Abschnitt des dritten Hauptstücks sowie der Anhang werden in dieser Arbeit in der von Kant angewandten Reihenfolge erklärt. Nachdem Kant in der Widerlegung der vierten Antinomie erläuterte, dass ein von der Zufälligkeit der Sinnenwelt befreiter und intelligibeler Grund der Erscheinungen denkbar ist, fragt er nun im dritten Hauptstück nach der Beweisbarkeit dieses Grundes bzw. Gottes. Bevor er die Widerlegung der Gottesbeweise in Angriff nimmt, rekonstruiert Kant jedoch zunächst den Weg und die Vorraussetzungen, die zur Schaffung des Begriffs „Gott“ nötig sind und beginnt dies im ersten Abschnitt, den er „Von dem Ideal überhaupt“ nennt.
2
Kant unterscheidet in diesem Abschnitt die Beziehung von Kategorien, Ideen und Idealen zur objektiven Realität. Kategorien sind anwendbar auf Sinnliches. Sehen wir beispielsweise, wie ein Stück Butter in der Sonne schmilzt, können wir die Kategorie der Kausalität auf unseren Seh-Sinn anwenden und zu der Erkenntnis gelangen, dass, wenn die Sonne scheint, die Butter(unter der Sonne) schmilzt.
Ideen sind weiter von der objektivern Realität entfernt als Kategorien. Für Ideen kann keine Erscheinung gefunden werden. Eine Idee enthält eine gewisse Vollständigkeit, der sich die empirisch mögliche Einheit nähern, sie aber nie vollständig erreichen kann. Die Idee von der Unsterblichkeit der Seele kann beispielsweise nicht auf die Sinne angewandt werden.
Ideale sind noch weiter von der Realität entfernt als Ideen. Unter Ideal versteht Kant regulative Prinzipien ohne schöpferische Kraft. Ideale liegen der Möglichkeit der Vollkommenheit gewisser Handlungen zugrunde. Um solche Ideale geht es Kant bei seinen nachfolgenden Analysen. Ein Ideal ist beispielsweise die Weisheit. Sie ist ein Richtmaß für diejenigen, die weise handeln wollen. Weisheit kann jedoch empirisch nie erreicht werden. Ein weiteres Beispiel ist die Schönheit. Ideale sind keine Hirngespinste. Dadurch, dass wir uns ihnen annähern, können wir Grad und Mängel des Unvollständigen an uns abmessen und in Vergleichen darüber urteilen.
Später entwickelte Max Weber in seiner soziologischen Theorie, diesem Prinzip Kants nachkommend, einen Idealtypus als Richtmaß für soziales Handeln[iii].
3
Im zweiten Abschnitt(„Von dem transzendentalen Ideal“) widmet sich Kant zunächst zwei Grundsätzen.
Der erste Grundsatz besagt, dass jeder Gegenstand unter dem Prinzip der Bestimmbarkeit steht. Das bedeutet, dass einem Gegenstand von allen Prädikaten X entweder jedes X oder sein Gegenteil, jedes Nicht-X zukommen.
Der zweite Grundsatz besagt, dass jeder Gegenstand auch unter dem Prinzip der durchgängigen Bestimmung steht, weil die Vernunft in ihrem Anspruch nach Totalität danach fragt. Jeder Gegenstand steht damit im Verhältnis zur gesamten Möglichkeit, welche der Inbegriff aller Prädikate der Dinge überhaupt ist und leitet seine Möglichkeit von diesem Inbegriff ab. Ein ähnlicher Begriff findet sich bei Leibnitz wieder, dessen „Monaden“ Substanzen sind, aus denen alle zusammengesetzten Substanzen letztendlich bestehen.
Kant spricht hier in diesem Sinne von dem Verhältnis, „der Materie zu aller Möglichkeit, welche a priori die Data zur besonderen Möglichkeit jedes Dinges enthalten soll:“[iv]
Bei „Data“ könnte man jetzt fälschlicherweise an etwas objektiv Reales denken. Dies widerlegt Kant im nächsten Abschnitt, wenn er erklärt, dass diese Möglichkeit bzw. die durchgängige Bestimmung sich lediglich auf einer in der Vernunft angelegten Idee gründet, die nicht in der Realität vorhanden ist.
In einem nächsten Schritt gelangt Kant zum Begriff des Ideals der reinen Vernunft. Vom Inbegriff aller Prädikate überhaupt, dem Urbegriff, kann man alle Prädikate als abgeleitet abziehen, bis ein Begriff von einem einzelnen Gegenstand überhaupt bleibt, den Kant das „Ideal der reinen Vernunft“ tauft. Dieses Ideal entspricht der dem Verstande zu Grunde liegenden durchgängigen Bestimmung seiner Begriffe, nach welcher die Vernunft fragt.
Das Ideal der reinen Vernunft wird jetzt umbenannt zum Begriff der höchsten Realität und dann als Substratum bezeichnet.
Kant erklärt, dass die Menschen diesen bloß in ihrer Vernunft befindlichen Gegenstand ihres Ideals auch als Urwesen oder höchstes Wesen oder Wesen aller Wesen bezeichnen. In dieser Vergegenständlichung des Ideals liegt der Fehler der Gottesbeweise.
„Alles dieses aber bedeutet nicht das objektive Verhältnis eines wirklichen Gegenstandes zu andern Dingen, sondern der Idee zu Begriffen, und lässt uns wegen der Existenz eines Wesens von so ausnehmendem Vorzuge in völlige Unwissenheit.“[v]
Dieses höchste Wesen ist in der Vernunft also nur als Begriff angelegt und die Menschen haben keine Befugnis anzunehmen, dass es existiert. Kant baut also für die Widerlegung der Gottesbeweise schon einmal vor, indem er die Frage nach der Existenz eines höchsten Wesens grundsätzlich als nicht beantwortbar darstellt. Am Ende dieses Abschnitts erklärt er, dass wir aufgrund „einer natürlichen Illusion“[vi] dieses Wesen als empirisch vorhanden ansehen.
4
Obwohl man also die Frage nach der Existenz eines höchsten Wesens scheinbar nicht beantworten kann, fragt die Vernunft ständig nach dem Unbedingten, das allen Dingen zu Grunde liegt. Kant beschreibt im dritten Abschnitt („Von den Beweisgründen der spekulativen Vernunft, auf das Dasein eines höchsten Wesens zu schließen“) den natürlichen Gang jeder menschlichen Vernunft.
Sie geht von der Erfahrung aus und setzt somit Existenz voraus. Die existierenden Dinge existieren nicht zufällig, sondern haben eine Ursache. Es gibt eine Ursache an sich, die ohne Bedingung notwendigerweise da ist. Diese Ursache erhält zunächst den Begriff des ohne Bedingung notwendigen Wesens. Dieses enthält wie im vorherigen Kapitel erklärt, alle Realität. Da wir die Realität als existierend betrachten, schließen wir, dass dieses Wesen existiert. Diese Schlussfolgerungen auf ein Dasein eines höchsten Wesens zweifelt Kant nun an und widmet sich den drei Gottesbeweisen.
5
Der ontologische Gottesbeweis stammt aus dem 11. Jahrhundert, sein Urheber war Anselm von Canterbury(1033-1109). René Descartes(1596-1650), hat den Beweis Anselms aufgegriffen.
Descartes bedient sich in seinen Meditationen[vii] des radikalen Zweifels, um sich von allen Täuschungen frei zu machen und zu unerschütterlichem Wissen zu gelangen. Er zweifelt zunächst auch Gott an, jedoch nicht dessen Existenz, sondern die Art und Weise, wie er dem Mensch „gegenübertritt“. Es könnte sein, nimmt Descartes an, dass Gott uns als Täuschergott(„genius malignus“) die Dinge der Welt nur vortäuscht. Da nach Anzweifeln aller Dinge nur das denkende Ich verbleibt, gelangt Descartes zu seinem allseits bekannten „Cogito ergo sum“. Obwohl er auch Gott anzweifelte, liefert Descartes im weiteren Verlauf der Meditationen einen ontologischen Gottesbeweis, der sich folgendermaßen erklärt:
Jedes Ding hat aufgrund seines Wesens notwendigerweise bestimmte Eigenschaften. Ein Dreieck hat beispielsweise immer die Winkelsumme von 180 Grad. Dieses Argument überträgt Descartes auf Gott. Er geht davon aus, dass wir eine Vorstellung von einem vollkommenen Wesen, Gott, haben. Da Gott vollkommen ist, hat er notwendigerweise alle vollkommenen Eigenschaften. Das bedeutet allerdings noch nicht, dass Gott auch existiert. Descartes führt für seinen Beweis hier eine neue Prämisse ein, indem er Existenz als eine der vollkommenen Eigenschaften bezeichnet.
Danach folgert er: Da Gott alle vollkommenen Eigenschaften zukommen, kommt ihm auch die Eigenschaft der Existenz zu, also existiert er.
Descartes schreibt:
„Denn es steht mir nicht frei, Gott ohne Dasein – d. h. das vollkommenste Wesen ohne höchste Vollkommenheit – zu denken, wie es mir freisteht, mir ein Pferd mit oder ohne Flügel vorzustellen.“[viii]
Kant argumentiert dagegen, dass, wenn man aus dieser Definition Gottes auf seine Existenz schließt, man lediglich eine Tautologie begeht. Die Schlussfolgerung „Gott existiert“ ist in der Prämisse, in den Vorraussetzungen schon angelegt. Der Fehler liegt außerdem darin, Existenz als eine Eigenschaft zu betrachten. Existenz bzw. Sein ist nach Kant jedoch keine Eigenschaft.
Durch eine Eigenschaft kommt einem Gegenstand, einem Begriff etwas hinzu. Durch Existenz wird einem Gegenstand nichts hinzugefügt.
[...]
[i] Kant, Immanuel: Kritik der reinen Vernunft(KrV) 1 und 2, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2000.
[ii] Tetens, Holm: Kants Kritik der reinen Vernunft, S. 284, Reclam, Stuttgart, 2006.
[iii] Vgl. Weber, Max: Max Webers Schriften 1894-1922, S. 653-691, Kröner Verlag, Stuttgart, 2002
[iv] Aus: Kant: KrV 2, S. 516, B 602, Suhrkamp, 2000.
[v] Ebd. S. 520, B 608.
[vi] Ebd. S. 522, B 610.
[vii] Descartes René: Meditationes de prima philosophia, Hamburg, Meiner, 1992.
[viii] Ebd., S. 121.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Kant unter dem "Ideal der reinen Vernunft"?
Es ist die Idee eines Inbegriffs aller Möglichkeiten (Gott), die als regulatives Prinzip in der Vernunft angelegt ist, aber keine bewiesene Realität besitzt.
Warum widerlegte Kant den ontologischen Gottesbeweis?
Kant argumentierte, dass "Sein" kein reales Prädikat ist. Man kann die Existenz eines Wesens nicht einfach aus seinem Begriff ableiten.
Was ist der Unterschied zwischen Verstand und Vernunft bei Kant?
Der Verstand ordnet Erscheinungen mittels Kategorien, während die Vernunft versucht, über die Erfahrung hinauszugehen, was oft zu transzendentalem Schein führt.
Welche drei Gottesbeweise untersuchte Kant?
Er untersuchte und widerlegte den ontologischen, den kosmologischen und den physikotheologischen Gottesbeweis.
Was ist eine "natürliche Illusion" der Vernunft?
Es ist der Drang der Vernunft, bloße Ideen (wie Gott oder Unsterblichkeit) als objektiv reale Gegenstände zu betrachten, obwohl sie nur subjektive Prinzipien sind.
- Quote paper
- Sebastian Blank (Author), 2007, Kants Kritik der reinen Vernunft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/83983