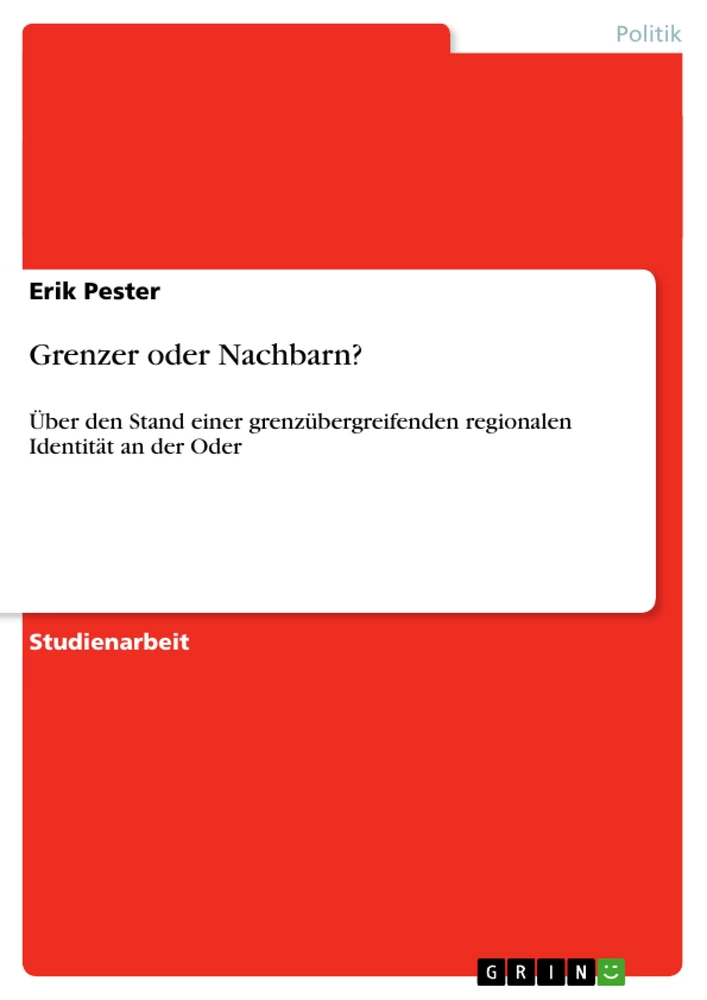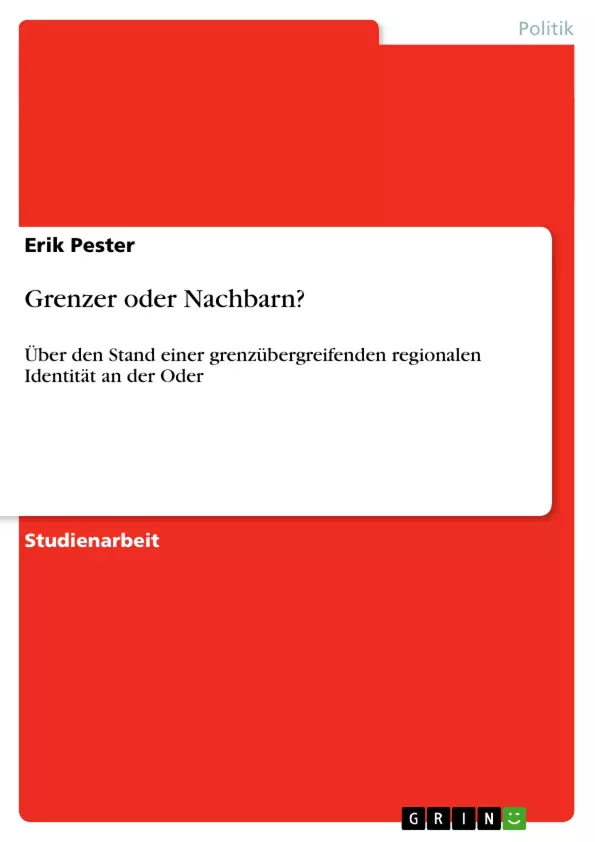Gegenstand der Arbeit ist das Verhältnis von Brandenburgern und Polen, wobei
der Fokus auf der unmittelbaren Nahtstelle zwischen beiden Gebieten, der Oder-
Neiße-Grenze liegt. Es stellt sich die Frage, ob das Verhältnis zwischen den
Bewohnern beider Flussufer von Distanz und Skepsis oder von Interesse und
wechselseitiger Sympathie geprägt ist. Letztere sind unerlässliche Voraussetzungen
für ein Zusammenleben, dass in verschiedener Hinsicht als gewinnbringend für beide
Seiten zu bezeichnen ist. Die Bewohner der unmittelbaren Grenzregion sollten im
Dialog zwischen den Ländern eine Vorreiterrolle einnehmen. Sie bilden
gewissermaßen die Klammer, die Deutschland und Polen unmittelbar verbindet. Aus
dem Status dieser Verbindung lassen sich Rückschlüsse auf die kontextuale Identität
ziehen, was schließlich zur Kernfrage führt: sehen sich die Anrainer der Grenze als
bloße „Grenzer“, also als die letzten Außenposten ihres Heimatlandes, ohne ein
tiefergehendes Interesse für die andere Seite des Flusses zu hegen, oder geht die
Identifikation soweit, dass von einer nachbarschaftlichen Identität ausgegangen
werden kann?
Um diese Frage zu beantworten, muss induktiv vorgegangen werden. Ausführliche
Untersuchungen darüber, ob sich die Bewohner Ostbrandenburgs und Westpolens
als „gute Nachbarn“ verstehen, existieren bedauerlicherweise bisher nicht. Daher
werde ich im Folgenden die Situation an der Grenze aus verschiedenen Blickwinkeln
beschreiben und versuchen daraus abzuleiten, ob die Herausbildung einer
grenzübergreifenden Identität überhaupt möglich ist, was sie begünstigt, was ihr
entgegensteht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Vorüberlegungen.
- 2.1. Zu Identität und Identifikation
- 2.2. Zur Problematik von grenzübergreifender Identität
- 3. Die Situation an der Oder in fünf Aspekten....
- 3.1. Historischer Abriss
- 3.2. Durchlässigkeit: rechtlich, physisch.
- 3.3. Kooperation auf Ebene der Politik........
- 3.4. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen ....
- 3.5. Das Verhältnis zwischen Deutschen und Polen
- 4. Fazit: Ist regionale Identität möglich? …...\n
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, ob an der Oder-Neiße-Grenze eine grenzübergreifende regionale Identität zwischen Brandenburgern und Polen möglich ist. Der Fokus liegt dabei auf der unmittelbaren Nahtstelle zwischen beiden Gebieten und untersucht, ob das Verhältnis zwischen den Bewohnern beider Flussufer von Distanz und Skepsis oder von Interesse und wechselseitiger Sympathie geprägt ist. Die Arbeit beleuchtet die Rolle der Bewohner der unmittelbaren Grenzregion im Dialog zwischen den Ländern und untersucht, ob sie als „Grenzer“ oder als „Nachbarn“ mit einer nachbarschaftlichen Identität wahrgenommen werden.
- Die Bedeutung von Identität und Identifikation im Kontext von regionalen Beziehungen
- Die Herausforderungen und Chancen einer grenzübergreifenden regionalen Identität
- Die historische und politische Entwicklung des Verhältnisses zwischen Deutschland und Polen
- Die Rolle der wirtschaftlichen und sozialen Faktoren in der Entwicklung einer gemeinsamen Identität
- Die Bedeutung von Kooperation und Dialog für die Förderung einer nachbarschaftlichen Identität
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Relevanz der Frage nach einer grenzübergreifenden regionalen Identität im Kontext des deutsch-polnischen Verhältnisses. Im zweiten Kapitel werden die theoretischen Grundlagen der Identitätsforschung und der Problematik von grenzübergreifender Identität beleuchtet. Dabei werden die Konzepte der Identifikation und des "Wir-Gefühls" erläutert und die Bedeutung von kulturellen und historischen Faktoren für die Identitätsbildung hervorgehoben. Das dritte Kapitel analysiert die Situation an der Oder aus fünf Perspektiven: Historischer Abriss, Durchlässigkeit, Kooperation, wirtschaftliche Rahmenbedingungen und das Verhältnis zwischen Deutschen und Polen. Dieses Kapitel beleuchtet die historischen, rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen Aspekte des deutsch-polnischen Verhältnisses und untersucht, wie diese die Entwicklung einer gemeinsamen Identität beeinflussen.
Schlüsselwörter
Grenzübergreifende Identität, regionale Identität, Oder-Neiße-Grenze, Deutsch-polnische Beziehungen, historische Entwicklung, Kooperation, Wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Kultur, Sprache, Traditionen, "Wir-Gefühl", Identifikation, Exklusion, Inklusion, Distanz, Sympathie, Vorurteile, Ressentiments, Dialog, Nachbarn, Grenzer.
Häufig gestellte Fragen
Sind Brandenburger und Polen an der Grenze eher „Grenzer“ oder „Nachbarn“?
Die Arbeit untersucht, ob die Bewohner sich als letzte Außenposten ihres Landes („Grenzer“) verstehen oder eine grenzübergreifende „Nachbarschaftsidentität“ entwickelt haben.
Ist eine regionale Identität an der Oder-Neiße-Grenze möglich?
Trotz historischer Belastungen und Vorurteile gibt es Potenziale für eine gemeinsame Identität, die durch Kooperation und wechselseitige Sympathie gefördert wird.
Welche Faktoren erschweren die grenzübergreifende Identität?
Unterschiedliche wirtschaftliche Rahmenbedingungen, Sprachbarrieren und historische Ressentiments können der Herausbildung eines gemeinsamen „Wir-Gefühls“ entgegenstehen.
Welche Rolle spielt die Politik bei der Annäherung?
Politische Kooperationen auf regionaler Ebene und die rechtliche Durchlässigkeit der Grenze sind wichtige Voraussetzungen für ein gewinnbringendes Zusammenleben.
Warum ist der Dialog in der Grenzregion so wichtig?
Die Bewohner der Grenzregion bilden die unmittelbare Klammer zwischen Deutschland und Polen und nehmen eine Vorreiterrolle im Dialog beider Länder ein.
- Arbeit zitieren
- Erik Pester (Autor:in), 2005, Grenzer oder Nachbarn? , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84018