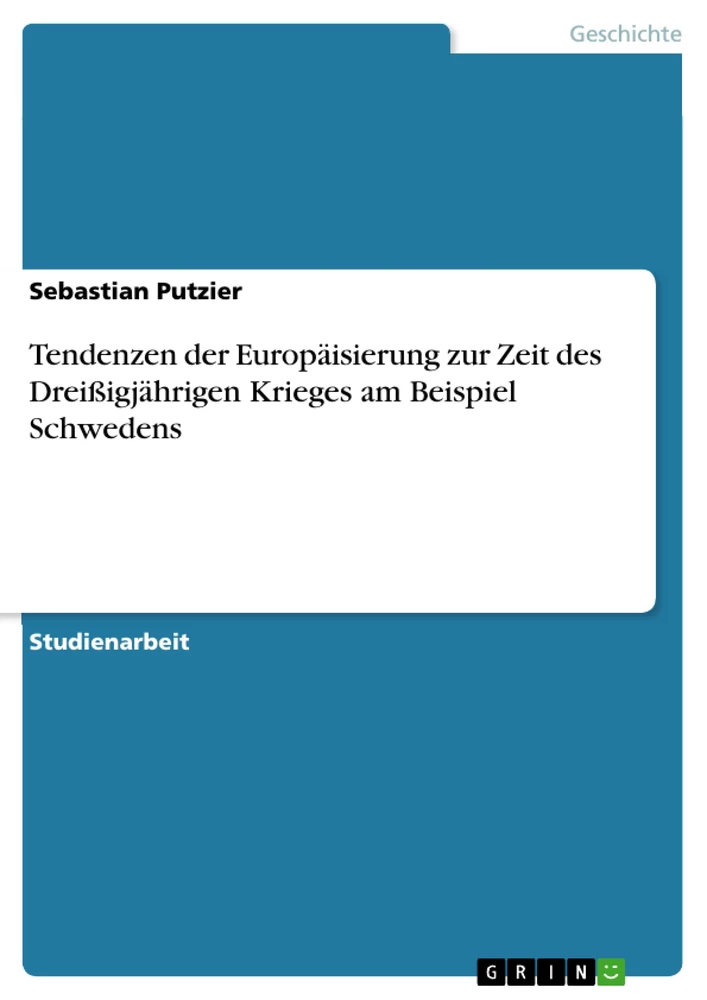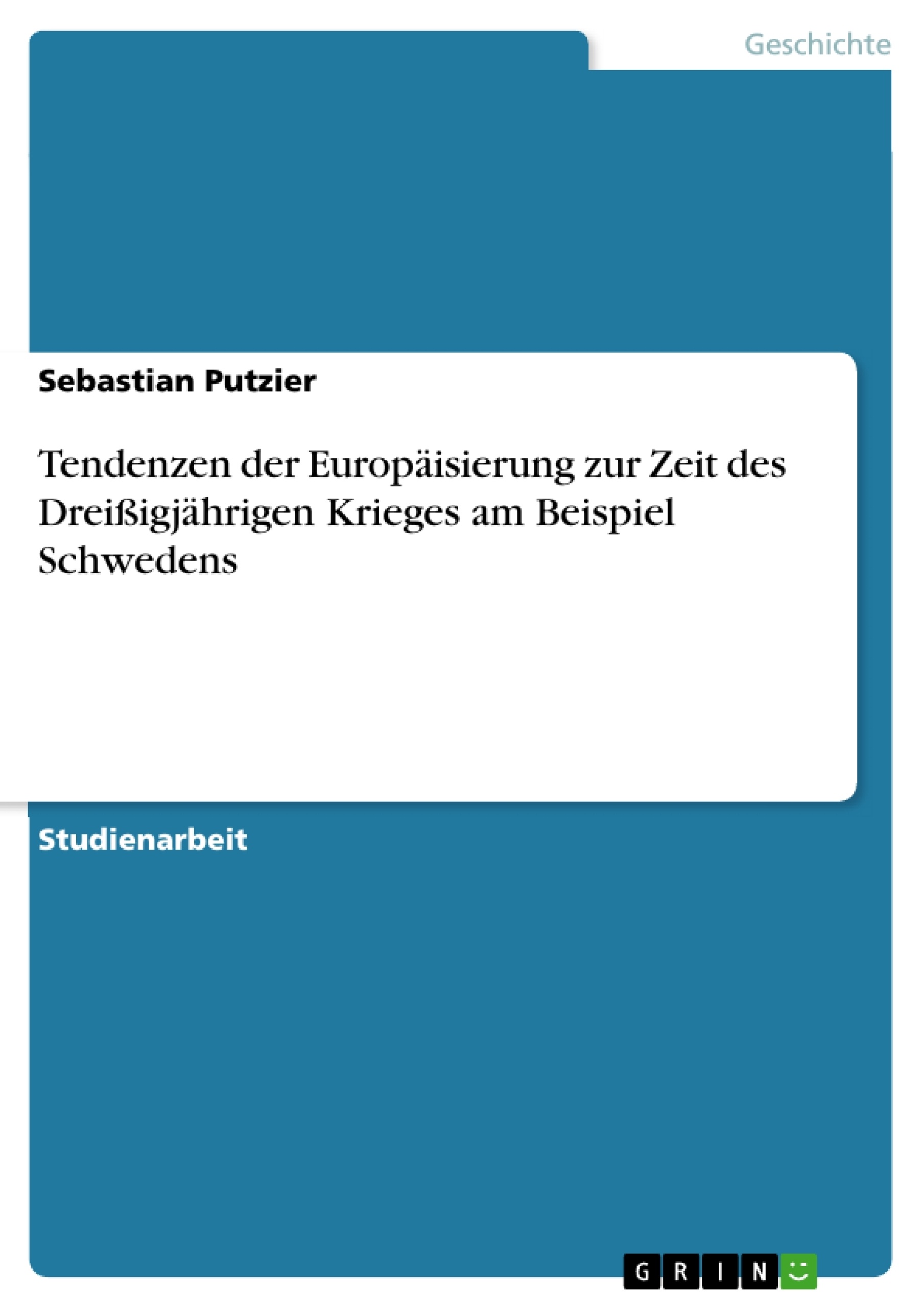Ort, Gemeinde, Bezirk, Landkreis, Region, Bundesland, Staat, Kontinent, die Welt – die Globalisierung verbindet das kleinste mit dem größten Glied. Mit dem Beitritt zur Europäischen Union (EU) beginnen viele Staaten damit, sich neben ihrer nationalen Identität auch eine europäische Identität zu schaffen. Für den Geschichtsstudenten ermöglichen sich an dieser Stelle verschiedene Blickrichtungen. Vor allem Lehramtsstudenten begegnen in Rahmenplänen und Schulbüchern diverse Unterrichtssequenzen, diee die deutsche Vergangenheit als Schwerpunkt erkennen lassen. Längst haben sich die Kultusminister in Deutschland aber auch in anderen Ländern, zum Beispiel in Dänemark, Schweden, den USA und Frankreich auf einen europäischen und weltumspannenden historischen Diskurs geeinigt. Das aktuelle Geschichtsbewusstsein ist bemüht, möglichst viele Aspekte aufzugreifen. Regionale, nationale, europäische und globale Geschichtsbetrachtung sind das erklärte Ziel der Forscher und Didaktiker. Das Verständnis und die Wahrnehmung von historischen Prozessen beginnt schließlich schon in der Schule und prägt den späteren geschichtlichen Denkprozess. Die historischen, politischen und sozialen Umbrüche einzelner Regionen und Länder hatten oft Auswirkungen auf benachbarte Staaten. Unlängst drängen sich hier Parallelen zur Völkerwanderung, der Französischen Revolution, der Reformation oder den beiden Weltkriegen auf. Viele Ereignisse sind deshalb nicht nur als regionale oder einzelstaatliche Phänomene zu betrachten. Dozenten weisen während des Studiums häufig auf die verschiedenen Blickwinkel hin, mit denen man als gewissenhaft und wissenschaftlich arbeitender „Forscher“ eine historische Tatsache betrachten und bewerten kann und muss. Genauso wie die Welt und die Gesellschaft sich wandeln, ändert sich auch der Anspruch an die Geschichtswissenschaft. Als angehender Geschichtslehrer sieht der Autor seine Aufgabe in der Verbindung regionaler Ereignisse mit nationaler und internationaler Geschichte. In Mecklenburg-Vorpommern ist die Verknüpfung von schwedischer und deutscher Geschichte so eng wie in kaum einem anderen Bundesland. Mit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges 1648 fielen die Norddeutschen Territorien, darunter Vorpommern und Rügen, an das schwedische Königreich. Während die meisten Gebiete bereits 1718 nach dem Tod des Schwedenkönigs Karl XII. zurückgegeben werden mussten, fiel Rügen erst 1815 in preußischen Besitz.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Europäisierung und globale Aspekte als pre-moderne Phänomene
- Begriffserklärungen
- Weltgeschichte
- Globalisierung und globales Lernen im Kontext europäisierter Geschichtsbetrachtungen
- Die Renaissance verändert das europäische Weltbild – Die Neuzeit
- Der schwedische Staat auf dem Weg zur Großmacht
- Der Gotizismus als Faktor der Legitimierung
- Der schwedische Gotizismus
- Der Weg in den Dreißigjährigen Krieg
- Der Prager Fenstersturz
- Der politische Glaubenskrieg in seinen unterschiedlichsten Facetten
- Der Niedersächsisch-Dänische Krieg (1625-1630)
- Schwedens politische Wende - Die Jahre 1628-1630
- Der Schwedische Krieg (1630-1634)
- Erste Blitzerfolge
- Grauen und Terror werden Zeichen des Krieges
- Die protestantische Union wuchs und erzielte Erfolge im Eilgang
- Der Rheinübergang der Protestanten
- Die Endphase des Krieges
- Der Westfälische Friede von 1648
- Die politischen Bestimmungen
- Territoriale Bestimmungen
- Konfessionelle Bestimmungen
- Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit setzt sich zum Ziel, die Rolle Schwedens im Dreißigjährigen Krieg zu untersuchen und dabei verschiedene Aspekte der europäischen Geschichte in den Fokus zu rücken. Die Arbeit beleuchtet die Entwicklung Schwedens zur Großmacht, die Bedeutung des schwedischen und deutschen Gotizismus, den Auslöser des Krieges - den Prager Fenstersturz - und Schwedens Gründe für den Kriegseintritt.
- Die Bedeutung von Europäisierung und globalen Aspekten in der Vormoderne
- Der Einfluss der Renaissance auf das europäische Weltbild
- Die Rolle des schwedischen Gotizismus als Legitimationsfaktor
- Der Dreißigjährige Krieg als politischer Glaubenskrieg
- Die Auswirkungen des Krieges auf die europäische Politik und Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert die Relevanz des Themas für die Geschichtswissenschaft. Sie hebt die Bedeutung von regionalen, nationalen und globalen Geschichtsperspektiven hervor.
Das erste Kapitel befasst sich mit dem Konzept der Europäisierung und globalen Aspekte als pre-moderne Phänomene. Es beleuchtet die Bedeutung des Informationsaustauschs und der politischen und wirtschaftlichen Interaktion in der Vormoderne.
Das dritte Kapitel analysiert die Entwicklung des schwedischen Staates auf dem Weg zur Großmacht.
Das vierte Kapitel widmet sich dem Gotizismus als Faktor der Legitimierung und untersucht den schwedischen Gotizismus im Speziellen.
Das fünfte Kapitel beleuchtet den Weg in den Dreißigjährigen Krieg und analysiert den Prager Fenstersturz als Auslöser des Krieges.
Das sechste Kapitel befasst sich mit dem politischen Glaubenskrieg und seinen unterschiedlichen Facetten, insbesondere dem Niedersächsisch-Dänischen Krieg (1625-1630), der schwedischen politischen Wende (1628-1630) und dem Schwedischen Krieg (1630-1634).
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit Schlüsselbegriffen wie Europäisierung, Globalisierung, Renaissance, Gotizismus, Dreißigjähriger Krieg, Schweden, Prager Fenstersturz, Glaubenskrieg, politische Wende und Westfälischer Friede. Die Arbeit fokussiert auf die historische Entwicklung des schwedischen Staates, die Rolle des schwedischen Gotizismus, die Ursachen und Folgen des Dreißigjährigen Krieges und die Bedeutung der Europäisierung und Globalisierung im historischen Kontext.
Häufig gestellte Fragen
Was wird in der Arbeit unter dem Begriff Europäisierung verstanden?
Europäisierung wird als ein historischer Prozess betrachtet, bei dem regionale Ereignisse mit nationaler und internationaler Geschichte verknüpft werden, um neben der nationalen Identität auch eine europäische Identität zu schaffen.
Welche Rolle spielte Schweden im Dreißigjährigen Krieg?
Schweden entwickelte sich während des Krieges zur Großmacht. Nach dem Westfälischen Frieden von 1648 erhielt das schwedische Königreich norddeutsche Territorien wie Vorpommern und Rügen.
Was ist der schwedische Gotizismus?
Der Gotizismus war eine kulturelle und politische Strömung in Schweden, die als Faktor der Legitimierung für den Aufstieg Schwedens zur Großmacht diente.
Wie lange blieb Rügen in schwedischem Besitz?
Während viele Gebiete bereits 1718 zurückgegeben werden mussten, blieb Rügen bis zum Jahr 1815 unter schwedischer Herrschaft, bevor es in preußischen Besitz überging.
Was war der Auslöser des Dreißigjährigen Krieges?
Als zentraler Auslöser für den Weg in den Krieg wird in der Arbeit der Prager Fenstersturz analysiert.
- Quote paper
- Sebastian Putzier (Author), 2007, Tendenzen der Europäisierung zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges am Beispiel Schwedens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84048