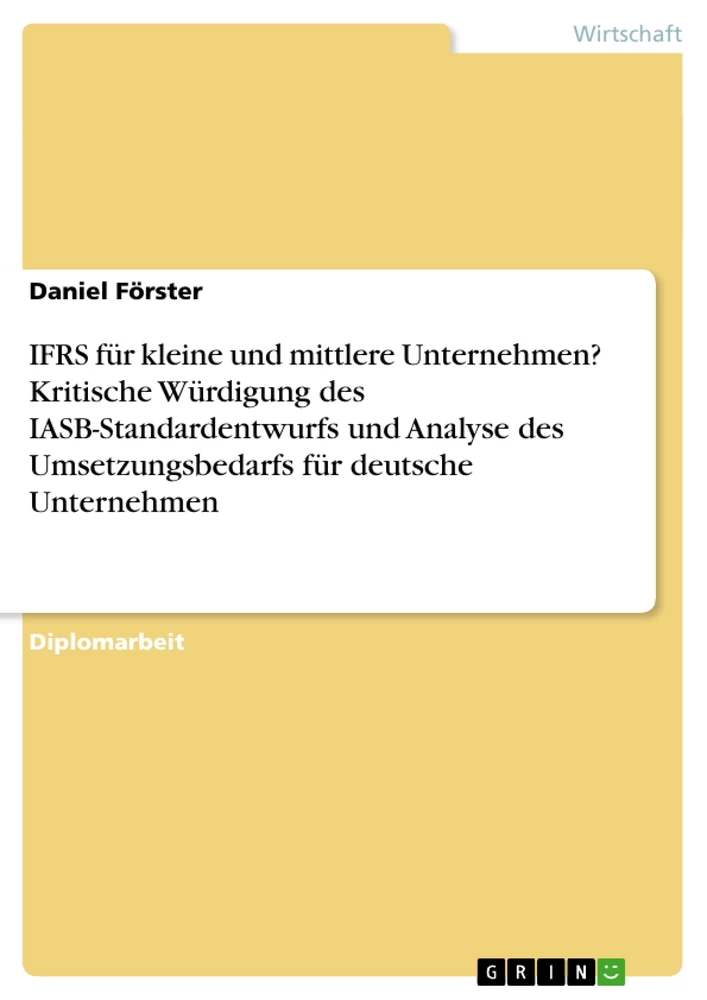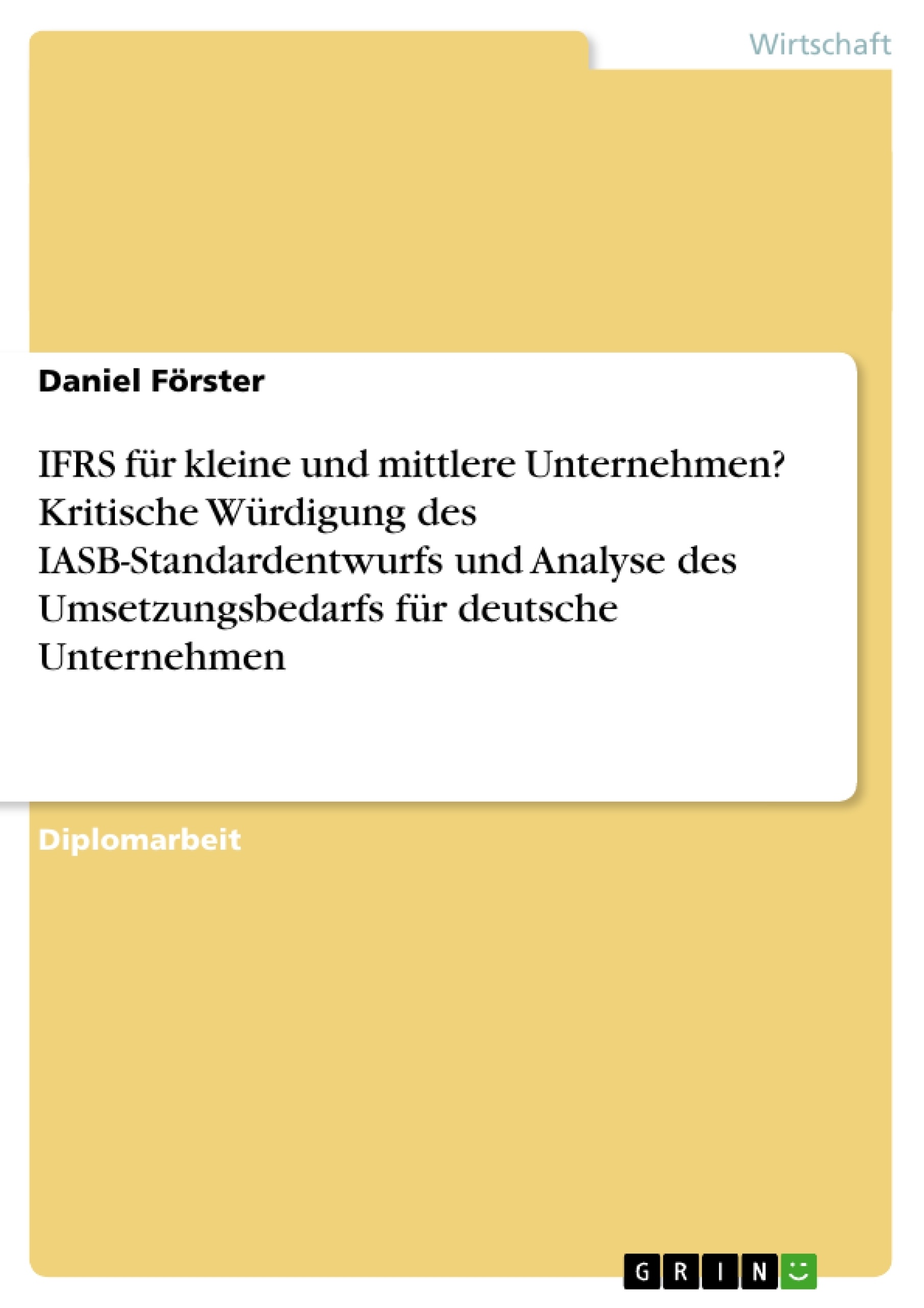Gegenstand der Arbeit ist die Untersuchung des IASB-Standardentwurfs zur Rechnungslegung für kleine und mittlere Unternehmen.
Die Arbeit gibt zunächst einen Überblick der relevanten qualitativen und quantitativen Unternehmenscharakteristika, die hinter dem Begriff KMU stehen. Ferner werden empirische Daten zur Rechtsform sowie Eigentümer- und Finanzierungsstruktur des Mittelstands ausgewertet.
Das anschließende Kapitel 3 geht aus regulierungstheoretischer Sicht der grundsätzlichen Frage nach, warum Rechnungslegung überhaupt bzw. in der hier diskutierten Form des Standardentwurfs notwendig ist und wie sich aus neoinstitutionalistischer Perspektive Effizienzgewinne durch eine öffentliche Rechnungslegungspflicht erzielen lassen. Hierzu werden Konzepte des Kapitalgeberschutzes vorgestellt sowie darauf aufbauend ein unter Informationsansprüchen der Kapitalgeber optimales Grundmodell für Jahresabschlüsse erarbeitet.
Kapitel 4 analysiert aufbauend auf den vorgenannten Überlegungen die grundsätzlichen Bilanzierungsprinzipien des IASB, die im hier untersuchten Standardentwurf zur Anwendung kommen und würdigt sie im Kontext der kapitelweise angeordneten Einzelfallregelungen zur Bilanzerstellung und Ergebnisermittlung.
Nach der konzeptionellen Prüfung des Standardentwurfs und Herausstellung seiner Unterschiede im Vergleich zum umfassender formulierten Hauptwerk in Gestalt der Full IFRS, wird für den weiteren Verlauf in Kapitel 5 dieser Arbeit das Szenario einer inhaltlichen Ablehnung der Entwurfsversion zugrunde gelegt. Der hierbei angenommene Prämissenrahmen dürfte in der Praxis dem Ansinnen deutscher Bilanzersteller innerhalb der KMU sehr nahe kommen, denn letztere sehen einer Umstellung der Rechnungslegungsvorschriften mehrheitlich eher kritisch entgegen.
Aus Platzgründen kann jedoch nicht zu jeder Regelung im Standardentwurf ein Individualvergleich mit der „gewohnten“ handelsrechtlichen Verbuchung angestellt werden.
Nach einem Zwischenfazit zum gegenwärtigen Status des KMU-Projekts, greift Kapitel 5.5 weitere Argumente auf, die vom IASB im Zusammenhang mit dem Wechsel der Rechnungslegungssysteme vielfach genannt werden und wägt deren Für und Wider aus Sicht der Praxis gegeneinander ab.
Die Arbeit schließt in Kapitel 6 mit einer kurzen Zusammenfassung der gewonnen Ergebnisse und gibt unter Berücksichtigung zunehmender Internationalisierungstendenzen einen Ausblick auf zukünftig zu erwartende Entwicklungen im Bereich der HGB-Bilanzierung in Deutschland.
Inhaltsverzeichnis
- INHALTSVERZEICHNIS
- ABBILDUNGSVERZEICHNIS
- ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
- 1 EINLEITUNG UND GANG DER UNTERSUCHUNG
- 2 GRUNDSÄTZLICHE ANMERKUNGEN ZU KLEINEN UND MITTLEREN UNTERNEHMEN IN DEUTSCHLAND
- 2.1 QUANTITATIVE UND QUALITATIVE MITTELSTANDSDEFINITIONEN
- 2.1.1 Abgrenzung durch das IASB
- 2.1.2 Abgrenzung auf Ebene der BRD
- 2.1.3 Abgrenzung auf Ebene der EU
- 2.1.4 Das Abgrenzungskriterium der Kapitalmarktorientierung
- 2.2 VORHERRSCHENDE RECHTSFORMEN UND EIGENTÜMERSTRUKTUREN IM DEUTSCHEN MITTELSTAND
- 2.3 FINANZIERUNGSSTRUKTUR DES DEUTSCHEN MITTELSTANDS
- 3 ZWECK UND KONZEPTIONEN DER RECHNUNGSLEGUNG
- 3.1 ZWECKBESTIMMUNG DEUTSCHER UND INTERNATIONALER RECHNUNGSLEGUNGSSYSTEME
- 3.1.1 Der Zweck der Rechnungslegung nach HGB
- 3.1.2 Der Zweck der Rechnungslegung nach IFRS
- 3.1.3 Der Zweck der Rechnungslegung im IFRS für KMU
- 3.2 RECHNUNGSLEGUNG AUS GRÜNDEN DER EFFIZIENZ
- 3.2.1 Entwicklung des Effizienzgedankens: Von der Neoklassik zur Neuen Institutionenökonomie
- 3.2.2 Das Effizienzkalkül im Kontext der Rechnungslegung
- 3.3 RECHNUNGSLEGUNG AUS GRÜNDEN DER GERECHTIGKEIT
- 3.4 ZUR ZWECKMÄßIGKEIT DER AUSGESTALTUNG VON RECHNUNGSLEGUNGSVORSCHRIFTEN
- 3.4.1 Informationsbedarf aus Kapitalgebersicht
- 3.4.2 Grundvoraussetzungen für Rechnungslegungsinformationen zur Nützlichkeit bei der Entscheidungsfindung
- 3.4.3 Informative Konzepte der Jahresabschlusserstellung
- 3.4.3.1 Das Konzept des informativen Bilanzpostens
- 3.4.3.2 Das Konzept der informativen Ergebnisgröße
- 3.4.3.2.1 Eignung als Performancemaßstab
- 3.4.3.2.2 Eignung als Prognosemaßstab
- 3.4.4 Sonstige Instrumente der Informationsvermittlung im Rahmen des Jahresabschlusses
- 3.5 ZWISCHENFAZIT
- 4 ANALYSE DES ENTWURFS EINES INTERNATIONALEN RECHNUNGSLEGUNGSSTANDARDS FÜR KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN
- 4.1 ANGESPROCHENER ADRESSATENKREIS
- 4.2 AUFBAU UND REGELUNGSINHALT
- 4.2.1 Allgemeines
- 4.2.2 Ansatz- und Bewertungsregeln
- 4.2.3 Vorschriften zur Ergebnisermittlung und zum Ergebnisausweis
- 4.2.4 Bilanzielle Gliederungsvorschriften
- 4.2.5 Ergebnisbezogene Regelungen
- 4.2.6 Anhangangaben
- 4.2.7 Weitere Berichtsformate
- 4.3 UNTERSCHIEDE ZU DEN FULL IFRS
- 4.4 ZWISCHENFAZIT
- 5 KRITISCHE WÜRDIGUNG
- 5.1 EIGENSTÄNDIGKEIT DES STANDARDENTWURFS
- 5.2 ZUR PROBLEMATIK DER WAHLRECHTE UND ERMESSENSSPIELRÄUME
- 5.3 ÄNDERUNGSBEDARF AUSGEWÄHLTER JAHRESABSCHLUSSPOSITIONEN
- 5.3.1 Finanzinstrumente
- 5.3.2 Goodwill
- 5.3.3 Leasing
- 5.3.4 Pensionen und weitere Rückstellungen
- 5.3.5 Immaterielle Vermögensgegenstände
- 5.3.6 Gewinnrealisierung bei Langfristfertigung
- 5.3.7 Anhangangaben
- 5.4 ZWISCHENFAZIT
- 5.5 UMSETZUNGSBEDARF DES IASB-STANDARDENTWURFS FÜR KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN IN DEUTSCHLAND
- 6 ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK
- LITERATURVERZEICHNIS
- RECHTSQUELLENVERZEICHNIS
- Die Arbeit beleuchtet verschiedene Ansätze zur Abgrenzung des Mittelstands und die daraus resultierenden Folgen für die Anwendung des Standardentwurfs.
- Sie analysiert die Zweckbestimmung von Rechnungslegungsvorschriften aus ökonomischer Perspektive und erarbeitet ein ideales Informationskonzept, das zur Beurteilung des Standardentwurfs dient.
- Die Arbeit beschreibt die wichtigsten Regelungen des Standardentwurfs und stellt die relevanten Unterschiede zu den Full IFRS dar.
- Sie befasst sich mit der kritischen Würdigung einzelner Bilanzierungspositionen des Standardentwurfs im Vergleich zum HGB und analysiert den möglichen Umsetzungsbedarf für deutsche Unternehmen.
- Abschließend werden die gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst und ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Bereich der handelsrechtlichen Bilanzierung in Deutschland gegeben.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die potenziellen Auswirkungen einer möglichen Einführung des vom IASB vorgelegten Standardentwurfs für KMU auf die Jahresabschlusserstellung deutscher Unternehmen. Hierbei steht die Frage im Vordergrund, inwieweit ein IFRS für KMU ergänzend oder gar alternativ zum bestehenden HGB-Rechnungslegungswerk angewendet werden kann, ohne dass es zu gravierenden bilanzpolitischen Einbußen oder einer Verschlechterung des Informationsgehalts des Jahresabschlusses kommt.
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 widmet sich der Problematik der Mittelstandsdefinition und stellt die unterschiedlichen Abgrenzungskonzepte auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene dar. Besonderes Augenmerk liegt auf der Bedeutung der Kapitalmarktorientierung für die Definition des Anwenderkreises des IFRS für KMU. Kapitel 3 erörtert die Zweckbestimmung von Rechnungslegung aus Sicht der Neuen Institutionenökonomie und definiert ein optimales Informationskonzept für Jahresabschlüsse aus Kapitalgebersicht.
Kapitel 4 analysiert den Aufbau und den Inhalt des Standardentwurfs des IASB für KMU und stellt die wichtigsten Regelungen sowie die Unterschiede zu den Full IFRS dar. Dabei werden sowohl die Vorschriften zur Bilanzierung von Vermögenswerten und Schulden als auch die Regeln zur Ergebnisermittlung und zum Ergebnisausweis behandelt. Darüber hinaus werden die Anforderungen an den Anhang sowie weitere Berichtsformate erläutert.
Kapitel 5 befasst sich mit der kritischen Würdigung des Standardentwurfs. Es werden sowohl allgemeine Mängel als auch die spezifischen Auswirkungen des Standardentwurfs auf ausgewählte Bilanzierungspositionen untersucht, um die Frage zu beantworten, ob ein Wechsel auf den IFRS für KMU für deutsche Unternehmen tendenziell begünstigend oder benachteiligend wäre.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der International Financial Reporting Standards (IFRS) für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), der deutschen Handelsbilanzierung (HGB), der Neuen Institutionenökonomie, Informationsasymmetrien, Agency Costs, Fair Value Accounting, Kapitalmarktorientierung, Mittelstand, Unternehmensfinanzierung, bilanzpolitische Gestaltungsspielräume.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des IFRS für KMU?
Das Ziel ist die Schaffung eines international vergleichbaren Rechnungslegungsstandards, der speziell auf die Bedürfnisse und Ressourcen kleiner und mittlerer Unternehmen zugeschnitten ist, indem er die komplexeren „Full IFRS“ vereinfacht.
Wie unterscheidet sich der IFRS für KMU vom deutschen HGB?
Während das HGB stark vom Vorsichtsprinzip und Gläubigerschutz geprägt ist, fokussiert sich der IFRS stärker auf die Informationsvermittlung für Kapitalgeber (Fair Value Accounting) und weicht bei Themen wie Goodwill oder Leasing ab.
Welche Kritikpunkte gibt es am IFRS-Standardentwurf für KMU?
Kritisiert werden unter anderem eingeschränkte Wahlrechte, der hohe Umstellungsaufwand für nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen und die Frage, ob der Informationsgehalt für deutsche Mittelständler wirklich verbessert wird.
Warum stehen deutsche KMU einer Umstellung oft kritisch gegenüber?
Viele Unternehmen befürchten bilanzpolitische Einbußen, höhere Kosten für die Bilanzerstellung und sehen keinen unmittelbaren Nutzen, da sie primär bankenfinanziert und nicht am internationalen Kapitalmarkt tätig sind.
Welche Rolle spielt die Kapitalmarktorientierung bei der Abgrenzung?
Das IASB nutzt die Kapitalmarktorientierung als zentrales Kriterium: Unternehmen, die öffentlich Rechenschaft ablegen müssen (z.B. durch Börsennotierung), sollen die Full IFRS nutzen, während andere den KMU-Standard verwenden dürfen.
- Arbeit zitieren
- Dipl.-Ök. Daniel Förster (Autor:in), 2007, IFRS für kleine und mittlere Unternehmen? Kritische Würdigung des IASB-Standardentwurfs und Analyse des Umsetzungsbedarfs für deutsche Unternehmen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84143