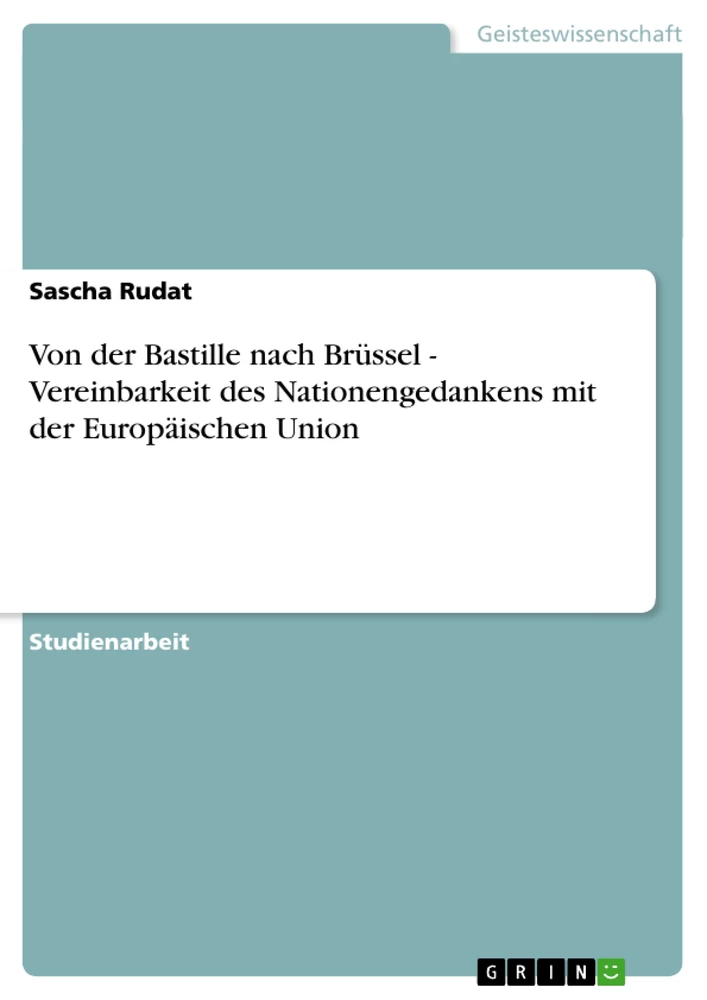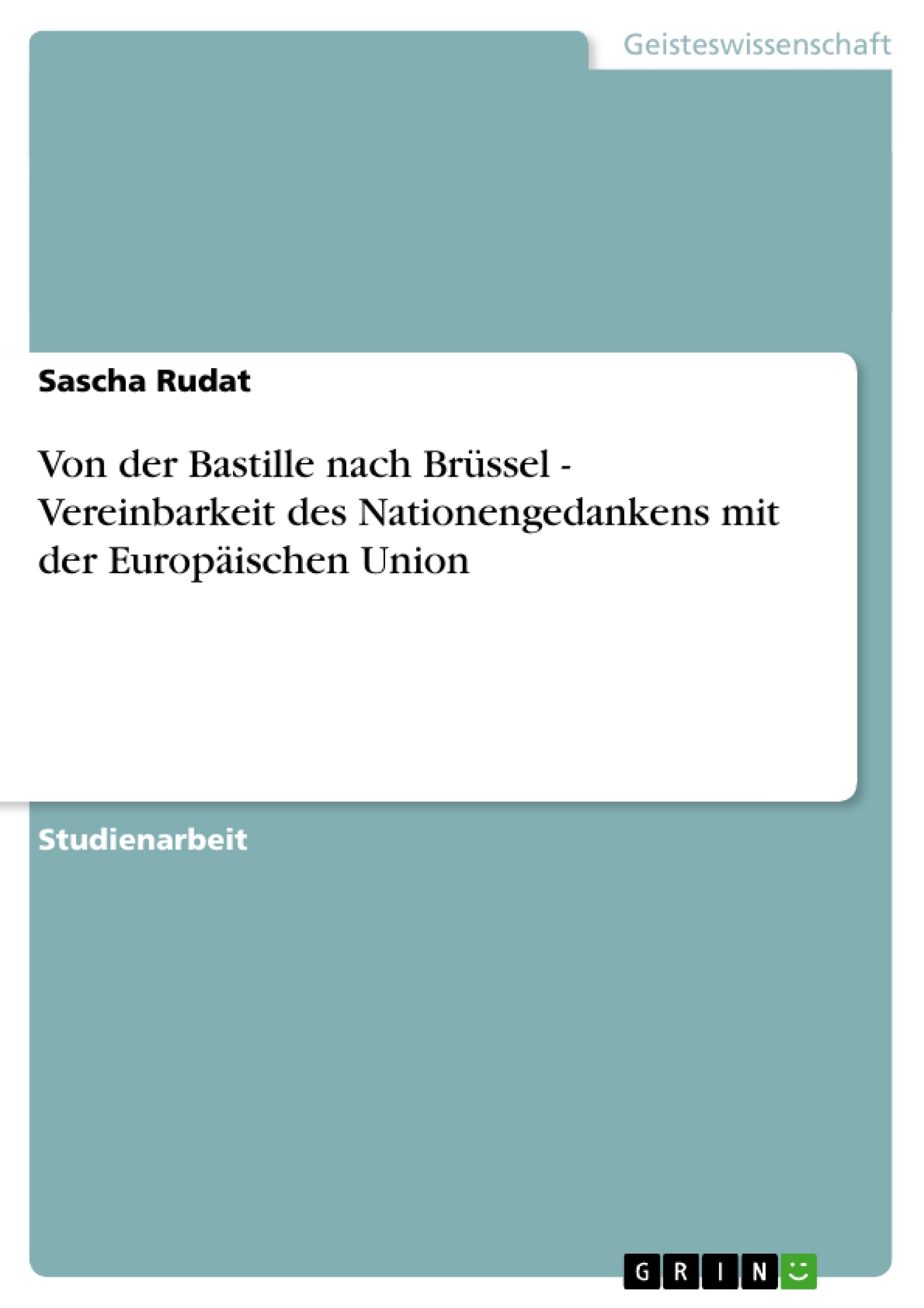Als die EU-Verfassung am 29. Mai 2005 in Frankreich und den Niederlanden abgelehnt wurde, war das ein Dämpfer und ein Schock für die gesamteuropäischen Bemühungen – und doch bezeichnend.
Diese Wahl zeigte eindeutig, dass die Menschen in Europas Nationalstaaten noch nicht so weit sind, sich unter die Führung einer transnationalen und globalen Regierung zu begeben.
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Prolog
- Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit: Geburt eines modernen politischen Systems
- 1789: Die Französische Revolution als Ursprung und Wegbereiter der europäischen Demokratie
- Einigkeit und Recht und Freiheit – Staatsentwicklung und Nationendefinition in Deutschland
- 1871: Die Geburt des Nationalstaates und die Pubertät der Nation
- 1945: Von der Unmöglichkeit einer Nationenteilung
- Die Europäische Union – Untergang oder Chance für Europa
- Die Stunde Null: Ursprung der EU
- Junge Staaten: Stolpersteine für die EU
- Die EU-Verfassung: Kalkulierbarkeit des Scheiterns
- Der Wohlfahrtsstaat: Langsamer Tod durch die Globalisierung
- Vereinigte Staaten von Europa: Strukturanpassung an die USA
- Europas nationalstaatliches Puzzle
- Muss sich Europa am Nationalstaat messen?
- Erfolgsaussichten eines geeinten Europas?
- Finale Kommentierung
- Literaturverzeichnis
- Quellen
- Interviews
- Sekundärliteratur
- Internetquellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit der Vereinbarkeit des Nationengedankens mit der Europäischen Union. Sie analysiert die Entstehung und Entwicklung von Nationalstaaten, insbesondere in Deutschland, und untersucht, ob die Existenz von Nationalstaaten die politische Festigung der EU verhindert. Dabei werden die geschichtlichen Wurzeln der europäischen Integration und die Herausforderungen der EU in Bezug auf die gesellschaftliche Ablösung der Nationalstaaten beleuchtet.
- Die Entstehung und Entwicklung des Nationalstaates, insbesondere in Deutschland
- Die Herausforderungen der EU in Bezug auf die gesellschaftliche Ablösung der Nationalstaaten
- Die Rolle des Nationengedankens im europäischen Integrationsprozess
- Die Folgen der Globalisierung für den Wohlfahrtsstaat und die europäische Integration
- Die Frage nach der politischen Festigung der EU und der Erfolgsaussichten eines geeinten Europas
Zusammenfassung der Kapitel
Der Prolog stellt den aktuellen Stand der europäischen Integration dar und verdeutlicht die Relevanz der Arbeit, die sich mit der Vereinbarkeit des Nationengedankens mit der EU auseinandersetzt.
Kapitel 3 beleuchtet die Französische Revolution als Geburtsstunde der modernen europäischen Demokratie. Es wird die Entwicklung des Nationengedankens und die Rolle der Menschenrechte im europäischen Kontext dargestellt.
Kapitel 4 analysiert die Staatsentwicklung und Nationendefinition in Deutschland, wobei die Geburt des Nationalstaates 1871 und die Zeit nach 1945 im Vordergrund stehen.
Kapitel 5 beschäftigt sich mit der Entstehung und Entwicklung der Europäischen Union. Es werden die Herausforderungen der EU, wie die Integration junger Staaten und die gescheiterte EU-Verfassung, sowie die Folgen der Globalisierung für den europäischen Wohlfahrtsstaat und die Strukturanpassung an die USA dargestellt.
Kapitel 6 erörtert die Frage, ob Europa sich am Nationalstaat messen muss und welche Erfolgsaussichten ein geeintes Europa hat.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Nationalstaat, Europäische Union, Globalisierung, Integration, Demokratie, Menschenrechte, Wohlfahrtsstaat, und gesellschaftliche Ablösung.
Häufig gestellte Fragen
Ist der Nationalstaat mit der EU vereinbar?
Die Arbeit untersucht dieses Spannungsverhältnis und stellt fest, dass die emotionale Bindung an Nationalstaaten oft ein Hindernis für eine tiefergehende politische Integration der EU darstellt.
Welchen Einfluss hatte die Französische Revolution?
Die Französische Revolution von 1789 gilt als Ursprung der modernen europäischen Demokratie und des modernen Nationengedankens.
Was bedeutete die Ablehnung der EU-Verfassung 2005?
Die Ablehnung in Frankreich und den Niederlanden war ein Schock, der zeigte, dass viele Bürger noch nicht bereit für eine transnationale Führung waren.
Wie beeinflusst die Globalisierung den Nationalstaat?
Die Globalisierung setzt den traditionellen Wohlfahrtsstaat unter Druck und zwingt Nationalstaaten zu strukturellen Anpassungen, oft nach US-amerikanischem Vorbild.
Was ist das 'nationale Puzzle' Europas?
Es beschreibt die Vielzahl unterschiedlicher Nationalstaaten mit eigenen Identitäten, die es schwierig machen, ein einheitliches politisches System für ganz Europa zu schaffen.
- Quote paper
- Sascha Rudat (Author), 2007, Von der Bastille nach Brüssel - Vereinbarkeit des Nationengedankens mit der Europäischen Union, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84153