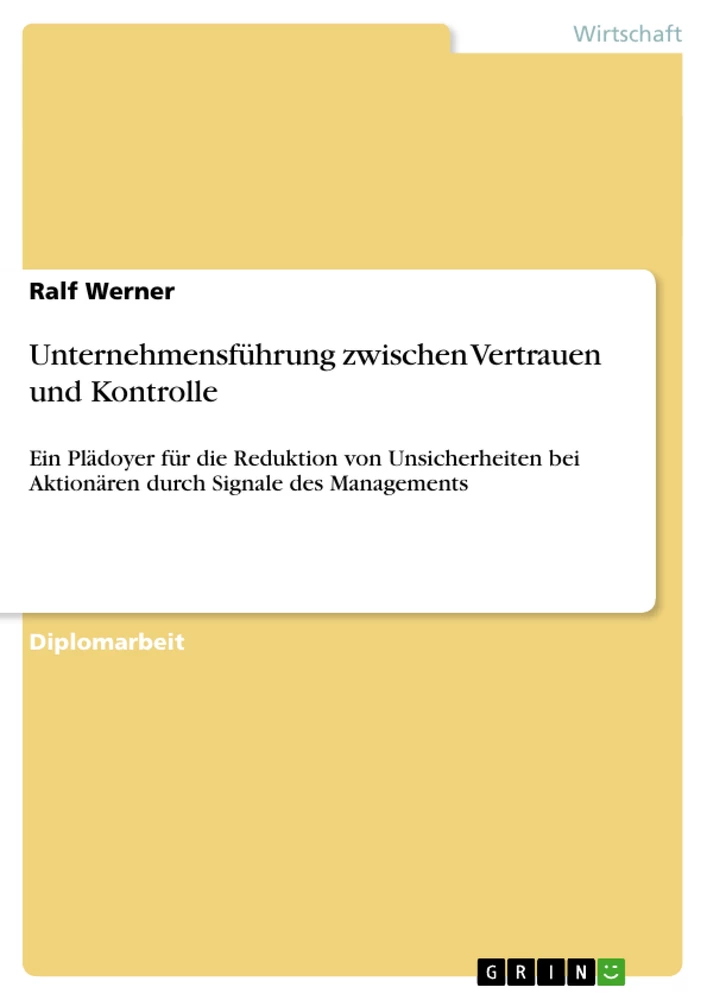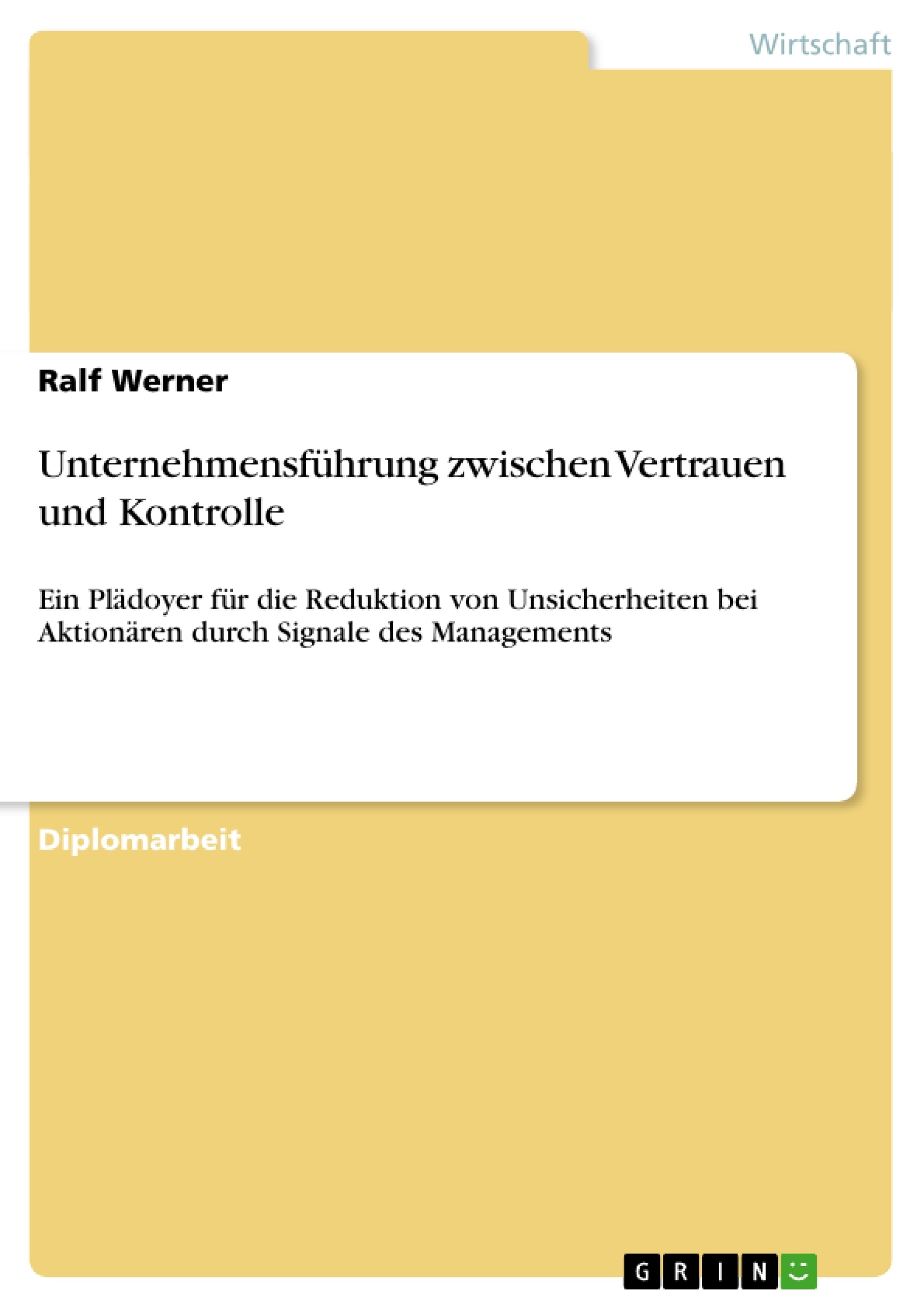Es war am 01. Februar diesen Jahres als die Deutsche Bank AG durch ihren Vorstandsvorsitzenden Dr. Josef Ackermann die Jahreszahlen aus 2006 auf einer Pressekonferenz verkündete. Bei den Ausführungen von Herrn Ackermann war es nicht verwunderlich, dass der Kommentator der Live-Übertragung der Meinung war: „Ehre, wem Ehre gebührt“.
Am darauf folgenden Tag kann man auch in der Süddeutschen Zeitung von dieser Pressekonferenz lesen. Die Stimmen sind hier nicht mehr ganz so positiv und überzeugt. Es gibt auch Kritik. So muss man lesen, dass die Deutsche Bank nicht mehr deutsch sei (vgl. Hesse, 2007, S. 19). Das Herz der einstigen Deutschland AG erzielt 75% seiner Gewinne im Ausland. Besonders in den wachstumsstarken Regionen China und Indien wächst die Deutsche Bank schnell. Außerdem stehen im erweiterten Führungsgremium der Deutschen Bank drei Deutsche acht Ausländern gegenüber. Und immer wieder schwingt auch der Mannesmann-Prozess mit. Saß nicht auch jener Mann, der im Februar diesen Jahres Rekordgewinne und Rekord-ausschüttungen für die Aktionäre erzielte, noch ein paar Monate zuvor auf der Anklagebank? So fasst die Frankfurter Allgemeine Zeitung zusammen, dass „(…) Josef Ackermann seit Anfang 2004 immer wieder die Anklagebank des Gerichtsaals drückte“ (Preuß, 2006, S. 15).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung
- 2 Kalkulatorisches Vertrauen
- 2.1 Coleman und Vertrauen als „Rational Choice“
- 2.1.1 Annahmen über den rationalen Akteur
- 2.1.2 Vertrauen als rationale Handlungsstrategie
- 2.1.3 „Gambling Choice“
- 2.1.4 Vertrauen als Grundlage der Investitionsentscheidung
- 2.2 Vertrauenskonzeption der Neuen Institutionenökonomik
- 2.2.1 Prinzipal-Agenten-Beziehung als Vertrauensbeziehung
- 2.2.2 Der Vertrag als Garant für Vertrauen
- 3 Agency-Theorie
- 3.1 Grundkonzepte der Agency-Theorie
- 3.1.1 Akteure und ihre spezifischen Eigenschaften
- 3.2 Hauptprobleme
- 3.2.1 Hidden Characteristics
- 3.2.2 Hidden Action
- 3.2.3 Hidden Information
- 3.2.4 Hidden Intention
- 3.3 Lösungsmöglichkeiten für Agencyprobleme
- 3.3.1 Reduktion von Informationsunterschieden
- 3.3.2 Auflösen von Zielkonflikten
- 3.3.3 Vertrauen zwischen Prinzipal und Agent
- 3.4 Anwendungsbereich der Theorie bei Trennung von Eigentum und Kontrolle in Unternehmen
- 4 Corporate Governance
- 4.1 Der Versuch einer Definition
- 4.2 Die Entwicklung der Corporate Governance
- 4.3 Unterscheidung der Corporate Governance Systeme nach formalen Unterschieden
- 4.3.1 Single Board Struktur
- 4.3.2 Duales System mit Vorstand und Aufsichtsrat
- 5 Gestaltung der Corporate Governance nach den Konzepten der Agency-Theorie unter Berücksichtigung des Faktors Vertrauen
- 5.1 Ziele und Interessen der beteiligten Akteure
- 5.1.1 Die Eigentümer
- 5.1.2 Die Manager
- 5.2 Implementierung eines Aufsichtsrats als Kontrollorgan
- 5.3 Nutzen des Aufsichtsrats
- 5.4 Opportunismus als Grundannahme
- 5.5 Bedeutung von Vertrauen
- 5.5.1 Reduktion von Vertrauen in agencytheoretisch geleiteten Corporate Governance Systemen
- 5.5.2 Vertrauen und Misstrauen als Ursache für Verhalten
- 6 Insiderhandel und dessen Signalwirkung
- 6.1 Rechtliche Grundlagen zu Insiderhandel
- 6.1.1 Problematik der Definition
- 6.1.2 Pflicht zur Offenlegung von Insiderkäufen
- 6.2 Insideraktivitäten und die damit verbundenen Signale
- 6.2.1 Insiderkäufe als Signal zur Reduktion von Unsicherheiten
- 6.2.2 Insidertransaktionen des Vorstandsvorsitzenden
- 6.3 Kritische Auseinandersetzung mit Insiderhandel
- 6.4 Ergebnisse einer Untersuchung zu Insidertransaktionen
- 7 Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit analysiert die Rolle von Vertrauen und Kontrolle im Kontext der Unternehmensführung. Ziel ist es, die Bedeutung von Vertrauen für die Investitionsentscheidung von Aktionären zu beleuchten und die Reduktion von Unsicherheiten durch Signale des Managements zu erforschen.
- Die Bedeutung von Vertrauen für Investitionsentscheidungen
- Die Rolle der Agency-Theorie und der Kontrollmechanismen
- Die Auswirkungen von Überbetonung der Kontrolle auf das Vertrauen
- Die Signalwirkung von Insidertransaktionen
- Die Möglichkeiten zur Reduktion von Unsicherheiten durch Signale des Managements
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 2: Dieses Kapitel stellt verschiedene Konzeptionen von Vertrauen vor und legt den Fokus auf Colemans Theorie des kalkulatorischen Vertrauens. Dabei wird Vertrauen als eine rationale Handlungsstrategie betrachtet, die Risikokalkulationen ermöglicht. Besondere Aufmerksamkeit wird der „Gambling Choice“-Theorie gewidmet, die verdeutlicht, wie Investoren rational Entscheidungen unter Risiko treffen können.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel befasst sich mit der Agency-Theorie, die die Herausforderungen und Konflikte zwischen Prinzipal (Eigentümer) und Agent (Management) innerhalb von Unternehmen beleuchtet. Es werden die Hauptprobleme, wie Informationsasymmetrie, Zielkonflikte und opportunistisches Verhalten, diskutiert. Darüber hinaus werden verschiedene Lösungsansätze zur Reduktion von Agenturproblemen vorgestellt, wie beispielsweise Screening, Signalling, Überwachung und Anreizverträge.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den Begriff Corporate Governance und seine Entwicklung in Deutschland und im internationalen Kontext. Es wird auf die Bedeutung von Transparenz und Kontrolle für die Unternehmensführung hingewiesen und die Unterschiede zwischen dem angloamerikanischen Single-Board-System und dem deutschen dualen System mit Vorstand und Aufsichtsrat beleuchtet.
- Kapitel 5: Dieses Kapitel analysiert die Gestaltung von Corporate Governance Systemen unter Berücksichtigung von Vertrauen und Kontrolle. Es wird die Rolle des Aufsichtsrats als Kontrollorgan diskutiert und die möglichen Auswirkungen von Überbetonung der Kontrolle auf das Vertrauen zwischen Eigentümern und Managern untersucht. Die Relevanz des Verhaltensmodells des Homo Oeconomicus und die potenziellen Gefahren des Opportunismus werden beleuchtet.
- Kapitel 6: Dieses Kapitel untersucht die Signalwirkung von Insidertransaktionen. Die rechtlichen Grundlagen zu Insiderhandel und die Pflicht zur Offenlegung von Insiderkäufen werden erläutert. Die unterschiedliche Aussagekraft von Insiderkäufen und -verkäufen und die Signalwirkung von Insidertransaktionen des Vorstandsvorsitzenden werden analysiert. Es werden empirische Untersuchungen zu diesem Thema und deren Ergebnisse vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: Vertrauen, Kontrolle, Agency-Theorie, Corporate Governance, Informationsasymmetrie, Opportunismus, Signale, Insiderhandel, Gewinnwahrscheinlichkeit, Investitionsentscheidung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt Vertrauen bei Investitionsentscheidungen?
Vertrauen dient als rationale Handlungsstrategie (nach Coleman), um Risiken kalkulierbar zu machen. Investoren nutzen Vertrauen als Grundlage, um trotz Unsicherheiten Kapital in Unternehmen einzubringen.
Was erklärt die Agency-Theorie im Kontext der Unternehmensführung?
Sie beleuchtet die Konflikte zwischen Eigentümern (Prinzipal) und Managern (Agent), die durch Informationsasymmetrien (Hidden Action, Hidden Information) und unterschiedliche Interessen entstehen können.
Wie wirkt sich Insiderhandel als Signal am Markt aus?
Insiderkäufe, insbesondere durch den Vorstandsvorsitzenden, wirken oft als positives Signal zur Reduktion von Unsicherheiten bei externen Investoren und deuten auf eine positive Zukunftserwartung hin.
Was ist der Unterschied zwischen Single-Board und dualem System?
Im angloamerikanischen Single-Board-System gibt es nur ein Führungsorgan, während das deutsche duale System strikt zwischen dem Vorstand (Leitung) und dem Aufsichtsrat (Kontrolle) trennt.
Kann zu viel Kontrolle das Vertrauen in einem Unternehmen schädigen?
Ja, die Arbeit untersucht, wie eine Überbetonung von Kontrollmechanismen in Corporate Governance Systemen das Vertrauensverhältnis zwischen Management und Eigentümern untergraben kann.
Was versteht man unter „kalkulatorischem Vertrauen“?
Nach James Coleman ist dies eine rationale Entscheidung, bei der ein Akteur die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns gegen das Verlustrisiko abwägt, bevor er Vertrauen schenkt (Gambling Choice).
- Quote paper
- Ralf Werner (Author), 2007, Unternehmensführung zwischen Vertrauen und Kontrolle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84187