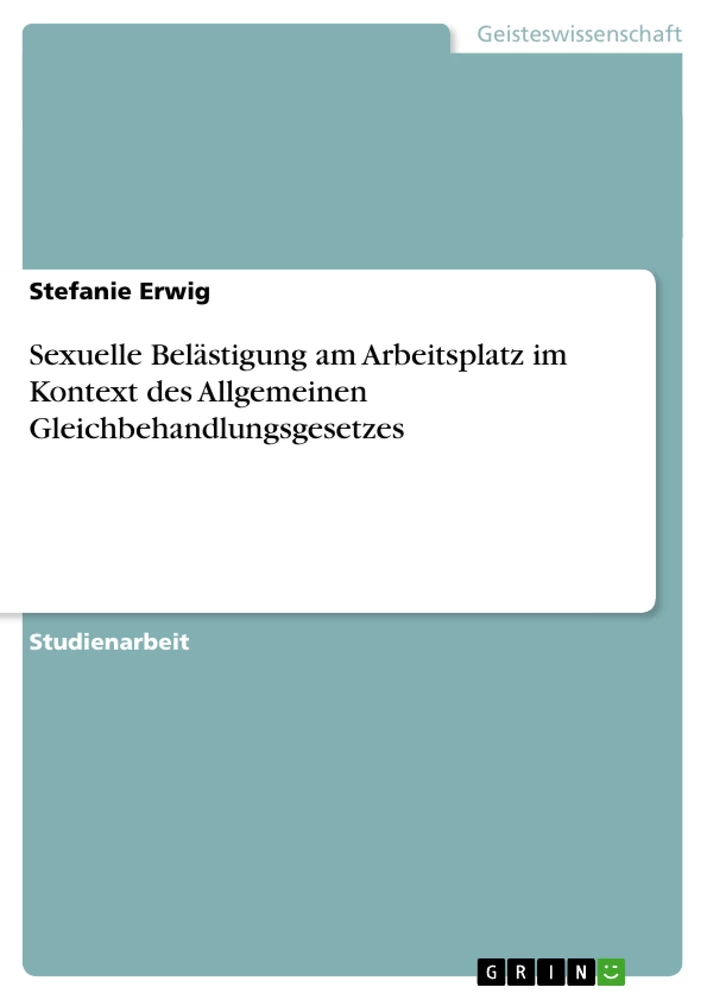Vorwort
Bei sexueller Belästigung geht es primär um eine sensible gefühlsbetonte Angelegenheit, die eine massive Herabwürdigung des Persönlichkeitsrechts darstellt. Frauen sind überdurchschnittlich von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz betroffen, wenn sie sich beruflich noch nicht etabliert haben und sich in einem Abhängigkeitsverhältnis wie zum Beispiel in einer Ausbildung oder Probezeit befinden. Die Diskussionen zum Thema „sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz“ handeln meist von den Definitionen und Grenzfällen. Des Weiteren wird darüber debattiert, dass sexuelle Belästigung eine Einzelerscheinung sei und von überempfindlichen Frauen als Mittel zum Zweck missbraucht würde, damit diese sich an Männern rächen könnten. Die Belästigungen werden bagatellisiert, umgedeutet, verleugnet und verniedlichst. Die Gefühle der Frauen werden als überempfindlich, humorlos oder als prüde herabgewürdigt. In der Wirklichkeit sieht es jedoch anders aus. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist überall da gegenwärtig, wo Frauen und Männer zusammenarbeiten und es kommt immer noch viel zu häufig vor. Das Problem der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz verschafft sich durch die erstmals 1990 durchgeführte Meinungsforschung des Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit, mit dem erschreckenden Resultat, dass 72% aller berufstätigen Frauen eine Konfrontation mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz haben oder hatten, eine hohe Brisanz. Es wird eine Materie behandelt, die von Verlegenheit, Unsicherheit, Angst und Scham und folglich auch von Verdrängungen geprägt ist. Viele der betroffenen Frauen meinen, sie müssten damit alleine zu Recht kommen. Im Gegenzug ist häufig Hilflosigkeit und Abwehr eine Reaktion der Personalverantwortlichen auf das Thema.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 0. Einleitung
- 1. Begriffsklärung und Grundlagen
- 1.1. Was ist Belästigung?
- 1.2. Was ist sexuelle Belästigung?
- 1.3. Wie häufig sind sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz?
- 1.4. Personenkonstellation in Belästigungssituationen
- 1.4.1. Wer sind die Belästiger?
- 1.4.2. Wer wird belästigt?
- 1.5. Welche Ursachen haben sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz?
- 1.6. Was sind die Folgen sexueller Belästigungen?
- 1.7. Präventive Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz
- 2. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz
- 2.1. Historischer Exkurs zur Entstehung des AGG´s in Bezug auf sexuelle Belästigung
- 2.2. Was ist das AGG und wen schützt es?
- 2.3. Die Formen der Benachteiligung des AGG´s
- 2.4. Die Beweislast
- 3. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz im Kontext des AGG´s
- 3.1. Fiktive Fallbeispiele zur sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz
- 3.2. Definition von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz laut AGG
- 3.3. Welche Rechte hat ein Mitarbeit und welche Rechtsfolgen treten in Kraft bei Verstoß gegen § 3 Absatz 4 AGG?
- 3.4. Welche Rechte und Pflichten hat ein Arbeitgeber nach dem AGG?
- 3.5. Aktuelle kritische Erfahrungen mit dem AGG
- 3.6. Politiken/Ausführungen/Reglungen zur sexuellen Belästigung im internationalen Vergleich
- 4. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Problematik der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz im Kontext des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). Sie analysiert die Ursachen und Folgen dieses Phänomens sowie die historische Entwicklung und aktuelle juristische Vorgehensweisen im Umgang damit. Der Fokus liegt dabei auf der Beleuchtung des Themas als Hilfestellung für die Soziale Arbeit.
- Definition und Formen der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz
- Häufigkeit und Auswirkungen sexueller Belästigung
- Die Entstehung und Funktionsweise des AGG
- Rechtliche Möglichkeiten und Sanktionen im Umgang mit sexueller Belästigung
- Kritische Analyse der Umsetzung des AGG in der Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorwort: Das Vorwort beleuchtet die sensible Thematik der sexuellen Belästigung als massive Verletzung des Persönlichkeitsrechts, insbesondere von Frauen, die sich in einem Abhängigkeitsverhältnis befinden. Es unterstreicht die Brisanz des Themas und kritisiert die häufigen Bagatellisierungen und Verdrängungen.
- 0. Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Hausarbeit und die Forschungsfragen vor, die sich mit der Definition und Einordnung der sexuellen Belästigung sowie den rechtlichen Möglichkeiten im Kontext des AGG befassen.
- 1. Begriffsklärung und Grundlagen: Dieses Kapitel definiert die Begriffe Belästigung und sexuelle Belästigung und gliedert sie in verschiedene Kategorien: verbale, nonverbale, physische und sexuelle Erpressung. Es werden Statistiken zur Häufigkeit von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz vorgestellt, die ein erschreckendes Ausmaß aufzeigen.
- 1.4. Personenkonstellation in Belästigungssituationen: Der Fokus liegt hier auf den Personen, die an Belästigungssituationen beteiligt sind. Es werden Stereotypen über Belästiger widerlegt und statistische Erkenntnisse über die Altersgruppen, die berufliche Position und das soziale Umfeld der Täter und Opfer vorgestellt.
- 1.5. Welche Ursachen haben sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz?: Dieses Kapitel analysiert die Ursachen von sexueller Belästigung als Ausdruck von Machtmissbrauch und Minderbewertung von Frauen in der Gesellschaft. Es wird auf die gesellschaftlichen und strukturellen Hintergründe hingewiesen und die Rolle von Geschlechterungleichheit im Arbeitsleben betont.
- 1.6. Was sind die Folgen sexueller Belästigung?: Dieser Abschnitt beschreibt die psychischen und physischen Folgen von sexueller Belästigung für die Opfer. Es werden Reaktionen wie Wut, Scham und Verunsicherung sowie die negativen Auswirkungen auf das Selbstbild und die berufliche Entwicklung der Betroffenen dargestellt.
- 1.7. Präventive Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: Hier werden verschiedene präventive Maßnahmen vorgestellt, die zum Schutz vor sexueller Belästigung beitragen können. Dazu zählen Fortbildungen, Selbstbehauptungskurse, öffentliche Diskussionen und die Einholung von Informationen und Unterstützung durch Experten.
- 2. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz: Dieses Kapitel zeichnet die historische Entwicklung des AGG nach, beginnend mit frühen Bestrebungen zur Gleichstellung von Frauen und Männern. Es wird die Bedeutung des Beschäftigtenschutzgesetzes als Vorläufer des AGG hervorgehoben und die Entstehung des AGG im Kontext der europäischen Richtlinien dargestellt.
- 2.2. Was ist das AGG und wen schützt es?: Der Abschnitt erläutert den Zweck des AGG, das Benachteiligungen aufgrund verschiedener Diskriminierungsmerkmale wie Geschlecht, Herkunft oder Behinderung verhindern soll. Es werden die Personenkreise benannt, die durch das AGG geschützt werden.
- 2.3. Die Formen der Benachteiligung des AGG´s: Hier werden die verschiedenen Formen von Benachteiligungen im Kontext des AGG dargestellt, darunter unmittelbare und mittelbare Benachteiligung sowie Belästigung und Anweisung zur Benachteiligung.
- 2.4. Die Beweislast: Dieser Abschnitt erklärt die Beweislastverteilung im Falle von Diskriminierung und Belästigung. Während bei den meisten Diskriminierungsmerkmalen eine Beweislastumkehr stattfindet, liegt die Beweislast bei Belästigung und sexueller Belästigung beim Opfer.
- 3. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz im Kontext des AGG´s: Dieses Kapitel veranschaulicht die Thematik der sexuellen Belästigung anhand von fiktiven Fallbeispielen, die unterschiedliche Arten von Belästigung darstellen.
- 3.2. Definition von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz laut AGG: Hier wird die rechtliche Definition von sexueller Belästigung aus § 3 Absatz 4 AGG erläutert.
- 3.3. Welche Rechte hat ein Mitarbeiter und welche Rechtsfolgen treten in Kraft bei Verstoß gegen § 3 Absatz 4 AGG?: Dieser Abschnitt stellt die Rechte von Beschäftigten dar, die von sexueller Belästigung betroffen sind. Dazu zählen das Beschwerderecht, das Leistungsverweigerungsrecht und das Recht auf Schadensersatz und Entschädigung.
- 3.4. Welche Rechte und Pflichten hat ein Arbeitgeber nach dem AGG?: Hier werden die Pflichten von Arbeitgebern im Kontext des AGG beleuchtet, darunter die Verpflichtung, Diskriminierungsverbote einzuhalten und präventive Maßnahmen zu treffen.
- 3.5. Aktuelle kritische Erfahrungen mit dem AGG: Dieser Abschnitt beleuchtet kritische Diskussionen um das AGG und stellt gegensätzliche Statistiken zur Häufigkeit von sexueller Belästigung in Deutschland dar. Es werden sowohl positive als auch negative Aspekte der Gesetzesumsetzung in der Praxis beleuchtet.
- 3.6. Ausführungen zur sexuellen Belästigung im internationalen Vergleich: Hier wird die Gesetzgebung in den USA als Vorbild für die Entwicklung von rechtlichen Maßnahmen gegen sexuelle Belästigung in der Europäischen Union dargestellt. Es wird der Einfluss amerikanischer Rechtsprechung sowie die spezifische deutsche Geschlechterkultur im Kontext von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz beleuchtet.
- 4. Resümee: Das Resümee fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Hausarbeit zusammen. Es wird betont, dass sexuelle Belästigung ein tiefgreifendes Problem ist, das bereits seit Beginn der Erwerbstätigkeit von Frauen existiert. Die Notwendigkeit von weiteren Gesetzgebungsverschärfungen sowie aktives Engagement der Gesellschaft, um sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz einzudämmen, wird unterstrichen.
Schlüsselwörter
Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Diskriminierung, Gleichstellung, Machtmissbrauch, Geschlechterungleichheit, Prävention, Rechtsschutz, Beschwerdestelle, Beweislast, internationale Vergleiche, gesellschaftliche Tabus, Geschlechterkultur.
Häufig gestellte Fragen
Was definiert das AGG als sexuelle Belästigung?
Nach § 3 Abs. 4 AGG ist sexuelle Belästigung ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten, das die Würde der betroffenen Person verletzt, insbesondere durch Einschüchterung oder Erniedrigung.
Welche Rechte haben Mitarbeiter bei Belästigung am Arbeitsplatz?
Betroffene haben ein Beschwerderecht, ein Leistungsverweigerungsrecht bei unzureichenden Schutzmaßnahmen des Arbeitgebers sowie Anspruch auf Schadensersatz.
Welche Pflichten hat der Arbeitgeber nach dem AGG?
Arbeitgeber müssen präventive Maßnahmen treffen, Beschwerdestellen einrichten und bei Bekanntwerden von Belästigungen disziplinarische Maßnahmen gegen die Täter ergreifen.
Wer ist am häufigsten von sexueller Belästigung betroffen?
Statistiken zeigen, dass überproportional Frauen betroffen sind, insbesondere in Abhängigkeitsverhältnissen wie Ausbildung oder Probezeit.
Wie ist die Beweislast bei sexueller Belästigung geregelt?
Im Gegensatz zu anderen Diskriminierungsmerkmalen im AGG liegt die Beweislast bei Belästigung und sexueller Belästigung in der Regel beim Opfer.
- Arbeit zitieren
- Stefanie Erwig (Autor:in), 2007, Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz im Kontext des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84209