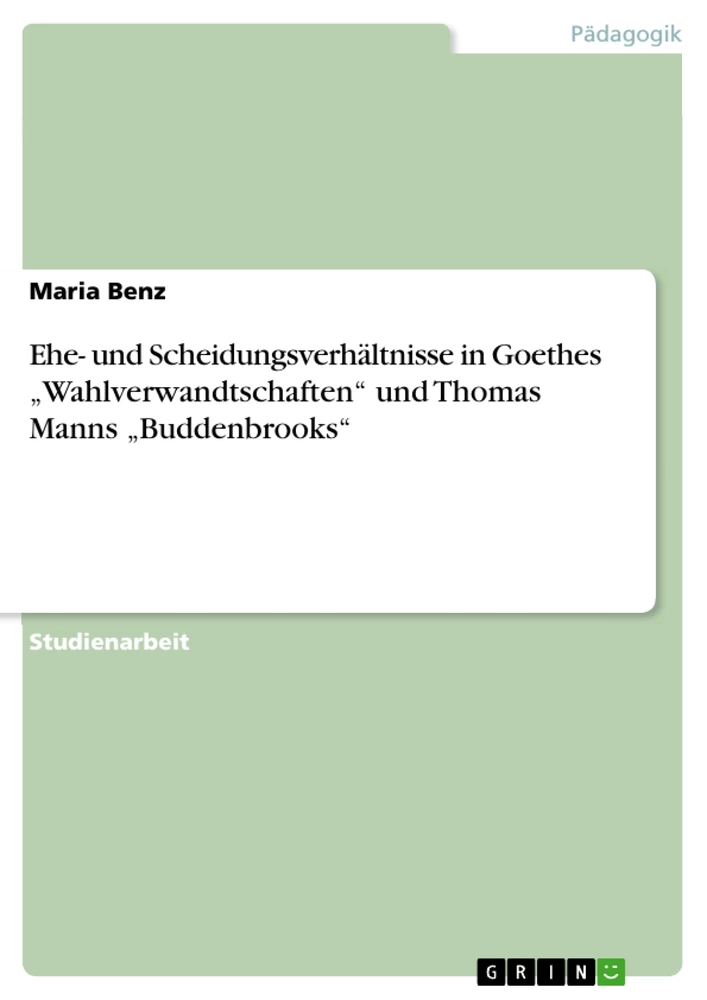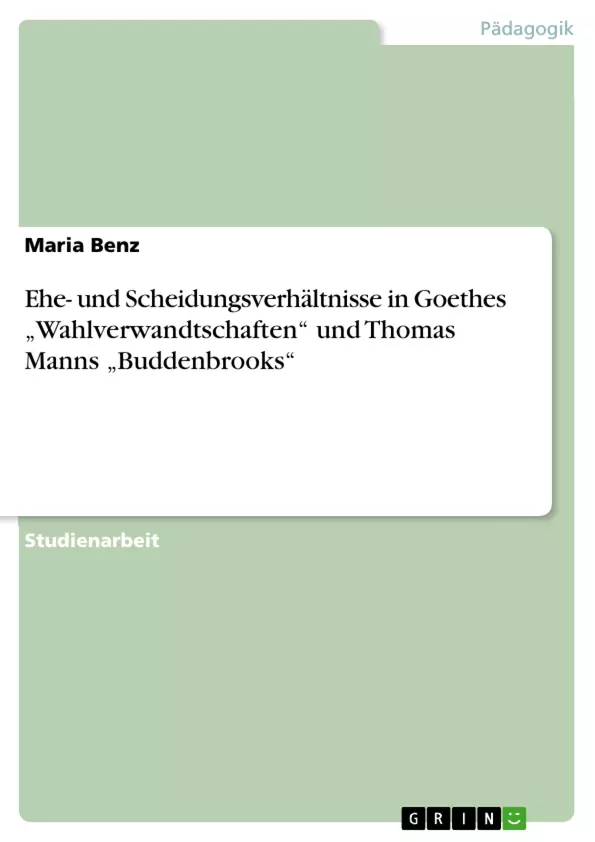Die scharfe Trennung zwischen Literatur und Geschichtsschreibung wirkt bis in die heutige Zeit hinein, auch wenn es in der Vergangenheit bereits Versuche einer Annäherung gegeben hat. Ein Beispiel dafür ist Georg Büchner, der die Grenze zwischen Literatur und Geschichtsschreibung verwischt, indem er den dramatischen Dichter selbst als „Geschichtsschreiber“ bezeichnet. Er sieht den Autor also nicht als bloßen Geschichtenschreiber, wie es im traditionellen Literaturverständnis üblich war, sondern stellt ihn sogar noch über diesen, indem er ihm die Eigenschaft zuspricht, realgeschichtliche Inhalte in eine unterhaltsame Form zu bringen und somit Geschichte neu zu erschaffen. Der Autor ist somit nicht mehr nur ein Verfasser fiktiver Texte, sondern dokumentiert auch realgeschichtliche Ereignisse.
Vor diesem Hintergrund wird in der folgenden Arbeit versucht, aus Goethes „Wahlverwandtschaften“ und Thomas Manns „Buddenbrooks“ Erkenntnisse über die Scheidungsproblematik in den jeweiligen Epochen zu gewinnen. Es mag unnötig erscheinen, sich angesichts stets wandelnder wissenschaftlicher Erkenntnisse mit so alten und darüber hinaus literarischen Texten zu befassen, denn schließlich ist Scheidung ein Thema, das vor allem in das 20. und 21. Jahrhundert zu gehören scheint und auch erst seit dieser Zeit wissenschaftlich erforscht wird. Ich vertrete jedoch die These, dass beide Texte nicht nur in ihrer Zeit fortschrittlich waren, sondern uns auch für die heutige Zeit noch interessante Erkenntnisse liefern können, die vielleicht sogar über das hinausgehen, was aus der Geschichtsschreibung bekannt ist. Um besser beurteilen zu können, was in den Romanen den allgemeinen Erkenntnissen entspricht und wo die Autoren ihre subjektiven Eindrücke verarbeitet haben, werden nicht nur die Verhältnisse in den Romanen, sondern auch die rechtlichen und gesellschaftlichen Hintergründe in den jeweiligen Epochen skizziert.
Inhaltsverzeichnis
- Zwischen Fiktion und Realität: Literatur als Zeitzeugnis?
- Ehe im Wandel: Die Situation zum Ende des 18. Jahrhunderts
- Ehe und Scheidung in den „Wahlverwandtschaften“
- Eduard und Ottilie
- Charlotte und der Hauptmann
- Mittler
- Graf und Baronesse
- Bewertung
- Ehe in der bürgerlichen Familie
- Der Verfall der bürgerlichen Familie in den „Buddenbrooks“
- Liebesheirat vs. Materielle Absicherung: Antonie wird zu Frau Grünlich
- Antonie und Permaneder
- Antonies „dritte Ehe“
- Zur Situation der Scheidungskinder in den Romanen
- Biographische Hintergründe
- Goethe und die Utopie der romantischen Liebe
- Thomas Mann und seine Familie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Thematik von Ehe und Scheidung in den Romanen „Wahlverwandtschaften“ von Johann Wolfgang von Goethe und „Buddenbrooks“ von Thomas Mann. Sie analysiert die verschiedenen Eheformen und Scheidungskonstellationen in den beiden Werken und setzt sie in den Kontext der jeweiligen Zeit und gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Arbeit beleuchtet, wie die literarischen Figuren in den Romanen mit den Herausforderungen von Liebe, Ehe und Scheidung umgehen und wie diese Themen in den historischen und biographischen Kontext der jeweiligen Epoche eingebettet sind.
- Traditionsgebundene Ehe vs. romantische Liebesheirat
- Materielle Interessen und soziale Normen in der Partnerwahl
- Die Rolle der Frau und die Folgen einer Scheidung
- Die Auswirkungen von Scheidungen auf Kinder
- Autobiographische Bezüge in den Romanen
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit widmet sich der Frage, ob und inwiefern Literatur als Zeitzeugnis dienen kann und beleuchtet die Situation von Ehe und Scheidung im späten 18. Jahrhundert. In Kapitel 3 werden verschiedene Formen von Ehe und Scheidung in Goethes „Wahlverwandtschaften“ analysiert. Die Figuren des Romans werden in ihrer Ambivalenz bezüglich der Ehe dargestellt und es wird untersucht, ob sich die Meinung des Autors zum Thema Ehe und Scheidung in den Figuren spiegeln lässt. Der vierte Abschnitt der Arbeit skizziert die Situation der bürgerlichen Ehe im 19. Jahrhundert. Kapitel 5 beschäftigt sich mit dem Verfall der bürgerlichen Familie in den „Buddenbrooks“. Hier wird anhand der Figuren Antonie und Thomas Buddenbrook gezeigt, wie die traditionellen Vorstellungen von Ehe und Familie mit den neuen Bedürfnissen und Lebensentwürfen der Figuren kollidieren. Kapitel 6 widmet sich den Scheidungskindern und ihre Rolle im Geschehen der Romane. Abschließend beleuchtet der siebte Teil der Arbeit die biographischen Hintergründe von Goethe und Thomas Mann, die im Kontext der jeweiligen Epoche und der romantischen Liebe sowie des Wandels der bürgerlichen Gesellschaft stehen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Ehe, Scheidung, Liebe, Familie, Gesellschaft, Literatur als Zeitzeugnis, Romananalyse, Goethes „Wahlverwandtschaften“, Thomas Manns „Buddenbrooks“, 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, romantische Liebe, bürgerliche Ehe, Scheidungskinder.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird das Thema Scheidung in Goethes „Wahlverwandtschaften“ behandelt?
Goethe thematisiert die Ambivalenz zwischen der Unauflöslichkeit der Ehe und der Macht der leidenschaftlichen, „wahlverwandten“ Liebe.
Was zeigt Thomas Manns „Buddenbrooks“ über die bürgerliche Ehe?
Der Roman illustriert den Konflikt zwischen Liebesheirat und materieller Absicherung sowie den Verfall der bürgerlichen Familie durch gescheiterte Ehen (z.B. Antonie Buddenbrook).
Kann Literatur als historisches Zeitzeugnis dienen?
Ja, die Arbeit vertritt die These, dass literarische Texte oft tiefere Einblicke in gesellschaftliche Probleme wie die Scheidungsproblematik geben als rein faktische Geschichtsschreibung.
Wie war die rechtliche Situation der Scheidung im 18. Jahrhundert?
Die Scheidung war rechtlich schwierig und gesellschaftlich stigmatisiert, was in Goethes Werk durch die Figur des „Mittlers“ repräsentiert wird.
Welche Rolle spielen Scheidungskinder in diesen Romanen?
Die Arbeit analysiert die oft tragische Situation der Kinder, die zwischen den familiären Erwartungen und dem Zerfall der elterlichen Ehe stehen.
- Quote paper
- Maria Benz (Author), 2006, Ehe- und Scheidungsverhältnisse in Goethes „Wahlverwandtschaften“ und Thomas Manns „Buddenbrooks“, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84217