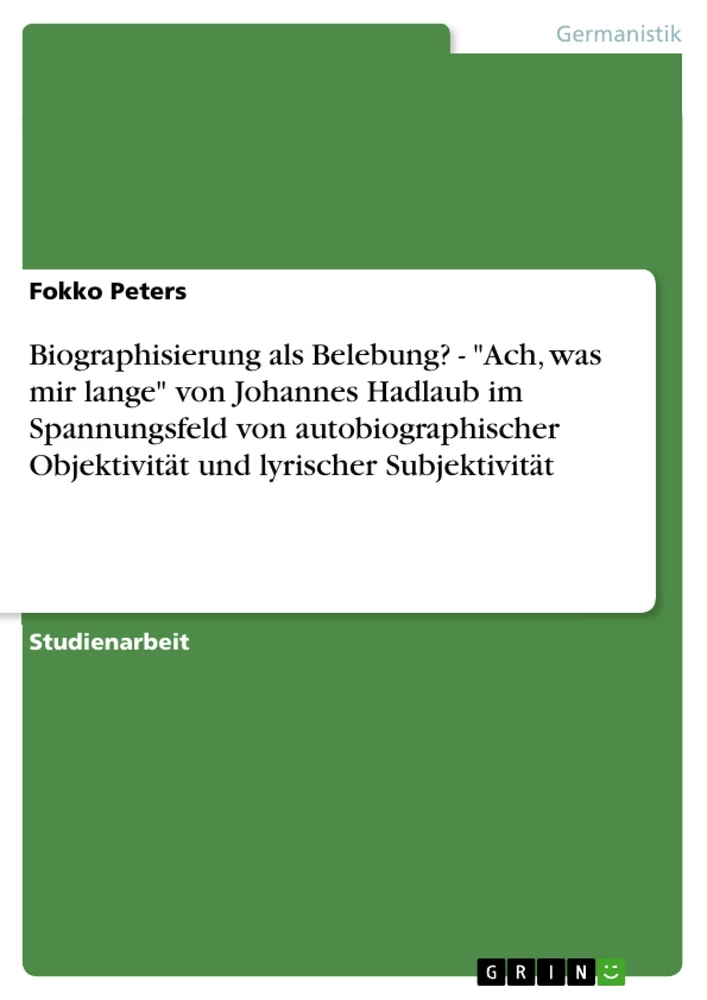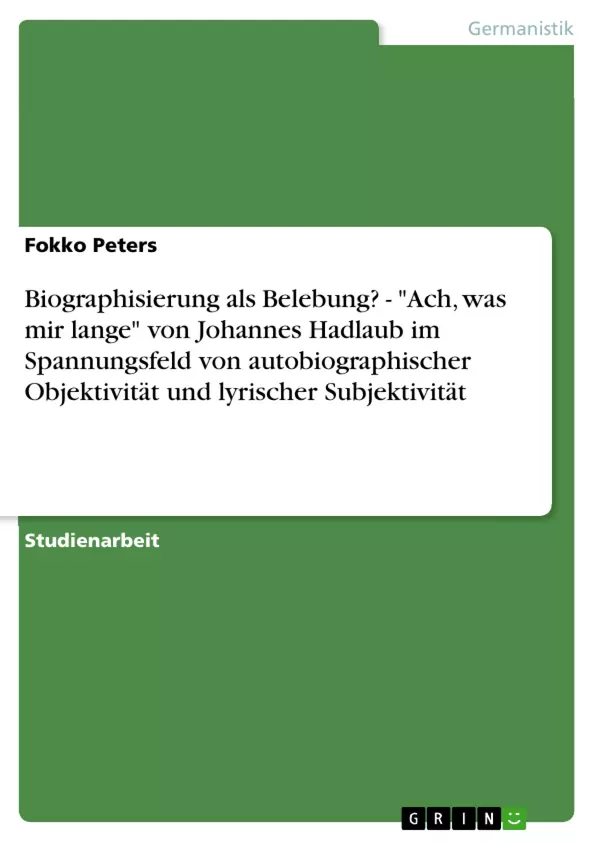1. Einleitung
Das Wissen um Johannes Hadlaub als einem althochdeutschen Minnesänger ist nicht unbedingt sehr umfangreich, selbst wenn man in der Schule etwas über die Literatur des Mittelalters gelernt hat. Er steht im Schatten berühmterer Vorgänger und Zeitgenossen, deren Werke große Berühmtheit erlangt haben. So sind z.B. die Namen Walther von der Vogelweide und Gottfried von Straßburg durchaus geläufiger als der Name des Züricher Bürgers Hadlaub. Auch die Werke der großen Minnesänger sind oftmals bekannter als diejenigen Hadlaubs. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass die Texte vieler mittelalterlicher Autoren uns heute nur deshalb noch bekannt sind, weil sie Teil eines einmaligen Überlieferungswerkes sind: der Manessischen Liederhandschrift. Diese entstand um die Jahrhundertwende des 13./14. Jahrhunderts – also zu Lebzeiten Hadlaubs – in Zürich, dem Wohnort des Dichters. Es ist sogar wahrscheinlich, dass er selbst an der Entstehung dieses Werkes beteiligt war. Seinem Œuvre wurden die ersten Blätter der Handschrift gewidmet und das in dieser Arbeit behandelte Lied „Ach, mir was lange“ steht noch dazu am Anfang seines Liedcorpus. Dieses Lied gehört zu der Gruppe der Erzähllieder oder „Romanzen“, die einen ersten Teil epischen Charakters aufweisen und in einem zweiten Teil eine Minneklage enthalten. Leppin vermutet, dass Hadlaub „größeren Wert auf die Behandlung der Minneproblematik“ legte. Die Bedeutung des erzählenden Eingangsteiles soll – unter Berücksichtigung des Inhalts der darauf folgenden Minnereflexion – am Beispiel von „Ach, mir was lange“ untersucht und hinsichtlich des im Thema der Arbeit formulierten Spannungsfeldes problematisiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Interpretation von „Ach, mir was lange“
- Eine neue Gattung bei Hadlaub: das „Erzähllied“
- Das Spannungsfeld zwischen autobiographischer Objektivität und lyrischer Subjektivität in Hadlaubs Erzählliedern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Lied „Ach, mir was lange“ von Johannes Hadlaub im Kontext des Spannungsfeldes zwischen autobiographischer Objektivität und lyrischer Subjektivität. Dabei werden die erzählenden Elemente des Liedes im Hinblick auf ihre Funktion innerhalb der Minneproblematik analysiert.
- Die Rolle der Erzählung in Hadlaubs „Erzählliedern“
- Die Verbindung von epischen und lyrischen Elementen in Hadlaubs Werk
- Die Relevanz des Briefmotivs in der mittelalterlichen Literatur
- Die Darstellung von Minne und Liebe in Hadlaubs Werk
- Die Beziehung zwischen autobiographischen und lyrischen Aspekten in Hadlaubs Dichtung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung gibt einen Überblick über das Leben und Werk von Johannes Hadlaub und die Bedeutung seiner „Erzähllieder“ in der mittelalterlichen Literatur. Sie stellt die Forschungsfrage nach dem Spannungsfeld zwischen autobiographischer Objektivität und lyrischer Subjektivität in Hadlaubs Werk und erläutert die Methodik der Analyse.
Interpretation von „Ach, mir was lange“
Das Kapitel analysiert die sieben Strophen des Liedes „Ach, mir was lange“ und unterteilt es in eine „Briefepisode“ und eine darauf folgende Minnereflexion. Es wird auf die „Handlung“, die Figurenkonstellation und die literarischen Motive eingegangen. Die Bedeutung der Briefübergabe als zentrale Handlung und des Liebeswahnsinns als Motiv wird hervorgehoben.
Eine neue Gattung bei Hadlaub: das „Erzähllied“
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der Entstehung und Entwicklung der Gattung „Erzähllied“ bei Hadlaub und verortet sie in den Kontext der mittelalterlichen Literatur. Es werden verschiedene Aspekte des „Erzählliedes“ beleuchtet und die literarischen Vorbilder Hadlaubs untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Johannes Hadlaub, „Erzähllied“, autobiographische Objektivität, lyrische Subjektivität, Minneproblematik, Briefmotiv, Liebeswahnsinn, Tristanrolle, mittelalterliche Literatur, Manessische Liederhandschrift.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Johannes Hadlaub?
Johannes Hadlaub war ein Zürcher Minnesänger des späten 13. und frühen 14. Jahrhunderts, der maßgeblich an der Manessischen Liederhandschrift beteiligt war.
Was ist das Besondere an Hadlaubs „Erzählliedern“?
Diese Lieder verbinden einen epischen, erzählenden Teil (oft mit biographischen Zügen) mit einer lyrischen Minneklage.
Worum geht es in dem Lied „Ach, mir was lange“?
Das Lied thematisiert eine Briefübergabe und den daraus resultierenden Liebeswahnsinn des Sängers im Rahmen der Minneproblematik.
Was bedeutet „Biographisierung“ in Hadlaubs Werk?
Es beschreibt die Tendenz, fiktive Minneerlebnisse so darzustellen, als seien sie reale, persönliche Erlebnisse des Dichters (Spannungsfeld Objektivität vs. Subjektivität).
Welche literarischen Motive nutzt Hadlaub?
Zentrale Motive sind das Briefmotiv, die Tristanrolle und die Darstellung der Minne als leidvoller, fast wahnsinniger Zustand.
- Quote paper
- Fokko Peters (Author), 2007, Biographisierung als Belebung? - "Ach, was mir lange" von Johannes Hadlaub im Spannungsfeld von autobiographischer Objektivität und lyrischer Subjektivität, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84240