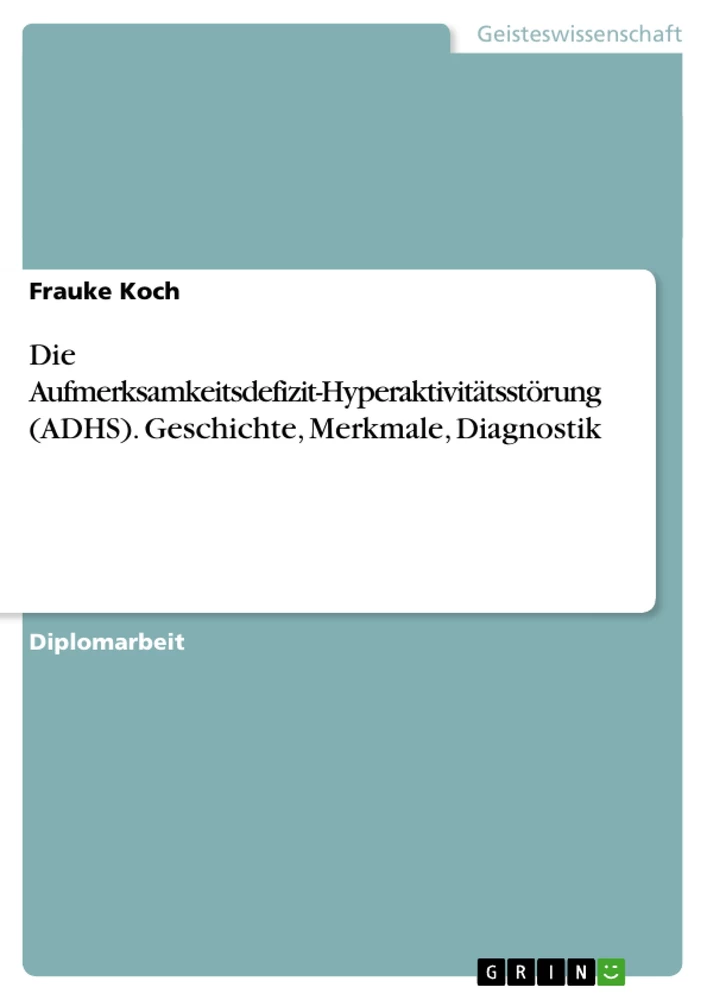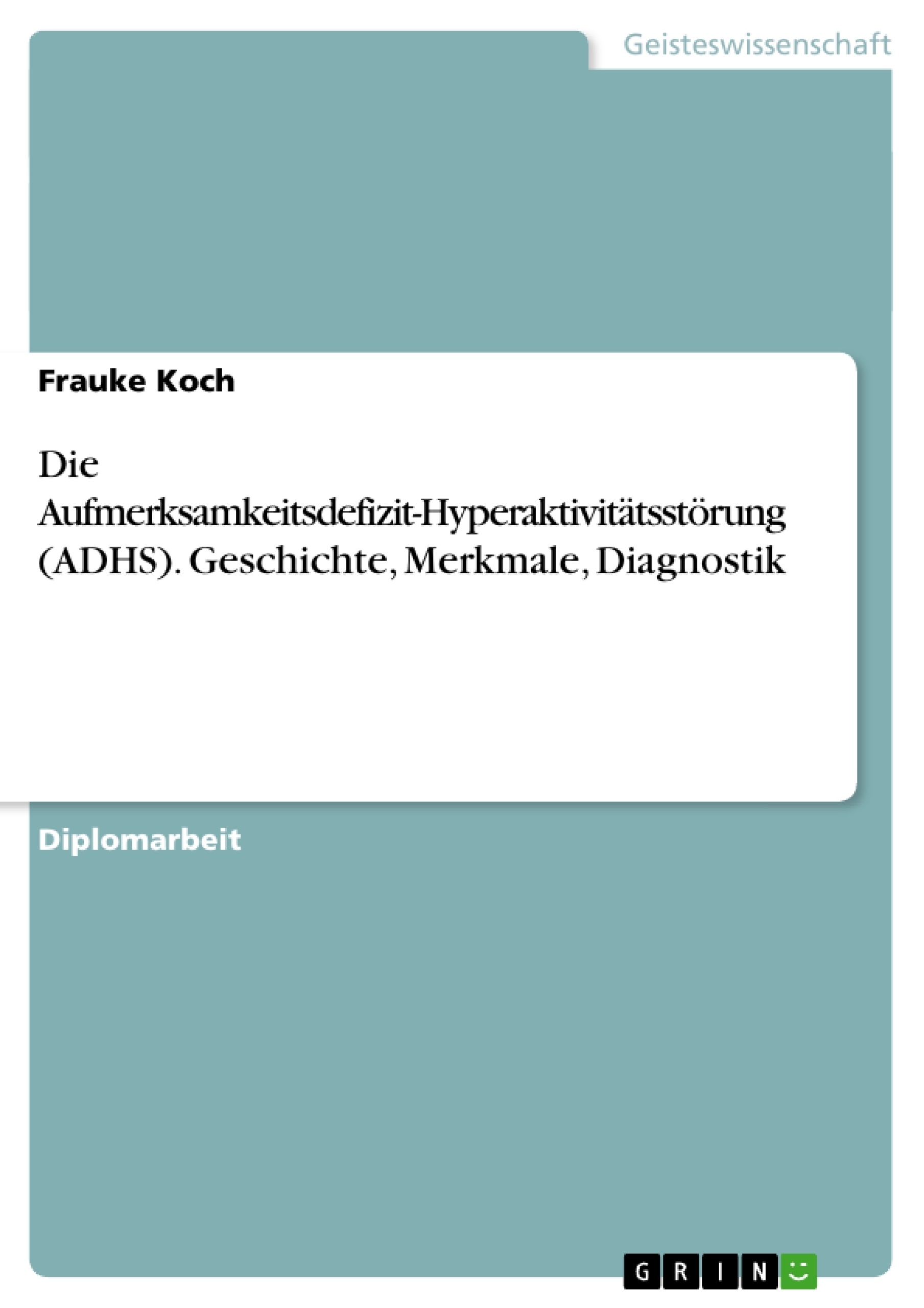Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist innerhalb der letzten Jahre in den Mittelpunkt des wissenschaftlichen und öffentlichen
Interesses gerückt. Durch den Einfluss von Medien hat der Bekanntheitsgrad dieser Störung deutlich zugenommen. Inzwischen sind zahlreiche Publikationen zum Thema ADHS erschienen. Auf die Eingabe des
Begriffes „Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung“ in gängige Suchmaschinen des Internets erhält der Informationssuchende circa 20.000 bis 36.000 Ergebnisse.
Dennoch oder gerade deswegen herrscht eine große Ratlosigkeit und ein erheblicher Informationsbedarf seitens Eltern und Pädagogen. Für manche ist die ADHS eine Modeerscheinung, deren Diagnose bestritten wird, für andere eine psychische Erkrankung mit erheblichen Konsequenzen für den Einzelnen und sein Umfeld. In weiteren Diskussionszusammenhängen ist die ADHS sogar die Erklärung für fast alle kindlichen problematischen Verhaltensweisen. Verunsichert durch die öffentliche Diskussion, die als eine der „größten Kontroversen in der Geschichte des Fachgebiets Kinder- und Jugendpsychiatrie“ (Leuzinger-Bohleber u.a. 2006, S. 22) bezeichnet wird, fragen sich Betroffene, Eltern und professionelle Helfer, wie eine ADHS entsteht, diagnostiziert und behandelt werden kann.
Insbesondere der rapide Anstieg der medikamentösen Behandlung wird von der Öffentlichkeit und Fachwelt in Frage gestellt. Mit dieser Überblicksarbeit möchte ich einen Beitrag zur Versachlichung der Debatte über die ADHS leisten. Das Ziel der Diplomarbeit ist es, einen aktuellen Überblick über die Forschungsbefunde, über das praktische Vorgehen in der Diagnostik und Therapie von ADHS sowie mögliche Präventionsansätze aufzuzeigen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS)
- Geschichte des Störungsbildes und Begriffsentwicklung
- Symptombeschreibung und Klassifikation
- Komorbidität
- Prävalenz
- Ätiologie
- Biologische Faktoren
- Neurobiologische Faktoren
- Genetische Faktoren
- Schädigungen des zentralen Nervensystems
- Allergiehypothese
- Psychosoziale Faktoren
- Besonderheiten einer ADHS in den Entwicklungsphasen
- Säuglings- und Kleinkindalter
- Kindergarten- und Vorschulalter
- Grundschulalter
- Jugendalter
- Erwachsenenalter
- Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten
- Diagnostische Vorgehensweise bei ADHS
- Behandlungsmöglichkeiten
- Medikamentöse Therapie
- Psychotherapie
- Psychoanalytischer Ansatz
- Systemischer Ansatz
- Verhaltenstherapeutischer Ansatz
- Multimodaler Behandlungsansatz
- Weitere Maßnahmen
- Möglichkeiten der Prävention
- Schluss
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) und zielt darauf ab, einen aktuellen Überblick über die Forschungsbefunde, die diagnostischen und therapeutischen Vorgehensweisen sowie mögliche Präventionsansätze zu geben. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der Altersgruppe der Kinder, da ADHS eine der häufigsten Störungen im Kindesalter darstellt.
- Geschichte und Begriffsentwicklung der ADHS
- Symptombeschreibung, Klassifikation und Prävalenz der ADHS
- Biologische und psychosoziale Faktoren, die zur Entstehung von ADHS beitragen
- Auswirkungen von ADHS auf die Entwicklungsphasen vom Säuglingsalter bis zum Erwachsenenalter
- Diagnostik, verschiedene Therapieansätze und Präventionsmöglichkeiten im Kontext von ADHS
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema ADHS und beleuchtet dessen geschichtliche Entwicklung und die verschiedenen Begriffsbezeichnungen. Im Anschluss werden die Leitsymptome der Störung detailliert beschrieben und in den Kontext aktueller Klassifikationssysteme, wie dem ICD-10 und DSM-IV, eingeordnet.
Kapitel 3 widmet sich der Ätiologie von ADHS und untersucht sowohl biologische Faktoren, wie neurobiologische Dysfunktionen, genetische Veranlagungen und Schäden des zentralen Nervensystems, als auch psychosoziale Faktoren wie familiäre Belastungen und das Umfeld des Kindes.
Kapitel 4 beleuchtet die Auswirkungen von ADHS auf verschiedene Entwicklungsphasen des Menschen, von der frühen Kindheit bis ins Erwachsenenalter. Es werden die typischen Verhaltensmuster und die Herausforderungen, denen sich Betroffene in den jeweiligen Lebensabschnitten stellen müssen, beschrieben.
Kapitel 5 befasst sich mit der Diagnostik und den Behandlungsmöglichkeiten von ADHS. Es werden die verschiedenen Methoden zur Diagnose, wie Explorationen, Fragebögen und Verhaltensbeobachtungen, sowie die wichtigsten Behandlungsansätze, wie die medikamentöse Therapie, die Psychotherapie und der multimodale Behandlungsansatz, vorgestellt.
Kapitel 6 befasst sich mit den Möglichkeiten der Prävention von ADHS. Es werden die drei Präventionsarten (primäre, sekundäre und tertiäre Prävention) erläutert und Schutzfaktoren sowie Risikofaktoren für die Entstehung der Störung benannt.
Schlüsselwörter
Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, ADHS, Geschichte, Begriffsentwicklung, Symptombeschreibung, Klassifikation, ICD-10, DSM-IV, Komorbidität, Prävalenz, Ätiologie, biologische Faktoren, psychosoziale Faktoren, Entwicklungsphasen, Säuglingsalter, Kleinkindalter, Kindergartenalter, Vorschulalter, Grundschulalter, Jugendalter, Erwachsenenalter, Diagnostik, Behandlungsmöglichkeiten, medikamentöse Therapie, Methylphenidat, Psychostimulanzien, Psychotherapie, verhaltenstherapeutischer Ansatz, multimodaler Behandlungsansatz, Prävention, Schutzfaktoren, Risikofaktoren.
- Quote paper
- Frauke Koch (Author), 2006, Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Geschichte, Merkmale, Diagnostik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84270