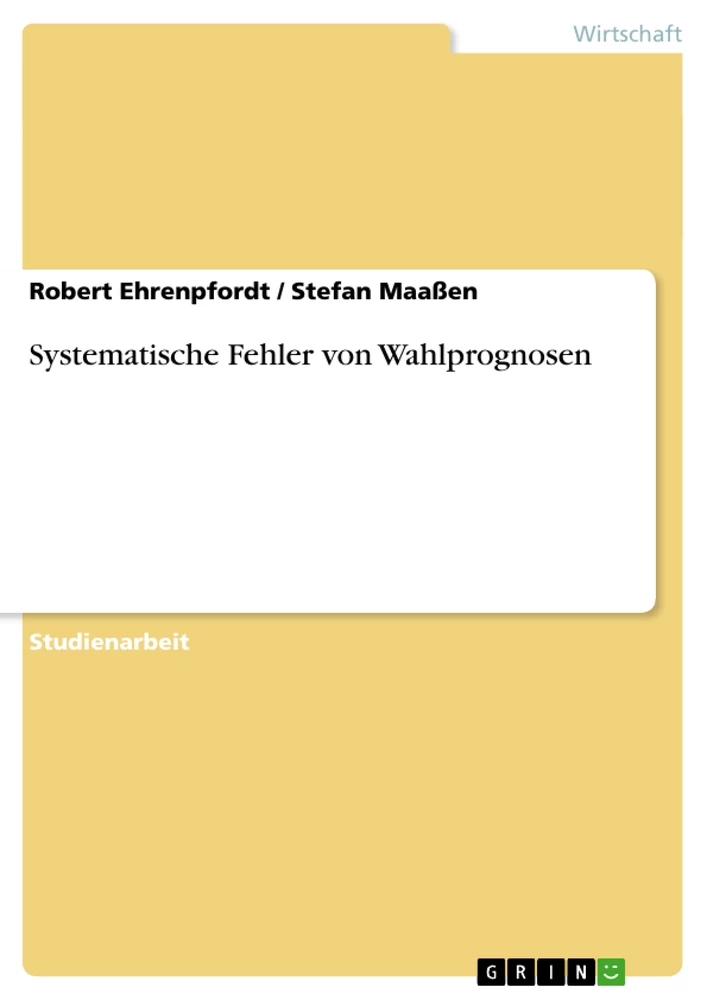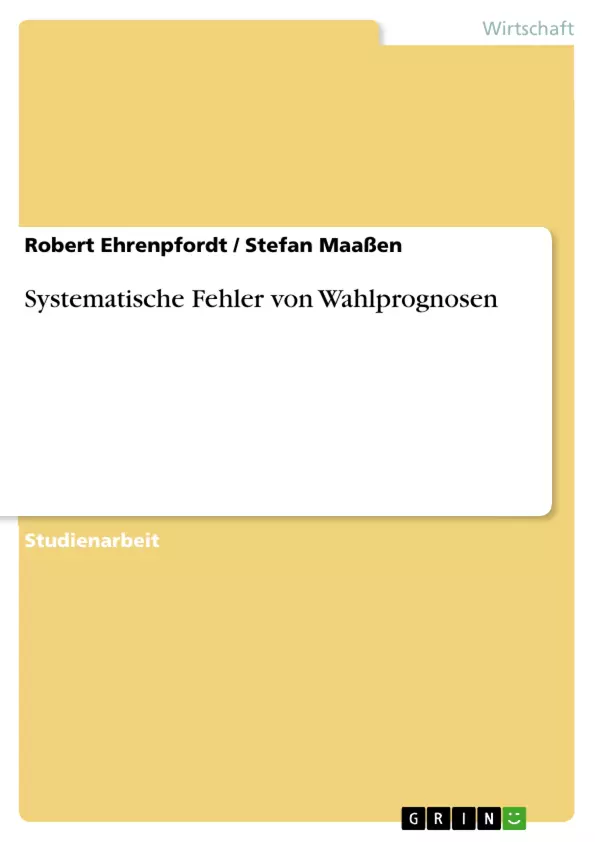Untersuchungsgegenstand dieser Seminararbeit sind systematische Fehler von Wahlprognosen. Bis zum heutigen Zeitpunkt wurde die Fehlerhaftigkeit von Wahlprognosen in Deutschland lediglich einmal in einer wissenschaftlichen Arbeit umfassend empirisch untersucht. Dies ist deshalb verwunderlich, da die Institute anscheinend ihre Daten veröffentlichen können, ohne dass diese seitens der Öffentlichkeit oder der Wissenschaft kritisch hinterfragt werden. Brisant erscheint dies besonders vor dem Hintergrund, dass solche Prognosen in den heutigen Wahlkämpfen von besonderer Bedeutung sind. Der Rückblick auf die vergangenen drei Bundestagswahlen zeigt die enorm gestiegene Präsenz von Wahlprognosen in den Medien bereits Monate vor der eigentlichen Wahl. Verstärkt wird die Bedeutung dieser Prognosen dadurch, dass sowohl die Politik als auch die Medien die veröffentlichten Daten in ihre Strategien, Berichte und Diskussionen einbeziehen. Andererseits zeigen diese Wahlen aber auch deutlich die Diskrepanz der Wahlprognosen einiger renommierter Institute zu den amtlichen Endergebnissen. So hat Infratest dimap bspw. die CDU zwei Wochen vor der Bundestagswahl 2005 um 7,8 % zu hoch prognostiziert und damit einen völlig anderen Wahlausgang vorhergesagt. Diese Beobachtung stellt bei weitem keinen Einzelfall dar und ist u.a. einer der Hauptgründe für das Interesse an der vorliegenden Seminararbeit. Die Analyse der Wahlprognosen erfolgt unter der zentralen Untersuchungsfrage: Bewerten Meinungs-forschungsinstitute bestimmte Parteien mit ihren Prognosen systematisch zu hoch oder zu niedrig?
Es werden Prognosen von Bundes- und Landtagstagswahlen im Zeitraum 1957 – 2006 von sechs großen deutschen Instituten für Demoskopie ausgewertet, die jeweils zwischen einer und vier Wochen vor der entsprechenden Wahl erstellt wurden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Wahlprognosen
- 2.1 Begriffsbestimmung und Historie
- 2.2 Wahlprognosen und Erhebungsverfahren
- 3. Daten
- 3.1 Meinungsforschungsinstitute in Deutschland
- 3.2 Datengrundlage
- 4. Auswertung der Daten
- 4.1 Vorgehensweise
- 4.2 Auswertung Wahlprognosen gesamt
- 4.3 Auswertung Wahlprognosen Landtagswahlen
- 4.4 Mögliche Ursachen für systematische Abweichungen
- 5. Folgen für die Wahlen
- 5.1 Einfluss auf die Stimmenabgabe
- 5.2 Einfluss auf die Wahlbeteiligung
- 5.3 Wahlprognosen als Instrument der Parteien und der Medien
- 5.4 Gesetzliches Verbot von Wahlprognosen?
- 6. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht systematische Fehler in deutschen Wahlprognosen. Ziel ist es, zu analysieren, ob Meinungsforschungsinstitute bestimmte Parteien in ihren Prognosen systematisch über- oder unterbewerten. Die Arbeit basiert auf einer empirischen Auswertung von Prognosen verschiedener Institute für Bundestags- und Landtagswahlen zwischen 1957 und 2006.
- Systematische Abweichungen von Wahlprognosen vom amtlichen Endergebnis
- Methodische Ansätze der Meinungsforschungsinstitute
- Einfluss von Wahlprognosen auf Wählerverhalten und Wahlbeteiligung
- Die Rolle von Wahlprognosen in der politischen Kommunikation
- Diskussion um ein mögliches Verbot von Wahlprognosen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der systematischen Fehler von Wahlprognosen ein und begründet die Relevanz der Untersuchung. Es wird auf die überraschend geringe wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesem Thema hingewiesen und die Diskrepanz zwischen prognostizierten und tatsächlichen Wahlergebnissen hervorgehoben. Als Beispiel wird die fehlerhafte Prognose der CDU-Ergebnisse durch Infratest dimap bei der Bundestagswahl 2005 genannt. Die zentrale Forschungsfrage lautet: Bewerten Meinungsforschungsinstitute bestimmte Parteien systematisch zu hoch oder zu niedrig? Die Methodik der Arbeit, die Auswertung von Daten aus Sekundärliteratur mithilfe der Software SPSS, wird ebenfalls skizziert.
2. Wahlprognosen: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Wahlprognose und beleuchtet dessen historische Entwicklung. Es beschreibt verschiedene Erhebungsverfahren, die von Meinungsforschungsinstituten angewendet werden, um Daten für ihre Prognosen zu gewinnen. Der Fokus liegt auf den Methoden und deren potenziellen Stärken und Schwächen, die zu systematischen Fehlern führen können. Es wird die Basis für das Verständnis der darauffolgenden Datenanalyse gelegt.
3. Daten: Das Kapitel beschreibt die Datenbasis der Studie. Es werden die in Deutschland tätigen Meinungsforschungsinstitute vorgestellt und die Auswahlkriterien der verwendeten Daten erläutert. Es wird detailliert auf die Herausforderungen bei der Datenerhebung hingewiesen, insbesondere auf die Schwierigkeiten, geeignete Daten direkt von den Instituten zu erhalten, was die ausschließliche Nutzung von Sekundärliteratur notwendig macht. Die Struktur und der Umfang der verwendeten Daten werden klar definiert.
4. Auswertung der Daten: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der statistischen Auswertung der gesammelten Daten. Es beschreibt die angewandte Vorgehensweise, inklusive der verwendeten statistischen Tests (Kolmogorov-Smirnov-Test und t-Test), die zur Analyse der Abweichungen zwischen Prognosen und Wahlergebnissen eingesetzt wurden. Die Ergebnisse sowohl für Bundestags- als auch für Landtagswahlen werden detailliert dargestellt und interpretiert. Dieser Abschnitt bildet den Kern der empirischen Untersuchung.
5. Folgen für die Wahlen: Hier werden die möglichen Folgen der systematischen Fehler von Wahlprognosen auf den Wahlprozess diskutiert. Es wird analysiert, wie diese Fehler den Einfluss auf die Stimmenabgabe und die Wahlbeteiligung haben könnten. Weiterhin wird die Rolle von Wahlprognosen als Instrument der Parteien und Medien untersucht und die Frage nach einem möglichen gesetzlichen Verbot von Wahlprognosen erörtert. Der Kapitel fasst die politischen und gesellschaftlichen Implikationen der Forschungsergebnisse zusammen.
Schlüsselwörter
Wahlprognosen, Meinungsforschungsinstitute, systematische Fehler, empirische Wirtschaftsforschung, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, SPSS, statistische Tests, Wahlverhalten, Medien, Politik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Systematische Fehler in deutschen Wahlprognosen"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht systematische Fehler in deutschen Wahlprognosen. Das Hauptziel ist die Analyse, ob Meinungsforschungsinstitute bestimmte Parteien in ihren Prognosen systematisch über- oder unterbewerten. Die Untersuchung basiert auf einer empirischen Auswertung von Prognosen verschiedener Institute für Bundestags- und Landtagswahlen zwischen 1957 und 2006.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: systematische Abweichungen von Wahlprognosen vom amtlichen Endergebnis, methodische Ansätze der Meinungsforschungsinstitute, Einfluss von Wahlprognosen auf Wählerverhalten und Wahlbeteiligung, die Rolle von Wahlprognosen in der politischen Kommunikation und die Diskussion um ein mögliches Verbot von Wahlprognosen.
Welche Daten wurden verwendet?
Die Datenbasis besteht aus Wahlprognosen verschiedener Meinungsforschungsinstitute für Bundestags- und Landtagswahlen zwischen 1957 und 2006. Aufgrund von Schwierigkeiten, Daten direkt von den Instituten zu erhalten, wurde ausschließlich Sekundärliteratur verwendet. Die Arbeit beschreibt detailliert die Herausforderungen bei der Datenerhebung und die Auswahlkriterien der verwendeten Daten.
Welche Methoden wurden zur Datenanalyse angewendet?
Die Auswertung der Daten erfolgte mithilfe der Software SPSS. Es wurden statistische Tests wie der Kolmogorov-Smirnov-Test und der t-Test eingesetzt, um Abweichungen zwischen Prognosen und Wahlergebnissen zu analysieren. Die Vorgehensweise der Datenanalyse wird detailliert im Kapitel 4 beschrieben.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Kapitel 4 präsentiert die Ergebnisse der statistischen Auswertung, sowohl für Bundestags- als auch für Landtagswahlen. Die Ergebnisse werden detailliert dargestellt und interpretiert. Der Fokus liegt auf der Identifizierung möglicher systematischer Abweichungen und deren Ursachen.
Welche Folgen haben systematische Fehler in Wahlprognosen?
Kapitel 5 diskutiert die möglichen Folgen der systematischen Fehler auf den Wahlprozess, einschließlich des Einflusses auf die Stimmenabgabe und die Wahlbeteiligung. Es wird auch die Rolle von Wahlprognosen als Instrument der Parteien und Medien untersucht und die Frage nach einem möglichen gesetzlichen Verbot erörtert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wahlprognosen, Meinungsforschungsinstitute, systematische Fehler, empirische Wirtschaftsforschung, Bundestagswahlen, Landtagswahlen, SPSS, statistische Tests, Wahlverhalten, Medien, Politik.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Wahlprognosen (inkl. Begriffsbestimmung und Erhebungsverfahren), Daten (inkl. Meinungsforschungsinstitute und Datengrundlage), Auswertung der Daten (inkl. Vorgehensweise und Auswertung für Bundestags- und Landtagswahlen), Folgen für die Wahlen (inkl. Einfluss auf Stimmenabgabe und Wahlbeteiligung, Rolle der Medien und Parteien, mögliches Verbot) und Zusammenfassung.
Gibt es eine zentrale Forschungsfrage?
Ja, die zentrale Forschungsfrage lautet: Bewerten Meinungsforschungsinstitute bestimmte Parteien systematisch zu hoch oder zu niedrig?
- Arbeit zitieren
- Robert Ehrenpfordt (Autor:in), Stefan Maaßen (Autor:in), 2007, Systematische Fehler von Wahlprognosen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84278