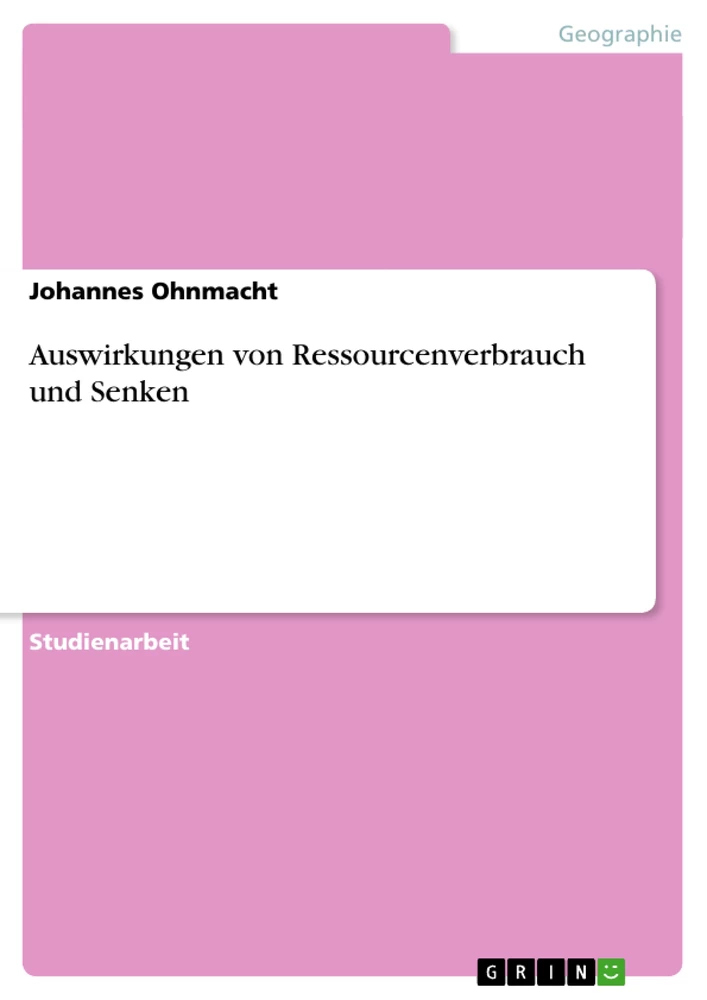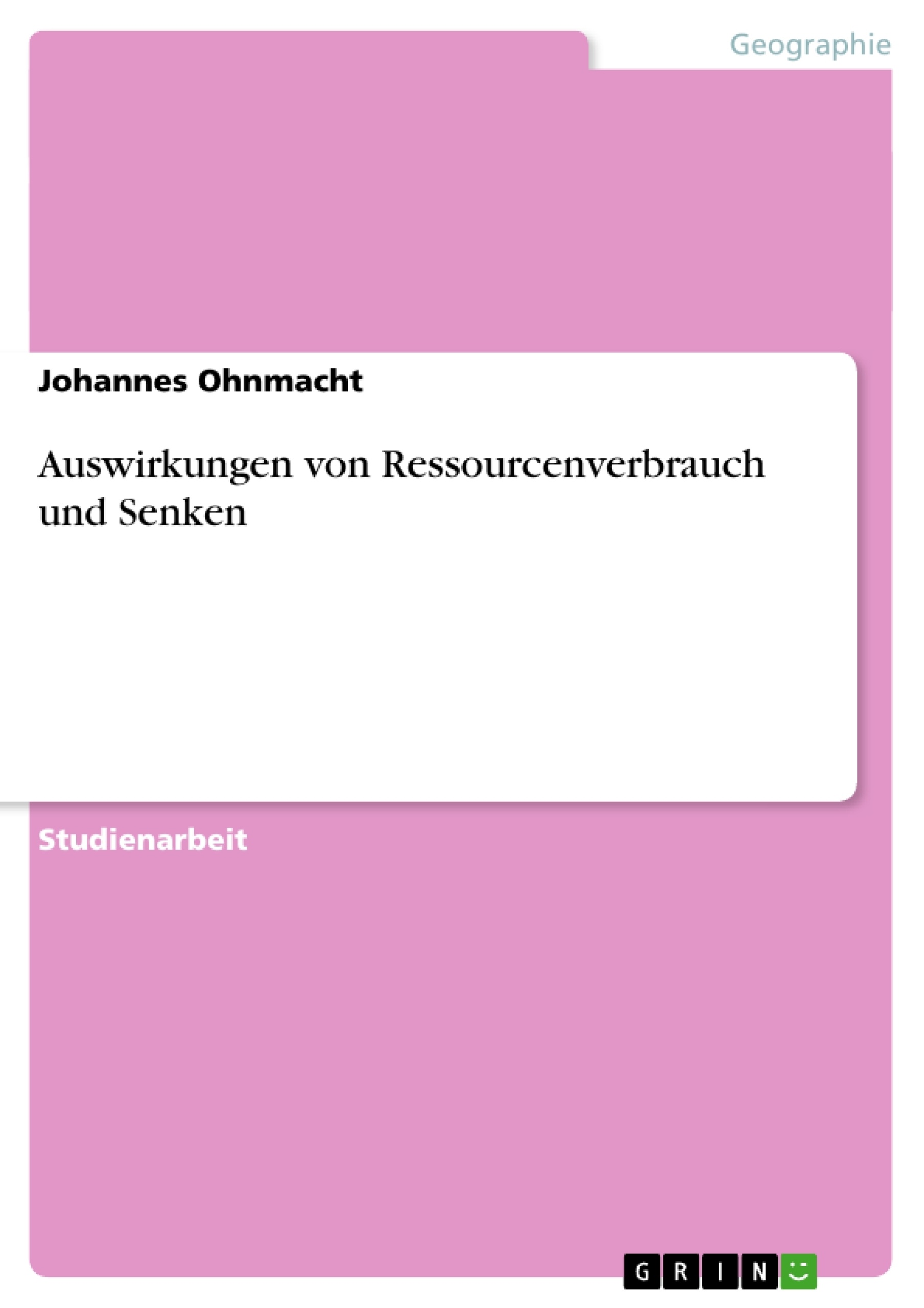Innerhalb des Konzepts des Global Change nimmt die Untersuchung des weltweiten Ressourcenmanagements eine zentrale Rolle ein. Hierbei lassen sich auf den ersten Blick einige scheinbar einfache und logische Unterteilungen vornehmen: Ressourcen sind entweder erneuerbar oder endlich. Doch ist bei genauerem Hinsehen eine eindeutige Zuteilung und isolierte Betrachtung gar nicht möglich. Aber nicht nur die theoretische Klassifikation ist schwierig, sondern in noch stärkerem Maße einerseits die ökologische Abschätzung über die für die Natur, und damit auch für den Menschen, unproblematische Nutzung der vorhandenen Ressourcen und andererseits die ökonomisch sinnvollste Nutzung.
Letzteres ist insbesondere das Thema der neoklassischen Theorie, ersteres versucht der Ansatz des „sustainable development“ innerhalb von ökonomischen Begebenheiten zu integrieren und legt dabei den Fokus auf die inter- und intragenerative Gerechtigkeit. Das Konzept der nachhaltigen Entwicklung ist also ein interdisziplinäres Konzept welches auch ethische Aspekte berücksichtigt.
Im Rahmen dieser zwei miteinander konkurrierenden und sich wechselseitig beeinflussenden Theorien soll in Laufe der vorliegenden Arbeit untersucht werden, wie der aktuelle Bestand an Ressourcen ist, wie er sich in näherer und ferner Zukunft unter unterschiedlichen Annahmen entwickeln wird und welche Gefahren bei einer zu schnellen oder auch zu langsamen Nutzung der Ressourcen drohen.
Zuerst werden also die beiden genannten Theorien vorgestellt, diskutiert (Kapitel II) und durch einige Begriffs- und Abgrenzungsklärungen für die weitere Verwendung nutzbar gemacht (Kapitel III). Danach werden die Gefahren der Nutzung von erneuerbaren (Kapitel IV) und nicht erneuerbaren Ressourcen (Kapitel V) im Lichte der zwei Konzepte behandelt. Ein oft vernachlässigter Aspekt hierbei ist die Problematik der Ressourcensenken, hierauf weist speziell die ökologische Ökonomie hin (Kapitel VI). Anhand von drei möglichen Modellen und der GAIA Hypothese soll analysiert werden, wie und warum die Frage der Auswirkungen von Ressourcennutzung und Senken nicht nur wichtig, sondern existenziell für den Menschen ist (Kapitel VII).
Abschließend soll eine kurze Zusammenfassung der Ergebnisse, ein Ausblick auf die zukünftig wahrscheinlichste Entwicklung und ein Verweis auf noch ausstehende Probleme gegeben werden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Ansätze
- 1. Neoklassische Theorie
- 2. Ökologische Ökonomie
- III. Abgrenzungen und Begriffsklärungen
- IV. Erneuerbare Ressourcen
- 1. Unbedingt erneuerbare Ressourcen
- 1.1. Windenergie
- 1.2. Sonnenenergie
- 1.3. Wasserkraft
- 1.4. Erdwärme
- 1.5. Zusammenfassung
- 2. Bedingt erneuerbare Ressourcen
- 1. Unbedingt erneuerbare Ressourcen
- V. Nicht erneuerbare Ressourcen
- 1. Fossile Energieträger
- 2. Mineralische Ressourcen
- 3. Boden
- 4. Wasser
- 5. Biodiversität
- 6. Raum
- 7. Luft
- VI. Strategien zur Abfallverwertung
- 1. Abfallvermeidung
- 2. Kreislaufwirtschaft/ Recycling
- 3. Thermische Behandlung
- 4. Deponierung
- VII. Ausblick
- 1. Lineare Verschlechterung
- 2. Zyklische Veränderung
- 3. Wiederanstieg
- 4. GAIA- Hypothese
- VIII. Résumé
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Auswirkungen des weltweiten Ressourcenmanagements im Kontext des Global Change. Hierbei werden die neoklassische Theorie und die ökologische Ökonomie als zwei konkurrierende Ansätze vorgestellt und diskutiert. Die Arbeit analysiert die Gefahren der Nutzung von erneuerbaren und nicht erneuerbaren Ressourcen unter dem Lichte dieser beiden Konzepte, wobei der Fokus auf die Problematik der Ressourcensenken gelegt wird. Es werden drei mögliche Modelle für die zukünftige Entwicklung der Umweltbelastung durch Ressourcenverbrauch präsentiert und die GAIA-Hypothese als eine philosophisch-ethische Annahme vorgestellt. Abschließend wird ein Résumé der wichtigsten Ergebnisse und ein Ausblick auf zukünftige Herausforderungen gegeben.
- Ressourcenmanagement im Kontext des Global Change
- Konkurrierende Ansätze: Neoklassische Theorie und ökologische Ökonomie
- Gefahren der Nutzung von erneuerbaren und nicht erneuerbaren Ressourcen
- Problematik der Ressourcensenken
- Zukünftige Entwicklung der Umweltbelastung durch Ressourcenverbrauch
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel II: Ansätze
- Stellt die neoklassische Theorie und die ökologische Ökonomie als zwei zentrale Ansätze im Ressourcenmanagement vor.
- Diskutiert die Grundannahmen und Unterschiede beider Theorien in Bezug auf Wachstum, Substitution von Ressourcen und Nachhaltigkeit.
- Behandelt Kritikpunkte an der neoklassischen Theorie, insbesondere die mangelnde Berücksichtigung der Thermodynamik.
- Kapitel III: Abgrenzungen und Begriffsklärungen
- Beleuchtet die unterschiedlichen Klassifikationen von Ressourcen, insbesondere die Unterscheidung zwischen erneuerbaren und nicht erneuerbaren Ressourcen.
- Erklärt die Begriffe „Reserven“, „theoretische Reserven“ und „potentielle Reserven“.
- Stellt das MSY-Modell zur Bestimmung des optimalen Bestandes und der nachhaltigen Nutzung von bedingt erneuerbaren Ressourcen vor.
- Kapitel IV: Erneuerbare Ressourcen
- Beschreibt die Besonderheiten und das Potential der unbedingt erneuerbaren Ressourcen (Windenergie, Sonnenenergie, Wasserkraft, Erdwärme).
- Analysiert die ökologischen Probleme und Herausforderungen bei der Nutzung von erneuerbaren Ressourcen.
- Diskutiert die unterschiedlichen Abschätzungen des Potentials erneuerbarer Ressourcen durch verschiedene Institutionen.
- Behandelt die Bedeutung der gleichmäßigen globalen Verteilung von erneuerbaren Ressourcen im Sinne der nachhaltigen Entwicklung.
- Kapitel V: Nicht erneuerbare Ressourcen
- Erklärt die Problematik der Nutzung von nicht erneuerbaren Ressourcen im Hinblick auf die nachhaltige Entwicklung.
- Stellt verschiedene Arten von nicht erneuerbaren Ressourcen (fossile Energieträger, mineralische Ressourcen, Boden, Wasser, Biodiversität, Raum, Luft) vor.
- Diskutiert die Schwierigkeiten bei der Abschätzung der Reserven und der Auswirkungen des Abbaus nicht erneuerbarer Ressourcen.
- Betont die Bedeutung der aktiven Politikgestaltung im Bereich des Abbaus und der Nutzung nicht erneuerbarer Ressourcen.
- Kapitel VI: Strategien zur Abfallverwertung
- Beleuchtet die Problematik der Abfallverwertung im Lichte der Thermodynamik.
- Stellt verschiedene Strategien zur Abfallverwertung (Abfallvermeidung, Kreislaufwirtschaft/Recycling, thermische Behandlung, Deponierung) vor.
- Diskutiert die ökologischen und ökonomischen Herausforderungen der Abfallverwertung.
- Betont die Notwendigkeit von umfassenden Kontrollen, Gesetzen und Anreizen für eine nachhaltige Abfallverwertung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen des Global Change wie Ressourcennutzung, Nachhaltigkeit, neoklassische Theorie, ökologische Ökonomie, erneuerbare Ressourcen, nicht erneuerbare Ressourcen, Ressourcensenken, Abfallverwertung, Umweltbelastung, GAIA-Hypothese, intergenerative Gerechtigkeit und Marktversagen. Dabei werden wichtige Konzepte wie die ökologische Kuznets Kurve, die MSY-Regel und die „safe-minimum-standard“ Regel diskutiert.
Häufig gestellte Fragen
Welche zwei ökonomischen Ansätze zum Ressourcenmanagement werden verglichen?
Verglichen werden die neoklassische Theorie und die ökologische Ökonomie.
Was ist die Problematik der Ressourcensenken?
Ressourcensenken bezeichnen die Fähigkeit der Umwelt, Abfälle und Emissionen aufzunehmen. Eine Überlastung dieser Senken gefährdet die Existenzgrundlage.
Was besagt die GAIA-Hypothese?
Sie betrachtet die Erde als einen selbstregulierenden Organismus, der optimale Lebensbedingungen für sich selbst erhält.
Wie unterscheiden sich erneuerbare und nicht erneuerbare Ressourcen?
Erneuerbare Ressourcen (wie Wind) regenerieren sich, während nicht erneuerbare (wie fossile Brennstoffe) endlich sind und sich über menschliche Zeiträume nicht erneuern.
Was ist das MSY-Modell?
Der "Maximum Sustainable Yield" beschreibt die maximale Entnahmemenge einer regenerierbaren Ressource, ohne deren Bestand zu gefährden.
- Quote paper
- Johannes Ohnmacht (Author), 2005, Auswirkungen von Ressourcenverbrauch und Senken, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84282