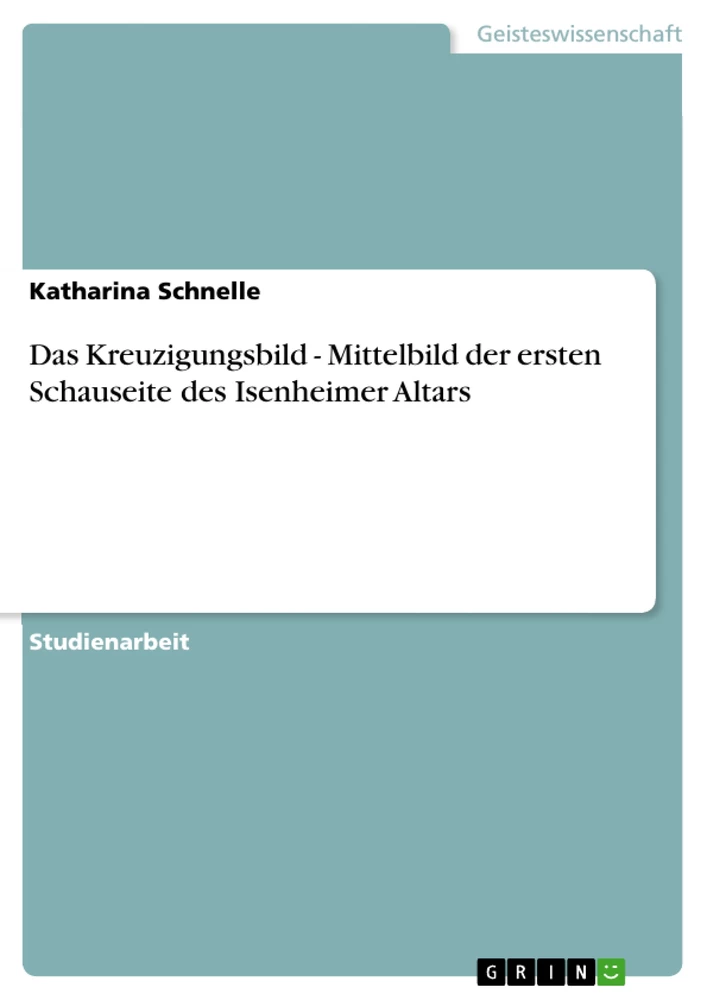Der Isenheimer Altar wurde vermutlich um 1515 von Mathias Grünewald (auch genannt
Mathis von Aschaffenburg) für die Kapelle des Antoniterklosters in Isenheim geschaffen. Die
Antonitermönche dieses, im mittelalterlichen Europa weit verbreiteten Bettelorden, widmeten
sich insbesondere der unentgeltlichen Pflege von Kranken, die an der Mutterkornvergiftung
(Antoniusfeuer) litten. Leid und Krankheit galten als Strafe für begangene Sünden.
Bei Grünewalds Werk handelt es sich um einen so genannten Wandel- oder Flügelaltar. In
geschlossenem Zustand sind die erste Schauseite mit der Kreuzigung Jesu als Hauptthema
und die beiden Seitenflügel zu sehen. Durch Öffnung der Altarflügel werden die zweite
Schauseite mit der Darstellung des Weihnachtsbildes und schließlich die dritte Schauseite, ein
Altarschrein, sichtbar. Während die zweite Schauseite nur an Sonn- und Feiertagen geöffnet
wurde, war die erste Schauseite an allen Werktagen des Jahres für den Betrachter zugänglich.
Heute ist der Isenheimer Altar in getrennter Aufstellung der Bildtafeln im Unterlindenmuseum
in Colmar, einem einstigen Dominikanerkloster, zu finden.
Inhaltsverzeichnis
- I Entstehung und Konzeption des Isenheimer Altars
- II Beschreibung und Deutung der ersten Schauseite
- 2.1 Kurzbeschreibung des Bildgefüges
- 2.2 Genaue Betrachtung und Deutung des Mittelbildes
- Der gekreuzigte Jesu
- Johannes der Täufer
- Das Lamm
- Maria Magdalena, Johannes der Jünger und die Gottesmutter Maria
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Isenheimer Altar von Matthias Grünewald, insbesondere mit dem Mittelbild der ersten Schauseite, der Kreuzigungsszene. Ziel ist es, die Entstehung, Konzeption und die ikonographische Bedeutung des Werkes im Kontext des Antoniterklosters in Isenheim zu analysieren und die künstlerische Gestaltung im Hinblick auf die damalige Zielgruppe, die kranken Antonitermönche, zu interpretieren.
- Die Entstehung und Konzeption des Isenheimer Altars im Kontext des Antoniterordens und der Behandlung des Antoniusfeuers.
- Die künstlerische Gestaltung der Kreuzigungsszene und ihre Symbolik.
- Die Bedeutung der dargestellten Figuren und ihre Rolle in der Gesamtkomposition.
- Die Wirkung des Bildes auf die Betrachter und seine Funktion als Heilsbotschaft.
- Die außergewöhnliche Größe und Gestaltung des Altarbildes im Vergleich zu anderen Werken der Zeit.
Zusammenfassung der Kapitel
I Entstehung und Konzeption des Isenheimer Altars: Dieses Kapitel beschreibt die Entstehung des Isenheimer Altars um 1515 durch Matthias Grünewald für das Antoniterkloster in Isenheim. Es wird der Kontext des Antoniterordens und seiner Aufgabe der Krankenpflege, insbesondere von an Antoniusfeuer Erkrankten, erläutert. Der Altar wird als Wandelaltar beschrieben, mit einer ersten Schauseite (Kreuzigung), einer zweiten (Weihnachtsbild) und einer dritten (Altarschrein). Die Bedeutung der jeweiligen Zugänglichkeit der Schauseiten wird hervorgehoben, wobei die Kreuzigungsszene täglich sichtbar war. Die heutige Aufstellung im Unterlinden-Museum in Colmar wird erwähnt. Das Kapitel betont den historischen und religiösen Kontext der Entstehung des Kunstwerks.
II Beschreibung und Deutung der ersten Schauseite: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die erste Schauseite des Altars, die Kreuzigung Jesu. Es wird die außergewöhnliche Größe des Bildes und die bewusst gewählte Komposition hervorgehoben, die keine bloß historische Darstellung anstrebt, sondern eine Botschaft vermitteln soll. Die Asymmetrie des Bildaufbaus, mit der betroffenen Personengruppe links und Johannes dem Täufer und dem Lamm rechts vom Kreuz, wird diskutiert. Die dynamische und aufwühlende Wirkung des Bildes durch die Farbwahl und die Darstellung der Grausamkeit der Kreuzigung wird ebenfalls analysiert. Das Kapitel legt den Grundstein für die detaillierte Interpretation des Mittelbildes im folgenden Abschnitt.
Schlüsselwörter
Isenheimer Altar, Matthias Grünewald, Kreuzigung, Antoniusfeuer, Antoniterorden, Wandelaltar, Ikonographie, mittelalterliche Kunst, religiöse Symbolik, Heilsbotschaft, Leid, Hoffnung, Realismus.
Häufig gestellte Fragen zum Isenheimer Altar
Was ist der Inhalt dieser HTML-Datei?
Diese HTML-Datei bietet einen umfassenden Überblick über eine wissenschaftliche Arbeit zum Isenheimer Altar von Matthias Grünewald. Sie enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte der Arbeit, Zusammenfassungen der Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter. Der Fokus liegt auf der Analyse des Mittelbildes der ersten Schauseite, der Kreuzigungsszene.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entstehung und Konzeption des Isenheimer Altars im Kontext des Antoniterordens und der Behandlung des Antoniusfeuers. Im Mittelpunkt steht die Analyse der künstlerischen Gestaltung der Kreuzigungsszene, ihrer Symbolik und ihrer Wirkung auf die Betrachter. Es werden die Bedeutung der dargestellten Figuren, die außergewöhnliche Größe und Gestaltung des Altars sowie seine Funktion als Heilsbotschaft untersucht.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst mindestens zwei Kapitel: Kapitel I befasst sich mit der Entstehung und Konzeption des Isenheimer Altars, einschließlich des historischen und religiösen Kontextes sowie der Beschreibung des Altars als Wandelaltar. Kapitel II konzentriert sich auf die Beschreibung und Deutung der ersten Schauseite, insbesondere der Kreuzigungsszene, mit einer detaillierten Analyse des Mittelbildes und seiner Komposition.
Welche Figuren werden im Mittelbild der Kreuzigungsszene dargestellt?
Das Mittelbild der Kreuzigungsszene zeigt den gekreuzigten Jesus, Johannes den Täufer, das Lamm Gottes, Maria Magdalena, Johannes den Jünger und die Gottesmutter Maria.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Isenheimer Altar, Matthias Grünewald, Kreuzigung, Antoniusfeuer, Antoniterorden, Wandelaltar, Ikonographie, mittelalterliche Kunst, religiöse Symbolik, Heilsbotschaft, Leid, Hoffnung, Realismus.
Wo befindet sich der Isenheimer Altar heute?
Der Isenheimer Altar befindet sich heute im Unterlinden-Museum in Colmar.
Welche Zielgruppe hatte der Isenheimer Altar?
Die primäre Zielgruppe des Isenheimer Altars waren die kranken Antonitermönche im Antoniterkloster in Isenheim.
Was ist die Bedeutung des Isenheimer Altars?
Der Isenheimer Altar ist ein bedeutendes Werk der mittelalterlichen Kunst, das durch seine außergewöhnliche künstlerische Gestaltung und seine intensive religiöse Symbolik besticht. Er diente als Heilsbotschaft und Quelle der Hoffnung für die Kranken und Leidenden.
- Quote paper
- Katharina Schnelle (Author), 2006, Das Kreuzigungsbild - Mittelbild der ersten Schauseite des Isenheimer Altars, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84304