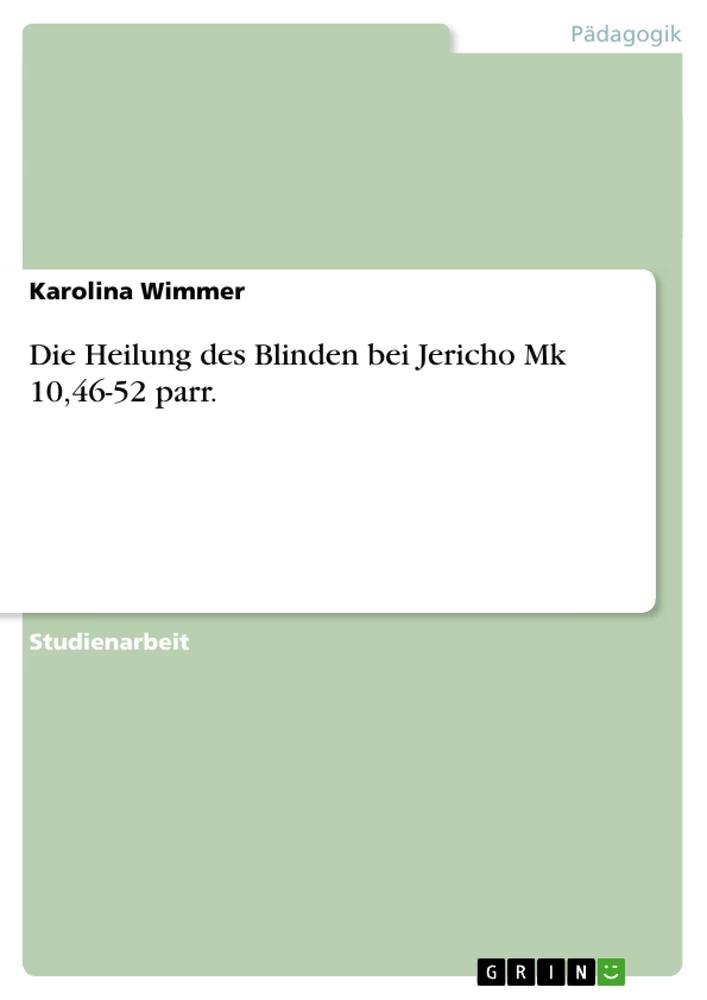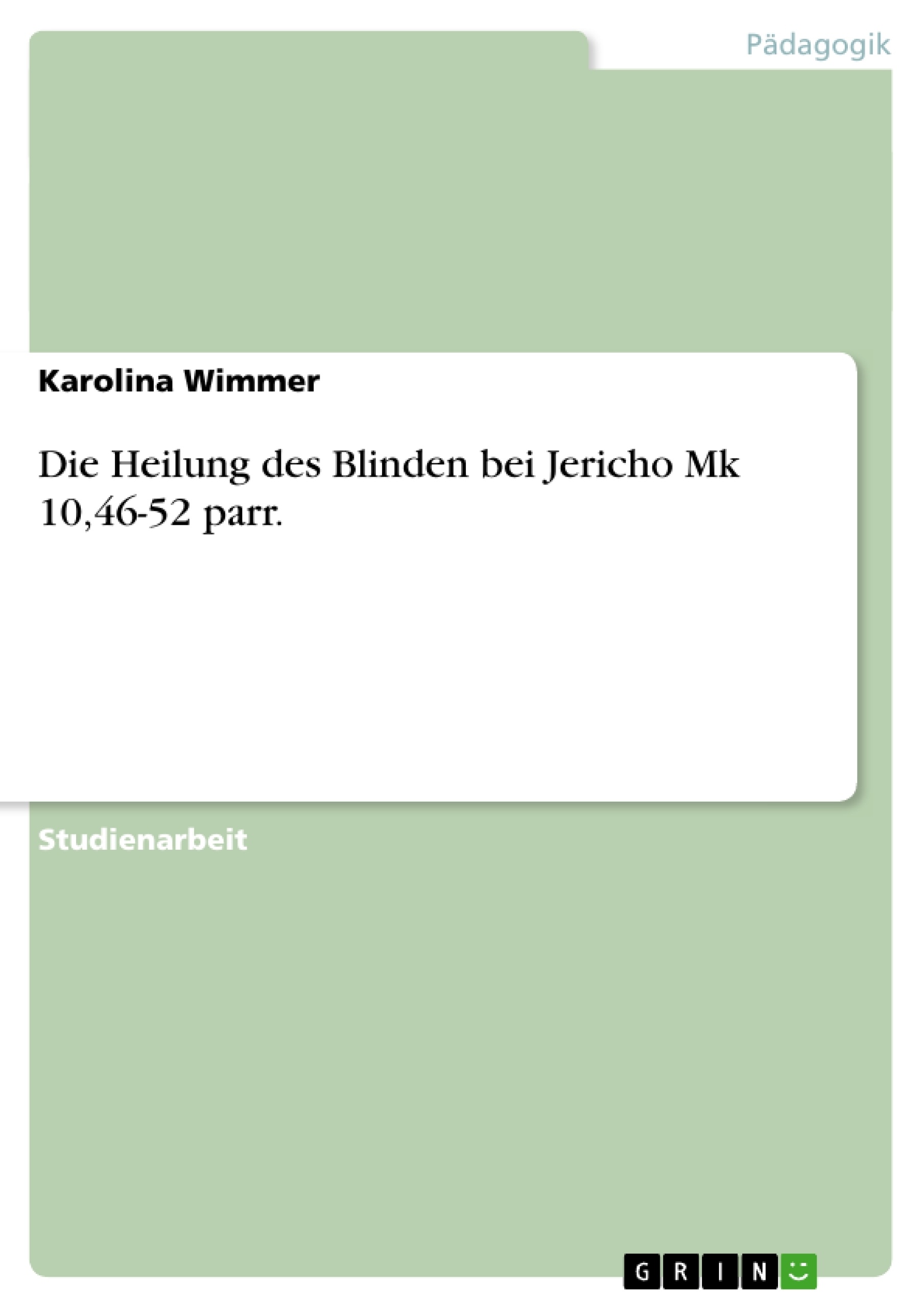1. Einleitung
Die Seminararbeit beschäftigt sich zunächst allgemein mit den Wundergeschichten in den Evangelien, mit dem zur Zeit der Evangelisten vorherrschenden Wunderverständnis und der damit zusammenhängenden Wunderterminologie.
Darauf aufbauend wird die Wundergeschichte des Blinden bei Jericho aus dem Markusevangelium analysiert und mit den entsprechenden Parallelen bei Matthäus und Lukas verglichen. Schließlich wird überlegt, wie man diese Thematik im Unterricht umsetzen könnte. Dies wird an zwei Beispielen aus dem Grundschulunterricht verdeutlicht.
2. Wundergeschichten in den Evangelien
2.1 verändertes Wunderverständnis
Ein großer Teil in den Evangelien sind Überlieferungen der Wunder Jesu.
Um einen ersten Einblick in die Wundergeschichten der Evangelisten zu bekommen, muss zwischen dem, was wir heute als Wunder bezeichnen und dem Wunderverständnis zur Zeit des neuen Testaments unterschieden werden.
Heute, in einer Zeit in der man versucht, alles durch die Naturwissenschaft zu erklären, wird ein Geschehen oft dann als Wunder bezeichnet, wenn ihm „[…] ohne Widerspruch zur Naturordnung das Moment des Überraschenden oder Erstaunlichen innewohnt.“ (Kollmann, 2002, S. 9)
Im Verständnis des Neuen Testaments hingegen spielt das Göttliche, das Übernatürliche bei der Erklärung von Wundern eine weitaus größere Rolle.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wundergeschichten in den Evangelien
- verändertes Wunderverständnis
- Wunderterminologie im Neuen Testament
- Exegese anhand einer Wundergeschichte „die Heilung eines Blinden“ Mk10,46-52
- Wundergeschichten im Markusevangelium
- Systematisierung
- Historische Beurteilung
- Aufbau und Inhalt
- Unterschiede des Wunders bei den Synoptikern
- Didaktische Umsetzungsmöglichkeiten
- Entwicklungspsychologische Voraussetzungen
- Unterrichtsgestaltung
- Eigene Bewertung
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Analyse von Wundergeschichten in den Evangelien, speziell der Heilung des Blinden bei Jericho aus dem Markusevangelium. Ziel ist es, das Wunderverständnis im Neuen Testament zu beleuchten, die Geschichte von Bartimäus zu untersuchen und deren didaktische Umsetzungsmöglichkeiten im Unterricht aufzuzeigen.
- Das Wunderverständnis im Neuen Testament im Vergleich zum modernen Verständnis.
- Die Wunderterminologie im Neuen Testament.
- Die Analyse der Wundergeschichte "Die Heilung des Blinden bei Jericho" im Markusevangelium.
- Didaktische Überlegungen zur Umsetzung der Wundergeschichte im Unterricht.
- Die Bedeutung der Wundergeschichten für die Interpretation des Lebens und Wirkens Jesu.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik der Seminararbeit vor und erläutert den Fokus auf Wundergeschichten in den Evangelien, insbesondere die Heilung des Blinden bei Jericho aus dem Markusevangelium.
Das zweite Kapitel befasst sich mit den Wundergeschichten in den Evangelien und beleuchtet das veränderte Wunderverständnis in der Zeit des Neuen Testaments im Vergleich zum modernen Verständnis. Des Weiteren werden wichtige Begriffe der Wunderterminologie im Neuen Testament erläutert.
Im dritten Kapitel wird die Wundergeschichte "Die Heilung des Blinden bei Jericho" aus dem Markusevangelium im Detail analysiert. Es werden die Besonderheiten der Wundergeschichten im Markusevangelium, die Systematisierung der Wundergeschichte, ihre historische Beurteilung sowie Aufbau und Inhalt beleuchtet.
Schlüsselwörter
Wundergeschichten, Evangelien, Wunderverständnis, Wunderterminologie, Heilung des Blinden, Markusevangelium, Bartimäus, didaktische Umsetzung, Unterricht, Entwicklungspsychologie.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in der Geschichte von Bartimäus?
Es handelt sich um die Heilung eines Blinden bei Jericho durch Jesus, wie sie in Mk 10,46-52 beschrieben wird.
Wie unterschied sich das Wunderverständnis der Antike von heute?
Heute sucht man oft naturwissenschaftliche Erklärungen, während im Neuen Testament das übernatürliche Wirken Gottes im Zentrum stand.
Was sind die Synoptiker?
Die Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas, deren Berichte viele Ähnlichkeiten aufweisen und parallel gelesen werden können.
Wie kann man Wundergeschichten im Unterricht umsetzen?
Die Arbeit schlägt didaktische Methoden für die Grundschule vor, die die Lebenswelt der Kinder und ihre entwicklungspsychologischen Voraussetzungen berücksichtigen.
Was bedeutet Wunderterminologie im Neuen Testament?
Es bezieht sich auf spezifische Begriffe wie „Machtzeichen“ oder „Wunder“, die die Bedeutung der Taten Jesu unterstreichen.
- Quote paper
- Karolina Wimmer (Author), 2006, Die Heilung des Blinden bei Jericho Mk 10,46-52 parr., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84412