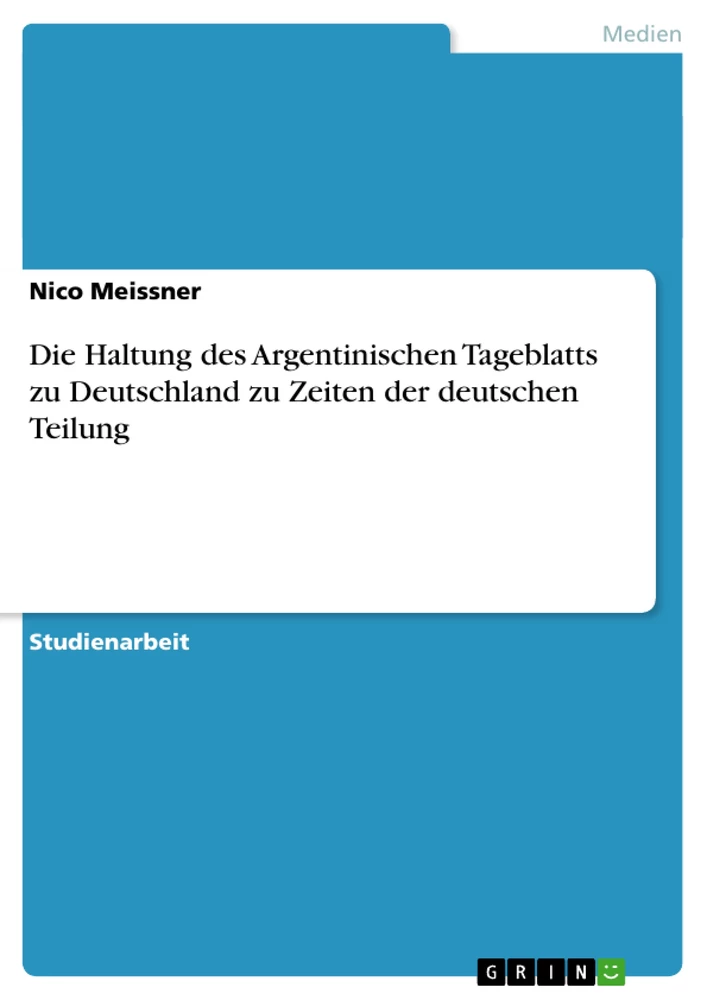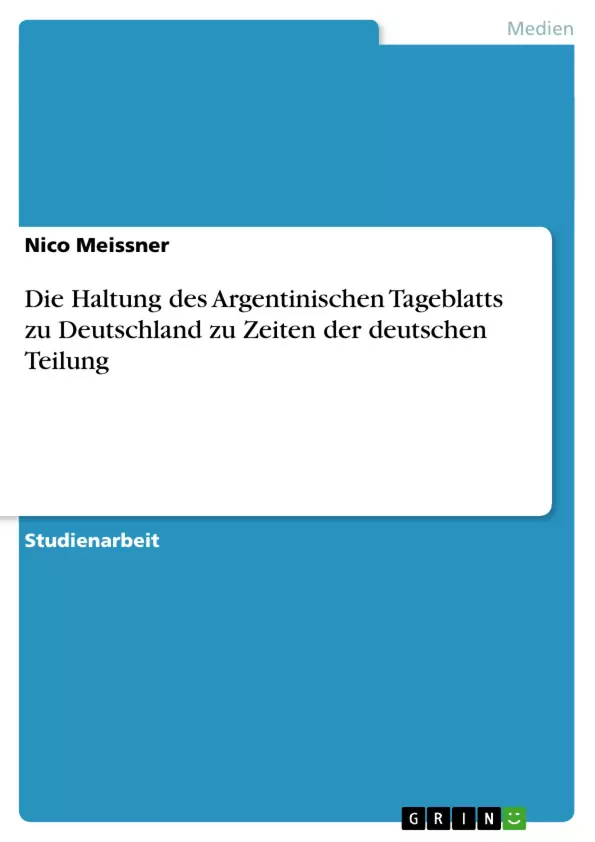Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Argentinischen Tageblatt. Sie versucht die Frage zu beantworten, wie sich das Argentinische Tageblatt während der Teilung Deutschlands positionierte und welche Haltung es zu verschiedenen Ereignissen hatte.
Als Quellen werden insbesondere die so genannten Randglossen des Argentinischen Tageblatts zitiert. Da in ihnen die tagespolitischen Ereignisse, oft zynisch, kommentiert und meist kritisiert wurden, eignen sie sich sehr gut, um die Haltung des Blattes zu erfahren und darzustellen. Im Nachrichtenteil hingegen verzichte das Argentinische Tageblatt, bis auf einige Überschriften, auf jegliche Wertung des Geschehens.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Entstehung des Argentinischen Tageblatts
- Während des Nationalsozialismus
- Die Zeit nach dem 2. Weltkrieg
- Die Zeit des Baus der Berliner Mauer
- Die Zeit der Wiedervereinigung
- Die Parteipräferenzen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Argentinischen Tageblatt und analysiert dessen Haltung zur deutschen Teilung. Sie beleuchtet die Entstehung des Blattes, seinen Kampf gegen den Nationalsozialismus sowie seine Positionierung während der verschiedenen Phasen der deutschen Teilung. Die Arbeit untersucht auch die Parteipräferenzen des Blattes, um seine politische Haltung zu verstehen.
- Die Entstehungsgeschichte des Argentinischen Tageblatts und seine Rolle als Sprachrohr der deutschsprachigen Bevölkerung Argentiniens
- Die Haltung des Argentinischen Tageblatts zum Nationalsozialismus und dessen Kritik an Hitler-Deutschland
- Die Positionierung des Argentinischen Tageblatts während der Teilung Deutschlands, einschließlich der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, des Mauerbaus und der Wiedervereinigung
- Die Parteipräferenzen des Argentinischen Tageblatts und die Bedeutung der politischen Haltung des Blattes
- Die Analyse der Randglossen des Argentinischen Tageblatts als Quelle für die Darstellung der Haltung des Blattes zu tagespolitischen Ereignissen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Forschungsfrage und die Struktur der Arbeit. Das Kapitel über die Entstehung des Argentinischen Tageblatts schildert die Gründung und Entwicklung des Blattes im 19. Jahrhundert und seine Rolle als Sprachrohr der deutschsprachigen Bevölkerung Argentiniens. Das Kapitel über den Nationalsozialismus beleuchtet die Haltung des Argentinischen Tageblatts zum Hitlerregime und dessen Kampf gegen den Nationalsozialismus. Das Kapitel über die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg untersucht die Positionierung des Argentinischen Tageblatts in Bezug auf die Wiedervereinigung Deutschlands und die Rolle des Blattes bei der Überwindung der deutschen Teilung. Die weiteren Kapitel befassen sich mit der Zeit des Mauerbaus, der Zeit der Wiedervereinigung und den Parteipräferenzen des Argentinischen Tageblatts.
Schlüsselwörter
Argentinisches Tageblatt, deutsche Teilung, Nationalsozialismus, deutschsprachige Emigration, politische Haltung, Parteipräferenzen, Randglossen, Nachrichtenteil, deutsche Einheit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Argentinische Tageblatt?
Es ist eine bedeutende deutschsprachige Zeitung in Argentinien, die im 19. Jahrhundert gegründet wurde und als wichtiges Sprachrohr der dortigen deutschsprachigen Bevölkerung fungierte.
Wie positionierte sich das Blatt zum Nationalsozialismus?
Das Argentinische Tageblatt nahm eine klare Haltung gegen den Nationalsozialismus ein und kritisierte Hitler-Deutschland bereits frühzeitig und massiv.
Welche Meinung vertrat das Blatt zur deutschen Teilung?
Die Arbeit analysiert die Haltung des Blattes zu Ereignissen wie dem Mauerbau und der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wobei die Überwindung der Teilung stets ein Thema war.
Was sind die "Randglossen" im Argentinischen Tageblatt?
In den Randglossen wurden tagespolitische Ereignisse oft zynisch kommentiert und kritisiert. Sie dienen als wichtige Quelle, um die eigentliche politische Haltung der Zeitung zu verstehen.
Hatte die Zeitung bestimmte Parteipräferenzen?
Ja, die Arbeit untersucht die politischen Präferenzen des Blattes, um dessen Einordnung im Spektrum der deutschen und argentinischen Politik zu verdeutlichen.
- Quote paper
- Nico Meissner (Author), 2002, Die Haltung des Argentinischen Tageblatts zu Deutschland zu Zeiten der deutschen Teilung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84454