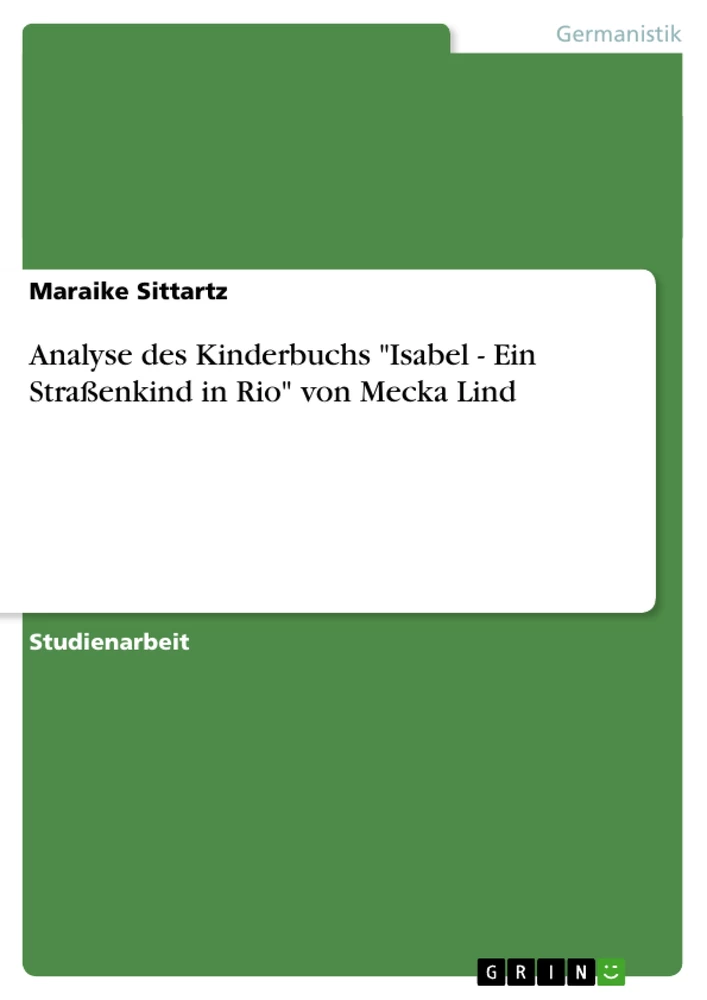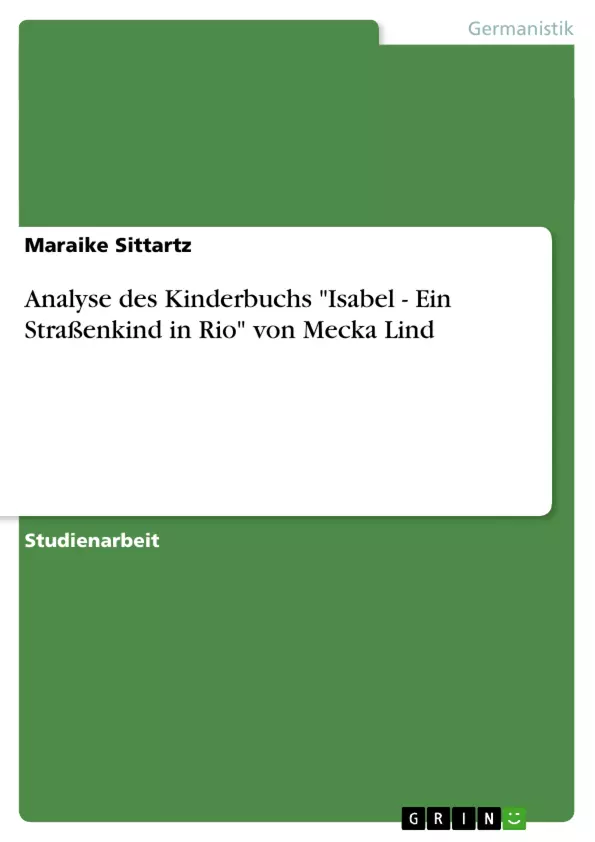Das Interesse der Öffentlichkeit für die Straßenkinderproblematik wuchs Anfang der 90er Jahre aufgrund vermehrter Medienberichte über die grausame Ermordung von Straßenkindern in Brasilien durch Todesschwadronen. Aus den Medien ist dieses Thema längst wieder verschwunden, wobei in den letzten zehn Jahren zahlreiche Kinder- und Jugendbücher zu diesem Thema verfasst wurden.
In meiner Hausarbeit werde ich zunächst Hintergrundinformationen über Brasilien, den Schauplatz des zu analysierenden Jugendbuches, geben. Im Anschluss folgt die Beschreibung der Gattung der Literatur, in die das Thema „Dritte Welt“ einzuordnen ist, bevor der Roman anhand ausgewählter Kriterien untersucht wird. Ziel ist es, bei der Betrachtung der inhaltlichen als auch der sprachlichen Aspekte zu hinterfragen und zu beurteilen, wie realistisch der Autor diese Thematik darstellt und welche Wirkung jeweils erzeugt wird. Wichtig scheint es mir dann, die Prinzipien interkultureller Erziehung in der Schule zu nennen und darzustellen, welche Funktion speziell Literatur in diesem Zusammenhang hat. Zum Abschluss folgt eine persönliche Bewertung des Buches unter Hinzunahme anderer Jugendbücher zu dieser Thematik.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Brasilien
- 1.1 Allgemeine Fakten
- 1.2 Massenelend/Sozialstrukturen
- 1.3 Straßenkinder
- 2. Gattung
- 3. Analyse des Buches
- 3.1 Biografie der Autorin
- 3.2 Inhalt
- 3.3 Inhaltliche Analyse
- 3.3.1 Realismus
- 3.3.2 Ursachendarstellung
- 3.3.3 Zukunftsperspektiven
- 3.4 Stilanalyse-Sprache/Form
- 3.4.1 Äußere Aufmachung
- 3.4.2 Struktur/Aufbau
- 3.4.3 Erzählperspektive
- 3.4.4 Handlungs-/Spannungsverlauf
- 3.4.5 Zeitstruktur
- 3.4.6 Figurenkonstellation
- 3.4.7 Sprache
- 3.4.8 AdressatInnenbezug/Rezeptionsanalyse
- 4. Schluss/Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert das Jugendbuch „Isabel - Ein Straßenkind in Rio“ von Mecka Lind und untersucht dessen Realismus sowie die erzeugte Wirkung auf den Leser. Im Fokus steht die Frage, wie die Autorin die Thematik der Straßenkinder in Brasilien darstellt und welche Prinzipien interkultureller Erziehung in diesem Kontext relevant sind.
- Die Lebensbedingungen und Herausforderungen von Straßenkindern in Brasilien
- Die Darstellung von Realismus und Fiktion in der Literatur
- Die Bedeutung von interkultureller Erziehung im Kontext von Kinder- und Jugendliteratur
- Die Rolle der Literatur im Hinblick auf das Bewusstsein für soziale Probleme
- Die Rezeption des Buches und seine mögliche Wirkung auf den Leser
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung erläutert das wachsende Interesse an der Problematik der Straßenkinder in Brasilien in den 1990er Jahren und stellt den Fokus der Hausarbeit vor. Kapitel 1 gibt allgemeine Informationen über Brasilien, einschließlich sozialer Ungleichheit und dem Problem der Straßenkinder. Kapitel 2 ordnet das Buch „Isabel - Ein Straßenkind in Rio“ der Gattung des problemorientierten Kinder- und Jugendbuchs zum Thema „Dritte Welt“ zu.
Kapitel 3 analysiert das Buch im Detail, beginnend mit der Biografie der Autorin und einer Inhaltsangabe. Die inhaltliche Analyse betrachtet den Realismus der Darstellung, die Ursachen für die Situation der Straßenkinder und die Zukunftsperspektiven. Die Stilanalyse umfasst verschiedene Aspekte wie die äußere Gestaltung, die Struktur, die Erzählperspektive, den Handlungsverlauf, die Zeitstruktur, die Figurenkonstellation, die Sprache und den AdressatInnenbezug.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen Straßenkinder, Brasilien, Kinder- und Jugendliteratur, Realismus, interkulturelle Erziehung, soziale Ungleichheit, problemorientierte Literatur, Dritte Welt, Rezeption und Wirkung.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in dem Buch „Isabel - Ein Straßenkind in Rio“?
Das Buch thematisiert das Schicksal und die Lebensbedingungen von Straßenkindern in Brasilien, insbesondere in Rio de Janeiro.
Wie realistisch stellt Mecka Lind die Thematik dar?
Die Hausarbeit analysiert kritisch, wie die Autorin Ursachen und Zukunftsperspektiven der Straßenkinder schildert und welche Wirkung dies auf die Leser hat.
Welche Rolle spielt Brasilien als Schauplatz?
Die Arbeit liefert Hintergrundinformationen zu den Sozialstrukturen und dem Massenelend in Brasilien, um den Kontext der Erzählung zu verdeutlichen.
Was ist das Ziel interkultureller Erziehung in diesem Zusammenhang?
Es soll aufgezeigt werden, wie problemorientierte Kinder- und Jugendliteratur dazu beitragen kann, das Bewusstsein für soziale Probleme der „Dritten Welt“ in Schulen zu schärfen.
Welche Aspekte umfasst die Stilanalyse des Buches?
Untersucht werden unter anderem die Erzählperspektive, der Spannungsverlauf, die Figurenkonstellation und die sprachliche Gestaltung.
Warum wurde das Thema der Straßenkinder in den 90er Jahren populär?
Aufgrund verstärkter Medienberichte über die Ermordung von Straßenkindern durch Todesschwadronen wuchs das öffentliche Interesse an dieser Problematik.
- Arbeit zitieren
- Maraike Sittartz (Autor:in), 2005, Analyse des Kinderbuchs "Isabel - Ein Straßenkind in Rio" von Mecka Lind, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84478