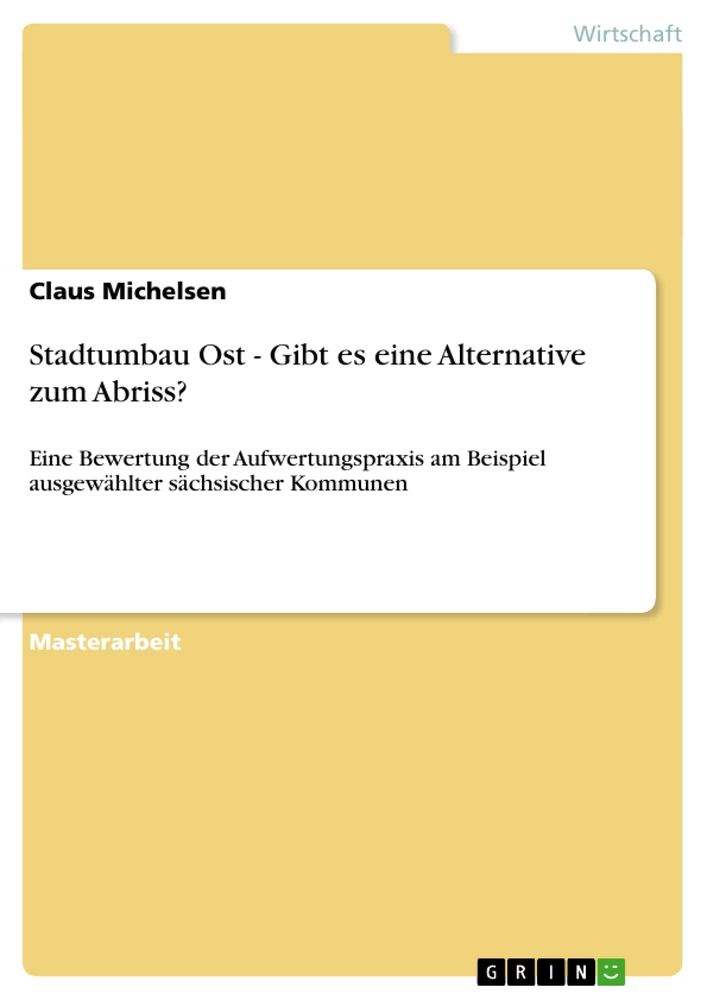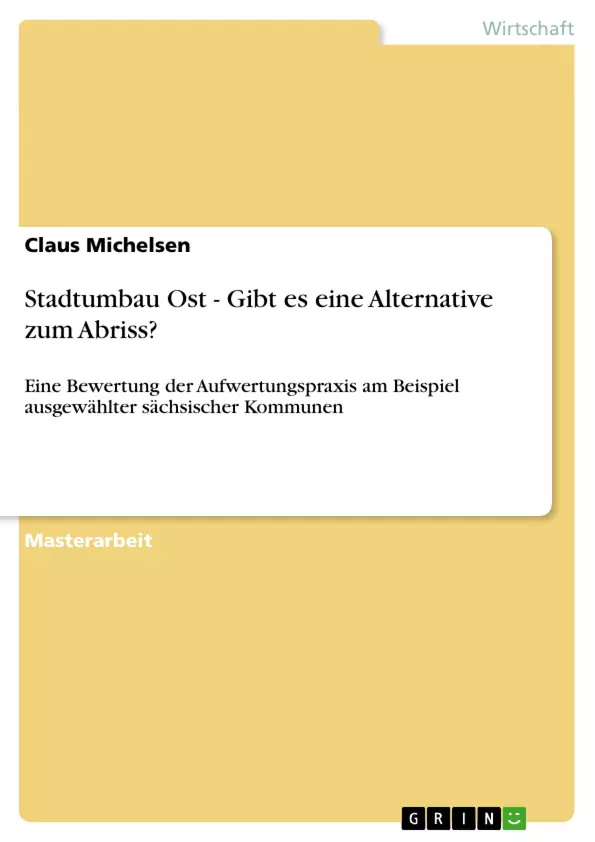Im Jahr 2000 gab es rund eine Million leerstehende Wohnungen in Ostdeutschland. Dies stellte die Kommission „Wohnungswirtschaftlicher Strukturwandel in den neuen Bundesländern“ fest und empfahl der Bundesregierung die Unterstützung eines flächenhaften Rückbaus von mindestens 350.000 Wohneinheiten.
Seit 2001 wird im Rahmen des Bund-Länder- Programms „Stadtumbau Ost“ die Umgestaltung der Städte bezuschusst. Neben einer Abrissförderung sind dabei auch Instrumente für die qualitative Aufwertung von Wohnquartieren vorgesehen. Die Überzeugung, den Problemen auf dem ostdeutschen Wohnungsmarkt mit einer Mengenreduktion des Angebotes zu begegnen, musste jedoch erst reifen. Noch 1994 war die damalige Bundesregierung davon überzeugt, die sich abzeichnenden Probleme vor allem in den Großwohnsiedlungen mit qualitativen Verbesserungen des Angebotes lösen zu können. Tatsächlich war der ostdeutsche Wohnungsmarkt zur Zeit der Wende durch große Knappheiten geprägt. Zwar war die Zahl der vorhandenen Wohnungen mehr als ausreichend, jedoch hatte vor allem die Qualität des Altbaubestandes aufgrund mangelnder Instandsetzung schwer gelitten. Großzügige Fördermaßnahmen für den Ausbau und die Modernisierung des Immobilienbestandes sollten diese Engpässe beseitigen. Im Ergebnis sind aktuell Leerstandsquoten von teilweise über 40% in einzelnen Vierteln ostdeutscher Städte zu registrieren. Neben einer starken staatlich induzierten Neubautätigkeit ist für viele Städte ein Rückgang der Wohnungsnachfrage zu beobachten.
Welche Alternativen stehen jedoch einem Rückbau gegenüber? Bisherige Erfahrungen mit lokaler Schrumpfung der Bevölkerung waren in erster Linie mit strukturellem Wandel verbunden. Hier konnten neben einer Ansiedlungspolitik für neue Industriezweige auch mit Instrumenten der Stadtsanierung Nachfragepotentiale zurückgewonnen werden. Aufwertungen des Immobilienbestandes und des Wohnumfeldes konnten unter Wachstumsbedingungen entsprechende Wirkungen entfalten. In den neuen Bundesländern ist jedoch mit einer anderen Qualität der Schrumpfung umzugehen. Hier gilt es, Strategien zu entwickeln, die den Folgen des demographischen Wandels begegnen. Neben Abwanderung und Suburbanisierung ist ein beträchtlicher Teil der städtischen Bevölkerungsverluste auf ein strukturelles Geburtendefizit zurückzuführen, das auch zukünftig insgesamt zu sinkenden Bevölkerungszahlen führen wird. Ob die bisherigen Stadtsanierungsstrategien hier greifen, ist fraglich.
Inhaltsverzeichnis
- VORWORT
- INHALTSVERZEICHNIS
- ABBILDUNGSVERZEICHNIS
- TABELLENVERZEICHNIS
- ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
- 1 EINLEITUNG
- 1.1 VORBEMERKUNGEN
- 1.2 FORSCHUNGSGEGENSTAND UND ZIELE
- 1.3 AUFBAU, METHODIK UND GRENZEN DER ARBEIT
- 1.4 DATENGRUNDLAGE, -QUALITÄT UND DATENSCHUTZ
- 1.5 AUSWAHL DER ZU UNTERSUCHENDEN KOMMUNEN
- 2 URSACHEN UND FOLGEN DES LEERSTANDES
- 2.1 ENTWICKLUNGEN AUF DEM SÄCHSISCHEN WOHNUNGSMARKT
- 2.1.1 Entwicklungen der Nachwendezeit
- 2.1.2 Zukünftige Entwicklungen
- 2.2 ENTWICKLUNGEN SÄCHSISCHER STÄDTEGRUPPEN IM VERGLEICH
- 2.2.1 Entwicklung der Nachfrage nach städtischem Wohnraum
- 2.2.2 Entwicklung des Wohnungsangebotes
- 2.3 ZWISCHENFAZIT: AUSMAB UND URSACHEN DES LEERSTANDES
- 2.4 FOLGEN DES LEERSTANDES UND DER SCHRUMPFUNG
- 2.4.1 Folgen des Angebotsüberhanges für die Wohnungswirtschaft
- 2.4.2 Externe Effekte des Wohnungsleerstandes
- 2.4.3 Schrumpfung und ihre Konsequenzen für die Effizienz städtischer Strukturen und deren Finanzierung
- 2.5 THEORIEN DER WOHNSTANDORTENTSCHEIDUNG
- 2.5.1 Gravitationsmodelle und makroökonomische Erklärungsansätze
- 2.5.2 Individuelle Entscheidungskalküle der Wohnstandortwahl
- 2.6 ZWISCHENFAZIT: LOKALE EINFLUSSMÖGLICHKEITEN
- 3 DAS PROGRAMM „STADTUMBAU OST“
- 3.1 DAS BUND LÄNDER – PROGRAMM,,STADTUMBAU OST“
- 3.1.1 Ziele
- 3.1.2 Förderinstrumente
- 3.1.3 Finanzielle Ausstattung
- 3.2 AUFWERTUNG ALS STRATEGIE DER SICHERUNG VON NACHFRAGEPOTENTIALEN IN STÄDTISCHEN WOHNQUARTIEREN
- 3.2.1 Empirische Befunde der Wohnstandortzufriedenheit und Wanderungsmotivationen
- 3.2.2 Instrumente der Aufwertung im Rahmen des Programms „Stadtumbau Ost\" im Einzelnen
- Exkurs:,,Gute Beispiele“ aus der Förderpraxis des Stadtumbaus
- 3.3 ZWISCHENFAZIT: POTENTIALE DER AUFWERTUNG IM RAHMEN DES PROGRAMMS,,STADTUMBAU OST“
- 4 BEWERTUNG DER AUFWERTUNGSPRAXIS SÄCHSISCHER STÄDTE
- 4.1 BEWERTUNG DER ALLGEMEINEN EFFIZIENZ
- 4.1.1 Kriterien der Effizienzbewertung im Einzelnen
- 4.1.2 Effizienzbewertung
- 4.1.3 Ergebnisse
- 4.2 BEWERTUNG DER EFFEKTIVITÄT
- 4.2.1 Allgemeine Effektivitätsanalyse – Bewertung der Mittelverteilung
- 4.2.1.1 Einschätzung der Aufwertungspotentiale
- 4.2.1.2 Ergebnisse der allgemeinen Effektivitätsanalyse
- 4.2.2 Bewertung der Mittelverwendung
- 4.2.2.1 Methodischer Aufbau und Kriterien der Bewertung
- 4.2.2.2 Ergebnisse der Effektivitätsbewertung verfügbarer Aufwertungsmaßnahmen
- 4.2.2.3 Bewertung der realisierten Mittelverwendung in den Städtetypen
- 4.2.2.4 Aufwertungsstädte
- 4.2.2.4 Wohnstädte
- 4.2.2.4 Rückbaustädte
- 4.3 ZWISCHENFAZIT: EFFIZIENZ UND EFFEKTIVITÄT DER FÖRDERUNG
- FAZIT
- LITERATURVERZEICHNIS
- ANHANGI – ABBILDUNGEN UND DARSTELLUNGEN
- ANHANG II - DATENTABELLEN
- Ursachen und Folgen des Leerstandes in Sachsen
- Das Programm „Stadtumbau Ost“ und seine Förderinstrumente
- Bewertung der Effizienz und Effektivität der Aufwertungspraxis
- Analyse der Mittelverwendung und ihrer Auswirkungen auf die Städtetypen
- Zusammenhang zwischen Aufwertung, Schrumpfung und Nachfragesicherung
- Kapitel 1: Einführung
- Erläutert den Forschungsgegenstand, die Ziele und den Aufbau der Arbeit.
- Definiert den Begriff "Stadtumbau Ost" und stellt die Relevanz des Themas heraus.
- Beschreibt die Methodik und die Grenzen der Arbeit.
- Kapitel 2: Ursachen und Folgen des Leerstandes
- Analysiert die Entwicklung des sächsischen Wohnungsmarktes nach der Wiedervereinigung.
- Vergleicht die Entwicklungen sächsischer Städtegruppen in Bezug auf Nachfrage und Angebot.
- Beschreibt die Folgen des Leerstandes und der Schrumpfung für die Wohnungswirtschaft und städtische Strukturen.
- Stellt verschiedene Theorien der Wohnstandortentscheidung vor.
- Kapitel 3: Das Programm „Stadtumbau Ost“
- Beschreibt die Ziele und Förderinstrumente des Programms „Stadtumbau Ost“.
- Erörtert die Bedeutung der Aufwertung als Strategie zur Sicherung von Nachfragepotentialen.
- Stellt empirische Befunde zur Wohnstandortzufriedenheit und Wanderungsmotivationen dar.
- Präsentiert Beispiele aus der Förderpraxis des Stadtumbaus.
- Kapitel 4: Bewertung der Aufwertungspraxis sächsischer Städte
- Bewertet die allgemeine Effizienz des Programms „Stadtumbau Ost“ anhand definierter Kriterien.
- Analysiert die Effektivität der Mittelverteilung und -verwendung.
- Untersucht die Auswirkungen der realisierten Aufwertungsmaßnahmen auf verschiedene Städtetypen.
- Zieht Zwischenfaziten zur Effizienz und Effektivität der Förderung.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Aufwertungspraxis im Rahmen des Programms „Stadtumbau Ost“ anhand ausgewählter sächsischer Kommunen. Ziel ist es, die Effizienz und Effektivität des Programms im Hinblick auf die Bewältigung des Leerstandes und der Schrumpfung in Ostdeutschland zu bewerten.
Zusammenfassung der Kapitel
Schlüsselwörter
Stadtumbau Ost, Leerstand, Schrumpfung, Aufwertung, Effizienz, Effektivität, Förderinstrumente, Wohnungsmarkt, Stadtentwicklung, Sachsen, Städtetypen, Nachfragesicherung, Wohnstandortentscheidung.
- Citation du texte
- Master of Science Claus Michelsen (Auteur), 2007, Stadtumbau Ost - Gibt es eine Alternative zum Abriss?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84492