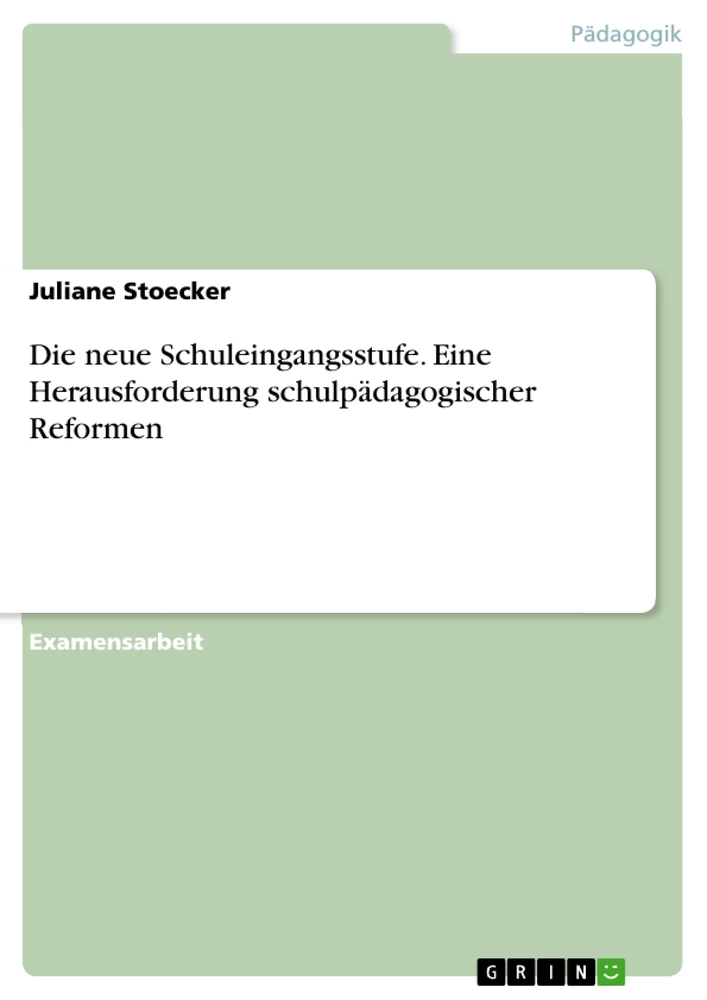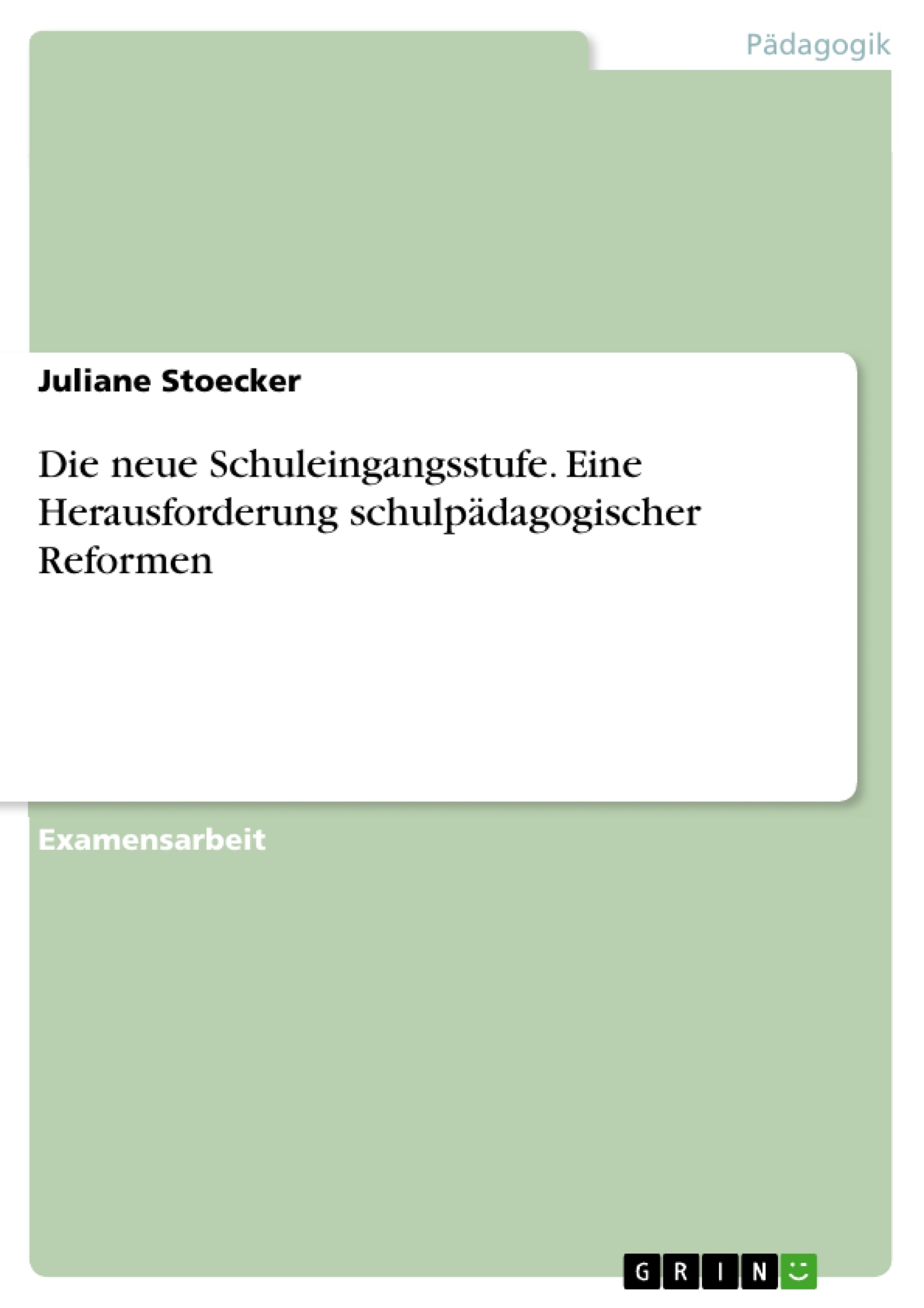„Die neue Schuleingangsstufe – eine Herausforderung schulpädagogischer Reform“ ist das Thema meiner Arbeit.
In den vergangenen Jahren ist das deutsche Bildungssystem zunehmend kritisiert worden. Ausgelöst haben die Diskussionen die Ergebnisse der in den Jahren 2000 und 2003 durchgeführten weltweit größten Schulleistungsuntersuchung „PISA“. In beiden Tests erzielte Deutschland als eines der führenden Länder in Europa jedoch überraschender Weise nur unzureichende Ergebnisse. „Das deutsche Bildungssystem hat versagt: Es ist ungerecht und produziert Mittelmaß“ (ZEIT). Daraufhin wurden in der Politik, sowie in der Gesellschaft Stimmen laut, welche eine Reformierung des Schulsystems forderten. Schnell wurde klar, dass die Ursachen im Bildungssystem zu suchen sind, welches nicht rechtzeitig auf die Veränderungen in der Gesellschaft reagiert hat. Kinder wachsen heut zu Tage in immer unterschiedlicheren Lebensbedingungen auf. Dem zu Folge steigt die Heterogenität in den kindlichen Entwicklungs- und Lernvoraussetzungen.
Deutschland muss nun reagieren wenn sie den Anschluss an die Sieger des Pisatests nicht verlieren möchte. Wie kann man nun aber diese „Bildungsmisere“ hinter sich lassen? Sollte man vielleicht die in Deutschland herrschende Unterrichtsform die Jahrgangsklasse noch einmal hinsichtlich ihrer Effektivität prüfen?
Der Heterogenität der Lernvoraussetzungen, Begabungen und Entwicklungen der Kinder kann in den Jahrgangsklassen nicht genügend Rechnung getragen werden.
Schon seit Ende des 19. Jahrhunderts wurde in der Reformpädagogik die Sinnhaftigkeit des jahrgangsbezogenen Unterrichts in Frage gestellt. Maria Montessori und Peter Petersen waren dabei die Reformpädagogen die dem altersgemischten Unterricht eine besondere Bedeutung zuwiesen. Noch heute kann man die Konzepte der beiden Pädagogen als Wegweiser für die Bildung jahrgangsübergreifender Lerngruppen betrachten. Sollten nun diese reformpädagogischen Ansätze genutzt werden um Deutschland aus der „Bildungskrise“ zu verhalfen, mit dem Ziel, den Bildungsauftrag voll zu erfüllen, so dass jedem Schüler die optimalen Startbedingungen mitgegeben werden können?
Mit dieser Herausforderung befasse ich mich nun in dieser Arbeit. Schafft es die neue Schuleingangsstufe Deutschland aus der Bildungsmisere zu helfen? Ich glaube schon.
Inhaltsverzeichnis
- A Einleitung
- 1. Die historische Entwicklung der Grundschule
- 2. Die veränderte Rolle des Kindergartens
- 2.1 Der Übergang vom Kindergarten in die Grundschule
- 2.2 Kooperation von Kindergarten, Grundschule und Elternhaus
- 2.3 Das Einschulungsverfahren
- 2.3.1 Die Schulanmeldung
- 2.4 Schulreife – Schulfähigkeit
- 2.4.1 Das Kieler Einschulungsverfahren
- 2.4.2 Der ökosystemische Ansatz nach Nickel
- 2.5 Der Anfangsunterricht
- 2.5.1 Pädagogische Prinzipien
- 2.5.2 Offene Unterrichtsformen im Anfangsunterricht
- 3. Die neue Schuleingangsstufe – die aktuellste Reform der Institution Schule
- 3.1 Bildungspolitische Überlegungen zur Gestaltung der flexiblen Schuleingangsphase
- 3.2 Aufgaben des Kindergartens im Hinblick auf die flexible Schuleingangsphase
- 3.2.1 Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule
- 3.3 Das Schulanmeldeverfahren
- 3.3.1 Zeitpunkt der Schulanmeldung
- 3.3.2 Das Anmeldegespräch
- 3.3.3 Sprachstandserhebung
- Verfahren 4: CITO - Test Zweisprachigkeit
- 3.4 Kriterien der pädagogischen Arbeit in der Schuleingangsstufe
- 3.4.1 Aufnahme aller Kinder ohne Zurückstellung
- 3.4.2 Vorzeitige Schulaufnahme
- 3.4.3 Flexibler Aufnahmetermin
- 3.4.4 Flexible Verweildauer in der Schuleingangsstufe
- 3.4.5 Jahrgangsübergreifender Klassen - Jahrgangsübergreifender Unterricht
- 3.5 Formen der Differenzierung in der flexiblen Schuleingangsphase
- 3.5.1 Äußere Differenzierung
- 3.5.2 Innere Differenzierung
- 3.6 Heterogenität und Förderdiagnostik in der neuen Schuleingangsstufe
- 3.6.1 Förderdiagnostik für langsam und schneller lernende Kinder
- 4. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die neue Schuleingangsstufe in Nordrhein-Westfalen als Reaktion auf die Herausforderungen schulpädagogischer Reformen. Die Zielsetzung ist es, die bildungspolitischen Überlegungen hinter der Reform zu beleuchten und deren praktische Umsetzung zu analysieren.
- Die historische Entwicklung der Grundschule in Deutschland.
- Die veränderte Rolle des Kindergartens in der Schulvorbereitung.
- Die bildungspolitischen Ziele der flexiblen Schuleingangsphase.
- Die Umsetzung der flexiblen Schuleingangsphase in der Praxis (jahrgangsübergreifender Unterricht, Differenzierung).
- Die Bedeutung von Förderdiagnostik und individueller Förderung.
Zusammenfassung der Kapitel
A Einleitung: Die Arbeit untersucht die neue Schuleingangsstufe als Reaktion auf die Kritik am deutschen Bildungssystem nach den PISA-Studien. Sie analysiert die historischen Entwicklungen der Grundschule, die veränderte Rolle des Kindergartens und die Herausforderungen der flexiblen Schuleingangsphase, um die Frage zu beantworten, ob diese Reform zur Verbesserung der Bildungssituation beitragen kann. Die Arbeit verspricht eine eingehende Betrachtung der bildungspolitischen Überlegungen und der praktischen Umsetzung des Modells. 1. Die historische Entwicklung der Grundschule: Dieses Kapitel zeichnet einen umfassenden Überblick über die Entwicklung der deutschen Grundschule von ihrer Gründung 1919 bis zur aktuellen Reform der Schuleingangsphase nach. Es beleuchtet die Reformansätze der Weimarer Republik, die Unterbrechung durch den Nationalsozialismus und die Nachkriegszeit, die Bedeutung des Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungswesen und des Deutschen Bildungsrates, sowie die zunehmende Betonung von Chancengleichheit und individueller Förderung. Die Entwicklungen zeigen einen Wandel vom rein kulturtechnischen Unterricht hin zu kindgemäßen Bildungsansätzen. Die immer wiederkehrenden Forderungen nach flexibleren Strukturen und individueller Förderung bilden den Hintergrund der heutigen Reform. 2. Die veränderte Rolle des Kindergartens: Dieses Kapitel beschreibt die wachsende Bedeutung des Kindergartens als Bildungseinrichtung in der Vorbereitung auf den Schulbeginn. Es betont die Zusammenarbeit mit der Grundschule und den Eltern, die gemeinsame Gestaltung des Übergangs und die steigenden Anforderungen an die frühkindliche Sprachförderung, insbesondere im Hinblick auf die Heterogenität der Kinder. Die Kooperation mit den Eltern und die frühzeitige Erkennung von Sprachförderbedarf werden als Schlüssel zum Erfolg eines kindgerechten Schulanfangs dargestellt. 3. Die neue Schuleingangsstufe – die aktuellste Reform der Institution Schule: Dieses Kapitel befasst sich detailliert mit der neuen Schuleingangsstufe in Nordrhein-Westfalen. Es analysiert die bildungspolitischen Überlegungen zur flexiblen Schuleingangsphase, die Aufgaben des Kindergartens in diesem Kontext, das Anmeldeverfahren mit der Sprachstandserhebung, und die Kriterien der pädagogischen Arbeit in der Schuleingangsstufe. Die Kapitel beleuchten die Aufnahme aller Kinder ohne Zurückstellung, die flexible Verweildauer, den jahrgangsübergreifenden Unterricht, verschiedene Differenzierungsformen, und die Rolle der Förderdiagnostik.
Schlüsselwörter
Schuleingangsstufe, flexible Schuleingangsphase, Jahrgangsübergreifender Unterricht, Individuelle Förderung, Differenzierung, Förderdiagnostik, Heterogenität, Kooperation Kindergarten/Grundschule, Schulfähigkeit, Sprachförderung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur neuen Schuleingangsstufe in Nordrhein-Westfalen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die neue Schuleingangsstufe in Nordrhein-Westfalen. Sie untersucht die bildungspolitischen Hintergründe der Reform, deren praktische Umsetzung und die Herausforderungen, die sich daraus ergeben.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit umfasst die historische Entwicklung der Grundschule, die veränderte Rolle des Kindergartens bei der Schulvorbereitung, die bildungspolitischen Ziele der flexiblen Schuleingangsphase, die praktische Umsetzung (jahrgangsübergreifender Unterricht, Differenzierung), die Bedeutung von Förderdiagnostik und individueller Förderung sowie die Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, drei Hauptkapitel und eine Zusammenfassung. Kapitel 1 behandelt die historische Entwicklung der Grundschule. Kapitel 2 fokussiert die veränderte Rolle des Kindergartens. Kapitel 3 analysiert detailliert die neue Schuleingangsstufe, einschließlich des Anmeldeverfahrens, der pädagogischen Arbeit und der Differenzierungsformen. Die Zusammenfassung fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen.
Welche Aspekte der neuen Schuleingangsstufe werden besonders hervorgehoben?
Besonderes Augenmerk liegt auf der flexiblen Gestaltung der Schuleingangsphase, dem jahrgangsübergreifenden Unterricht, der individuellen Förderung, der Förderdiagnostik, der Heterogenität der Kinder und der Kooperation zwischen Kindergarten und Grundschule. Die Aufnahme aller Kinder ohne Zurückstellung und die flexible Verweildauer in der Schuleingangsstufe werden ebenfalls detailliert behandelt.
Was sind die wichtigsten bildungspolitischen Ziele der Reform?
Die Reform zielt darauf ab, die Bildungssituation zu verbessern, indem sie auf die Herausforderungen reagiert, die sich aus den PISA-Studien und der Kritik am deutschen Bildungssystem ergeben haben. Im Fokus stehen Chancengleichheit, individuelle Förderung und flexible Strukturen, die auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen.
Welche Rolle spielt der Kindergarten in der neuen Schuleingangsstufe?
Der Kindergarten spielt eine immer wichtigere Rolle in der Schulvorbereitung. Die Zusammenarbeit mit der Grundschule und den Eltern, die gemeinsame Gestaltung des Übergangs und die frühkindliche Sprachförderung werden als entscheidend für einen erfolgreichen Schulanfang angesehen.
Wie wird die Heterogenität der Kinder berücksichtigt?
Die Heterogenität der Kinder wird durch verschiedene Differenzierungsformen (äußere und innere Differenzierung) und Förderdiagnostik berücksichtigt, um sowohl langsam als auch schnell lernende Kinder optimal zu fördern.
Welche Methoden der Differenzierung werden eingesetzt?
Die Arbeit beschreibt sowohl äußere als auch innere Differenzierung als Methoden, um auf die unterschiedlichen Lernbedürfnisse der Kinder einzugehen. Jahrgangsübergreifender Unterricht wird als ein Beispiel für äußere Differenzierung genannt.
Welche Rolle spielt die Förderdiagnostik?
Die Förderdiagnostik spielt eine zentrale Rolle, um die individuellen Lernbedürfnisse der Kinder zu erkennen und entsprechende Fördermaßnahmen einzuleiten. Dies gilt sowohl für langsam als auch schnell lernende Kinder.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schuleingangsstufe, flexible Schuleingangsphase, jahrgangsübergreifender Unterricht, individuelle Förderung, Differenzierung, Förderdiagnostik, Heterogenität, Kooperation Kindergarten/Grundschule, Schulfähigkeit, Sprachförderung.
- Arbeit zitieren
- Juliane Stoecker (Autor:in), 2007, Die neue Schuleingangsstufe. Eine Herausforderung schulpädagogischer Reformen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84510