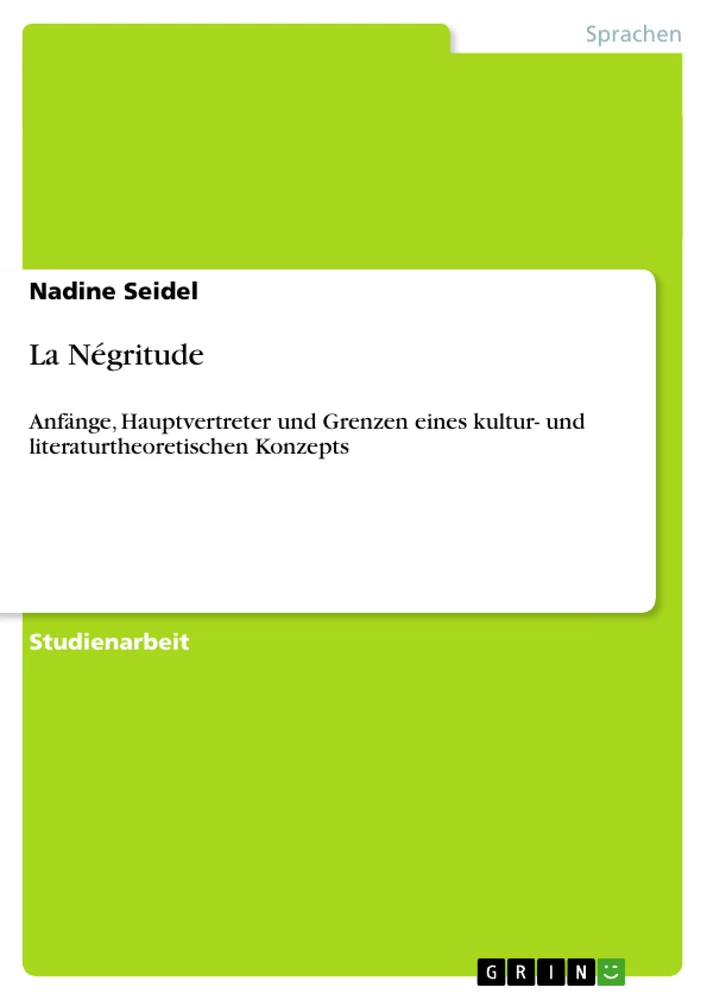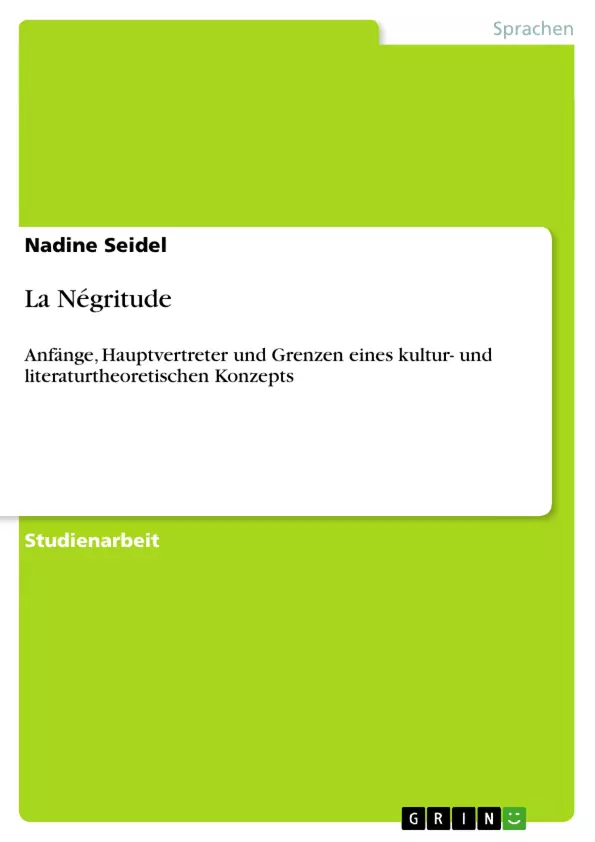Wenn man vom Suffix –(i)tude ausgeht, durch das Abstrakta aus Adjektiven abgeleitet werden, die Zustände oder Eigenschaften beschreiben, heißt Négritude nichts anderes als Schwarzheit, Schwarzsein. Die Négritude als kultur- und literaturtheoretisches Konzept wiederum thematisiert die Probleme und Besonderheiten, die dieses Schwarzsein ausmachen.
Für Césaire bedeutete die Négritude „ la simple reconnaissance du fait d’être noir, et l’acceptation de ce fait, de notre destin de Noir, de notre histoire et de notre culture. " Andere sehen darin einen Sammelbegriff für „schwarze Literatur“ , wobei dies kritisch betrachtet werden muss, wenn damit eine Einheit jeglicher schwarzer Poesie gemeint sein soll. Wie HEINRICHS in „Sprich deine eigene Sprache, Afrika!“ feststellt, divergiert allein schon der Stellenwert, den Literatur in den einzelnen afrikanischen Gesellschaften einnimmt. Während manche Länder, wie der Senegal oder auch die Antillen, über eine sehr hohe Autorendichte, Gattungs- und Stilvielfalt verfügen, spielt Literatur in anderen Gegenden nur eine sehr geringe Rolle.
Im Laufe der Jahrzehnte wurde der Begriff der Négritude für einen personengebundenen Kult und eine Ideologie politisch verwertet und seine Schöpfer selbst, vor allem Aimé Césaire, der ihn als erster prägte, begannen sich zu distanzieren. Nichtsdestotrotz bleibt unumstritten, wie wichtig die Bewegung für die Entwicklung des Selbstbewusstseins Afrikas war, auch wenn sie in sich nicht einheitlich war und ihre Hauptvertreter selbst unterschiedliche Auffassungen davon hatten. Auch für die schwarzafrikanische Literatur im Allgemeinen stellt die Négritude einen wichtigen Reibungspunkt dar, denn unabhängig davon, ob die Autoren Fürsprecher oder Gegner dieses Konzepts waren, so haben sich doch zumindest alle damit auseinandergesetzt, um zu einem eigenen Selbstverständnis zu gelangen. Der Négritude kommt also vielmehr eine initiatorische als eine programmatische Bedeutung zu und ihre Begründer sahen in ihr nicht mehr und nicht weniger als ein spontanes Projekt mit dem dringenden Ziel einer Selbstbewusstwerdung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Aufbau der Arbeit
- Die Entstehung der Négritude
- Hauptvertreter
- Aimé Césaire
- Léopold Sédar Senghor
- Léon-Gontran Damas
- Problemfelder, Grenzen und Weiterentwicklungen der Négritude
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit dem kultur- und literaturtheoretischen Konzept der Négritude, das im Zuge der Dekolonisation in den 1930er Jahren entstand. Sie analysiert die Anfänge der Bewegung und die wichtigsten Vertreter, darunter Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor und Léon-Gontran Damas. Darüber hinaus werden Problemfelder und Grenzen des Konzepts beleuchtet, die letztlich zu seiner Ablösung durch andere Konzepte führten.
- Die Entstehung der Négritude im Kontext der Dekolonisation
- Die Hauptvertreter der Bewegung und ihre unterschiedlichen Begriffsdeutungen
- Die politische und literarische Bedeutung der Négritude
- Die Kritik an den Grenzen und Einschränkungen des Konzepts
- Die Weiterentwicklung der Négritude und ihr Einfluss auf die Schwarzafrikanische Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung und Aufbau der Arbeit
Die Einleitung definiert den Begriff Négritude als „Schwarzheit, Schwarzsein“ und beschreibt die Bedeutung des Konzepts für die Erforschung von Problemen und Besonderheiten des Schwarzseins. Sie erläutert die Ziele und den Aufbau der Arbeit, wobei die Anfänge der Bewegung, ihre Hauptvertreter und die Grenzen des Konzepts im Fokus stehen.
Die Entstehung der Négritude
Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehungszeit des Konzepts der Négritude in den 1930er Jahren in Paris. Es beschreibt den Kontext der Dekolonisation und den Zusammentreffen schwarzer, frankophoner Intellektueller, die sich mit Stolz ihrer afrikanischen Wurzeln erinnerten. Es werden die Beweggründe und Einflüsse auf die Entstehung der Bewegung beleuchtet, wie die Harlem Renaissance und die Schriften von Leo Frobenius. Außerdem wird die Zeitschrift „L'étudiant noir“ und ihre Rolle bei der Verbreitung des Konzepts der Négritude hervorgehoben.
Hauptvertreter
Dieses Kapitel konzentriert sich auf die drei wichtigsten Vertreter der Négritude: Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor und Léon-Gontran Damas. Es wird ihre unterschiedlichen Auffassungen der Négritude dargestellt und die Bedeutung ihrer literarischen Werke für die Bewegung herausgestellt. Durch die Analyse von ausgewählten Gedichten sollen die unterschiedlichen Begriffsdeutungen und Schreibstile der Autoren verdeutlicht werden.
Schlüsselwörter
Négritude, Dekolonisation, Schwarze Literatur, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Léon-Gontran Damas, „L'étudiant noir“, Harlem Renaissance, Leo Frobenius, Rassismus, Eurozentrismus, Selbstbewusstsein, Identitätssuche, politische und literarische Bedeutung.
- Quote paper
- Nadine Seidel (Author), 2007, La Négritude, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84848