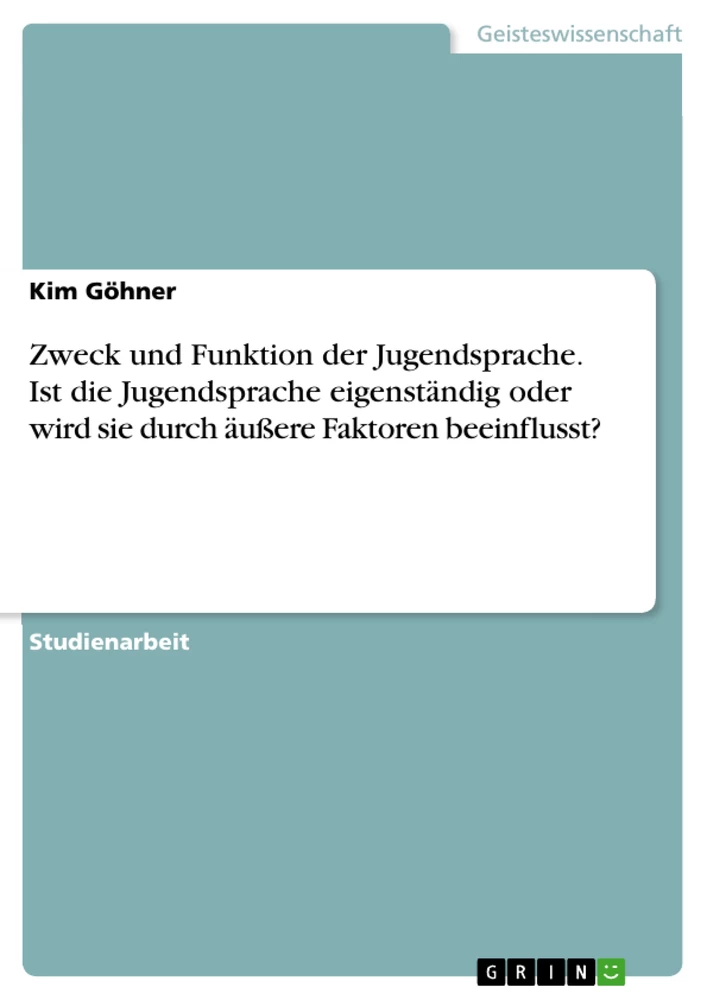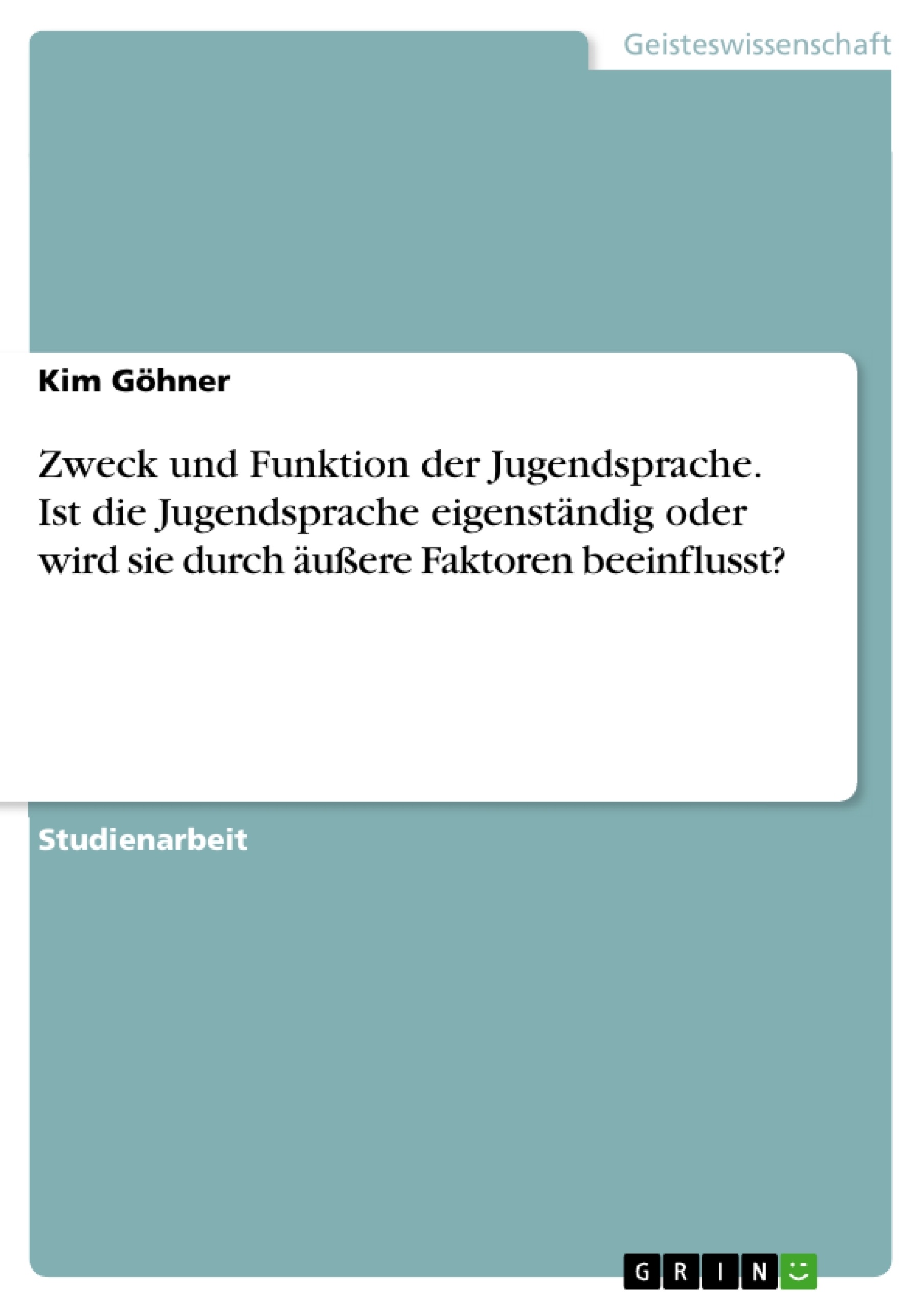Als ich vor einiger Zeit ein Gespräch zwischen zwei männlichen Jugendlichen im hiesigen Jugendhaus verfolgte, faszinierte mich deren Sprache so sehr, dass ich mich in meiner Hausarbeit, aus dem Gebiet der Soziologie der Lebensalter, mit dem Thema Jugendsprache beschäftigen wollte.
Der eine Jugendliche zeigte dem anderen seine neuen fetten Schuhe, die er sich in Stuggi rausgelassen hatte und zog einen Flyer aus seiner Tasche. Am Wochenende sei eine fette Jam mit Mc B, der sei echt geil. Der andere schien nicht so begeistert zu sein, denn er meinte Mc B sei doch ohne Ende wack und hätte kein Plan wie man richtig dicke Mucke macht, und außerdem hätte er da keine Zeit, weil er da mit seiner Crew taggen gehen wollte.
Solch ein Gesprächsauszug stellt keineswegs eine Ausnahme dar. In meiner Arbeit mit Jugendlichen im Heimbereich und in meiner Freizeit werde ich täglich mit dieser speziellen Sprache der Jugend konfrontiert.
Aufgrund dieses Gesprächsauszuges ist es auch kaum verwunderlich wenn Jugendsprache von Erwachsenen als sprachliche Schlamperei oder gar als Sprachverhunzung gesehen wird. Doch was steckt dahinter, warum braucht die Jugend überhaupt eine eigene Sprache? Was will die Jugend durch ihre Sondersprache bezwecken? Ist die Jugendsprache eigenständig oder wird sie durch äußerliche Faktoren beeinflusst?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffserklärung
- 2.1 Jugend
- 2.2 Jugendsprache
- 3. Beispiele für Jugendsprache
- 4. Welche Funktionen erfüllt die Jugendsprache?
- 4.1 Warum spricht die Jugend anders?
- 4.2 Betrachtungsweise der Jugendsprache
- 4.2.1 Aus der Sicht der Abgrenzung
- 4.2.2 Aus der Sicht der Authentizität
- 4.2.3 Aus der Sicht des Protests
- 4.2.4 Aus der Sicht der besseren Verständigung
- 4.2.5 Aus der Sicht der Innovation und des Spiels
- 4.2.6 Aus der Sicht des Aggressionsabbaus
- 4.2.7 Aus der Sicht der Unsicherheit
- 5. Die jugendsprachliche Ausdrucksfunktion
- 5.1 Der Intergenerationsdialog
- 5.2 Jugendsprache in ihren drei Kommunikationsebenen
- 5.2.1 Die Peer - Group
- 5.2.2 Die subkulturelle Gruppe
- 5.2.3 Die Großgruppe Jugend
- 5.3 Die Entwicklungsaufgaben im Jugendalter
- 6. Jugendsprache als Gruppenerlebnis
- 7. Stilausbreitung und Stilaneignung jugendlicher Teilkulturen
- 8. Äußerliche Einflussfaktoren der Jugendsprache
- 8.1 Medien/Werbung
- 8.2 Fach- und Sondersprachen
- 8.3 Fremdsprachen
- 8.4 Dialekte
- 9. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Phänomen der Jugendsprache und untersucht die sozialen, kulturellen und sprachlichen Aspekte dieser besonderen Form der Kommunikation. Die Arbeit beleuchtet die Hintergründe der Verwendung von Jugendsprache und untersucht, welche Funktionen sie für Jugendliche erfüllt.
- Die Entstehung und Entwicklung der Jugendsprache
- Die Funktionen von Jugendsprache, insbesondere in Bezug auf Abgrenzung, Authentizität und Identitätsfindung
- Der Einfluss von Medien, Werbung und anderen Faktoren auf die Jugendsprache
- Die Rolle der Jugendsprache im Intergenerationsdialog
- Die Entwicklung der Jugendsprache im Kontext von verschiedenen Jugendkulturen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema und stellt die Motivation der Autorin dar. Im zweiten Kapitel werden die Begriffe "Jugend" und "Jugendsprache" definiert. Anschließend werden konkrete Beispiele für Jugendsprache vorgestellt und die verschiedenen Funktionen, die sie für Jugendliche erfüllt, analysiert. Die Kapitel 5 und 6 befassen sich mit der Ausdrucksfunktion der Jugendsprache im Kontext von Peer-Groups, subkulturellen Gruppen und der Großgruppe "Jugend". Der Einfluss von äußeren Faktoren, wie Medien und Werbung, auf die Jugendsprache wird in Kapitel 8 beleuchtet.
Schlüsselwörter
Jugendsprache, Soziologie, Lebensalter, Kommunikation, Intergenerationsdialog, Identität, Abgrenzung, Authentizität, Medien, Werbung, Jugendkultur, Sprache, Sprachwandel
- Citar trabajo
- Kim Göhner (Autor), 2002, Zweck und Funktion der Jugendsprache. Ist die Jugendsprache eigenständig oder wird sie durch äußere Faktoren beeinflusst?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8491