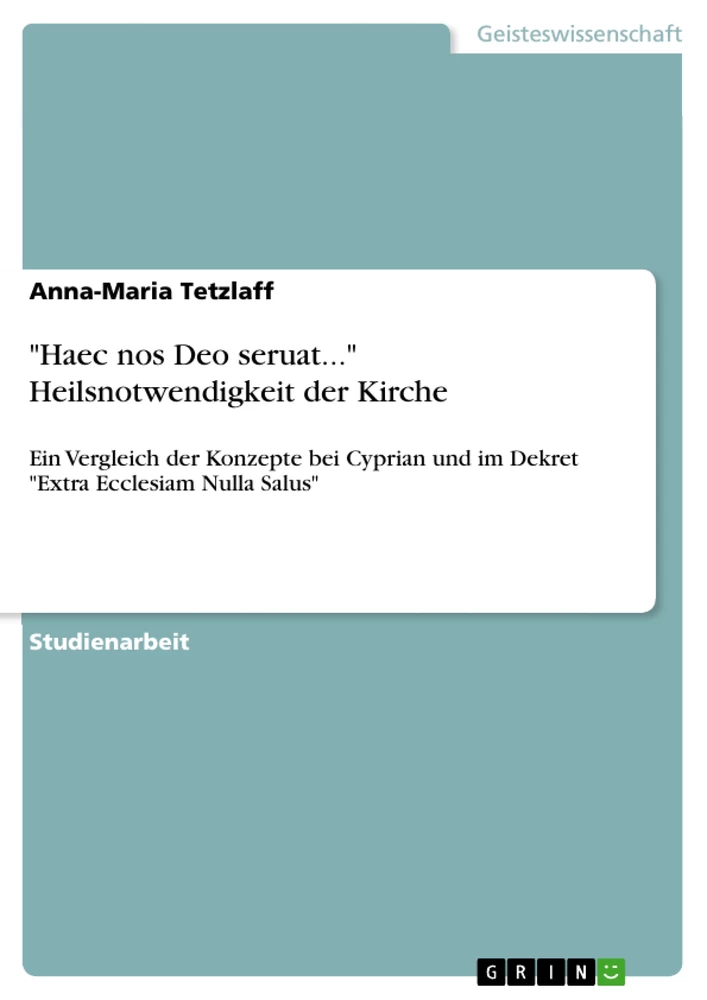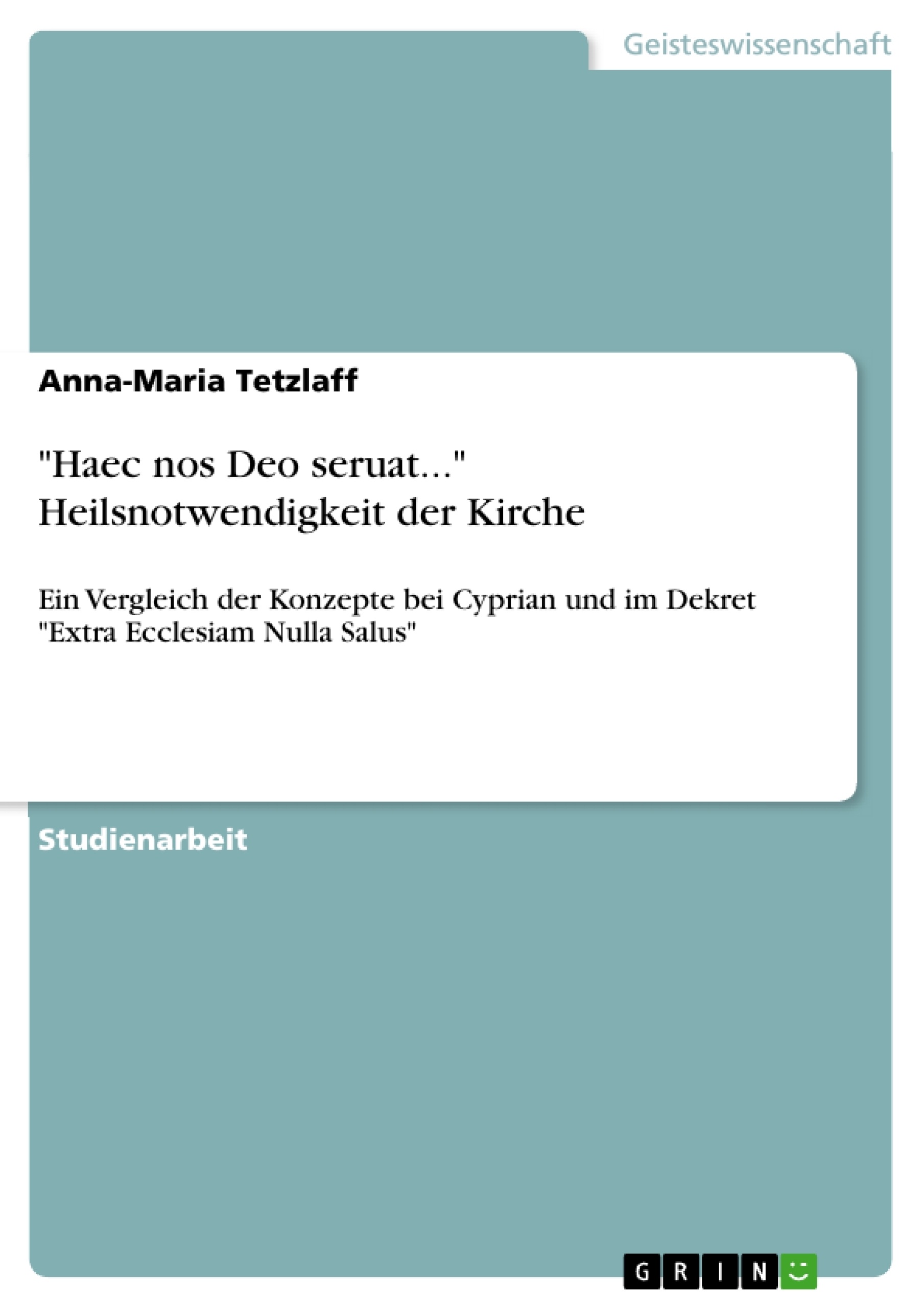Diese Behauptung stellte der Kirchenvater und Bischof von Karthago Cyprian in einem seiner Briefe im Zuge des Ketzertaufstreits 253 n. Chr. auf, um die Heilsnotwendigkeit der Kirche zu verdeutlichen. Auf ähnliche Weise tat dies auch Origenes ungefähr zur gleichen Zeit in dem Gebiet der oströmischen Kirche: „Extra honc domum, id est extra ecclesiam, nemo salvatur.“ Mit der Zeit verfestigten sich diese Aussagen zu dem Lehrsatz der katholischen Kirche: „Extra Ecclesiam nulla salus“ über Augustin3, der maßgeblich Einfluss auf die Lehre der mittelalterlich-katholischen Kirche nahm, bis hin zur Bulle Bonifaz` VIII. „Unam Sanctam“ von 1302. Würde dieser heute so exklusiv gedeutet, wie er klingt und wie er lange ausgelegt worden ist5, so könnten am Ende nur knapp zwanzig Prozent der Weltbevölkerung gerettet werden. Die Frage danach, wie eine Institution wie die katholische Kirche mit dieser Tatsache umgeht beziehungsweise umgangen ist, ist an dieser Stelle sicher berechtigt. Um diese zu beantworten ist es wichtig, die Vorstellung, wie sie sich im dritten Jahrhundert gebildet hat, darzustellen. Wie also ist das Fundament gestaltet, auf dem sich das „Extra...“-Axiom gründen konnte? Ist es wirklich so exklusiv, wie es über lange Zeit rezipiert wurde? Wodurch wurde es beeinflusst? Im Vergleich dazu ist zu betrachten, ob sich die römische Kirche in einer sich verändernden Gesellschaft gebührend mit dem Lehrsatz auseinandergesetzt hat. Wie also hat sich die Deutung des Axioms entwickelt, hat sie sich verändert? Wenn ja, wie und warum?
Für die Beantwortung dieser Fragestellungen eignet sich ein Vergleich von zwei Quellen aus den betreffenden Zeiten. In Cyprians Schrift „De Ecclesiae Catholicae Vnitate“ kommt durchgängig, besonders im sechsten Kapitel, der Gedanke von der Heilsnotwendigkeit der Kirche zum Tragen.
Inhaltsverzeichnis
- I. EINLEITUNG – „EXTRA ECCLESIAM NULLA SALUS“
- II. VORBETRACHTUNGEN
- 1. EINZELDARSTELLUNGEN – CYPRIAN UND PIUS XII.
- A. Cyprian, Bischof von Karthago
- B. Papst Pius XII.
- 2. FORSCHUNGSÜBERBLICK
- III. DIE HEILSNOTWENDIGKEIT DER KIRCHE
- 1. VERGLEICH DER KONZEPTE VON DER HEILSNOTWENDIGKEIT
- A. Das Heil
- B. Der Weg zum Heil
- a. Über die Einheit der Kirche bei Cyprian
- b. Über die Unterordnung unter Kirche und Papst
- C. Die Wirkung des Heils
- a. Abgestufte Zugehörigkeit nach Pius XII.
- b. Reelle Zugehörigkeit bei Cyprian
- D. Eine Veränderung des Verständnisses?
- 2. HINTERGRÜNDE
- A. Die Weite der Welt zu Zeiten Cyprians
- B. Inkonsequente Exklusivität bei Cyprian
- C. Die Entwicklung des voti impliciti
- D. Die diplomatische Tätigkeit Pius' XII.
- 1. VERGLEICH DER KONZEPTE VON DER HEILSNOTWENDIGKEIT
- IV. SCHLUSS – „HAEC NOS DEO SERVAT...“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, wie die Heilsnotwendigkeit der Kirche im 3. Jahrhundert durch Cyprian und im 20. Jahrhundert durch Pius XII. verstanden wurde. Der Vergleich soll aufzeigen, ob sich die Sichtweise auf die Heilsnotwendigkeit im Laufe der Geschichte verändert hat.
- Heilsnotwendigkeit der Kirche
- Vergleich der Konzepte bei Cyprian und Pius XII.
- Entwicklung des Verständnisses der Heilsnotwendigkeit
- Einheit der Kirche
- Zugehörigkeit zur Kirche
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Ausgangspunkt der Arbeit dar und erläutert das zentrale Thema: „Extra Ecclesiam nulla salus“. Die Vorbetrachtungen liefern einen historischen Hintergrund zu Cyprian und Pius XII. sowie einen Forschungsüberblick. Im Hauptteil wird ein Vergleich der Konzepte von der Heilsnotwendigkeit bei Cyprian und Pius XII. vorgenommen, wobei insbesondere die Themen Heil, Weg zum Heil, Wirkung des Heils und die Entwicklung des Verständnisses beleuchtet werden. Die Hintergründe für die jeweilige Sichtweise werden im Anschluss analysiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe der Arbeit sind: Heilsnotwendigkeit, Kirche, Cyprian, Pius XII., „Extra Ecclesiam nulla salus“, Einheit, Zugehörigkeit, Geschichte, Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet das Axiom "Extra Ecclesiam nulla salus"?
Es bedeutet "Außerhalb der Kirche kein Heil" und beschreibt die traditionelle Lehre von der Heilsnotwendigkeit der katholischen Kirche für die Rettung des Menschen.
Wie verstand Cyprian von Karthago die Einheit der Kirche?
Für Cyprian im 3. Jahrhundert war die sichtbare Einheit der Kirche die Voraussetzung für das Heil; wer sich von der Kirche trennte, verlor den Zugang zu Gott.
Wie wandelte sich die Deutung des Axioms unter Papst Pius XII.?
Pius XII. entwickelte ein differenzierteres Verständnis (voti impliciti), das auch eine abgestufte Zugehörigkeit zur Kirche ermöglichte, ohne die Exklusivität völlig aufzugeben.
Warum wurde die Heilsnotwendigkeit im Laufe der Zeit weniger exklusiv gedeutet?
Die Kirche musste sich einer verändernden, globalisierten Gesellschaft stellen, in der ein rein exklusives Verständnis nur einen Bruchteil der Menschheit einschließen würde.
Welchen Einfluss hatte Augustinus auf diese Lehre?
Augustinus festigte den Lehrsatz maßgeblich und beeinflusste damit die mittelalterliche Theologie bis hin zur Bulle "Unam Sanctam" von 1302.
- Quote paper
- Anna-Maria Tetzlaff (Author), 2006, "Haec nos Deo seruat..." Heilsnotwendigkeit der Kirche, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/84974