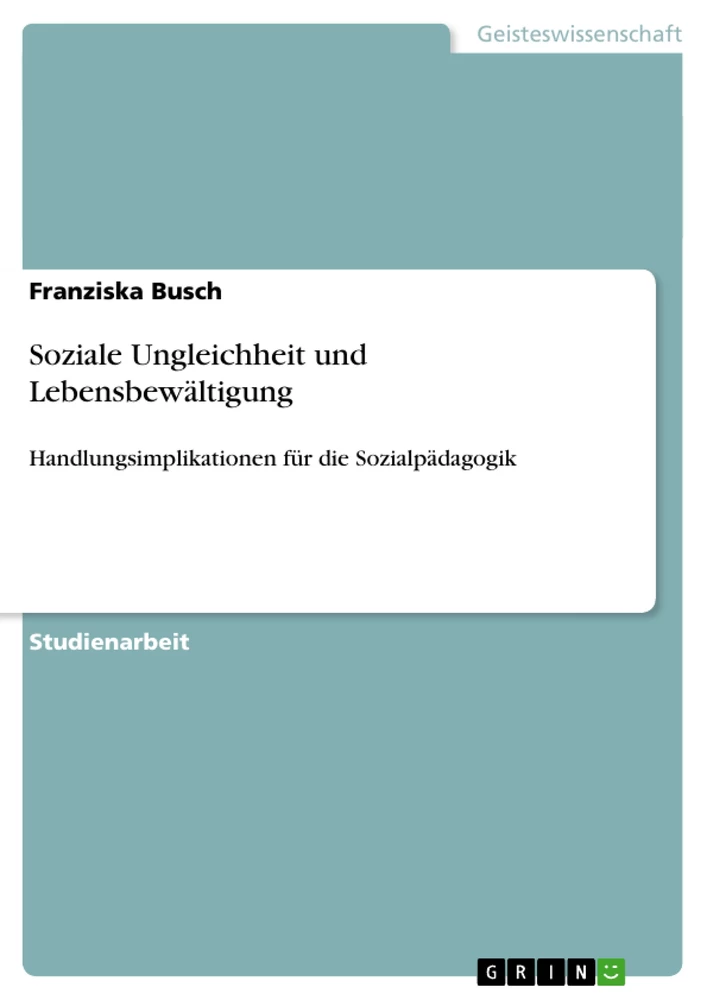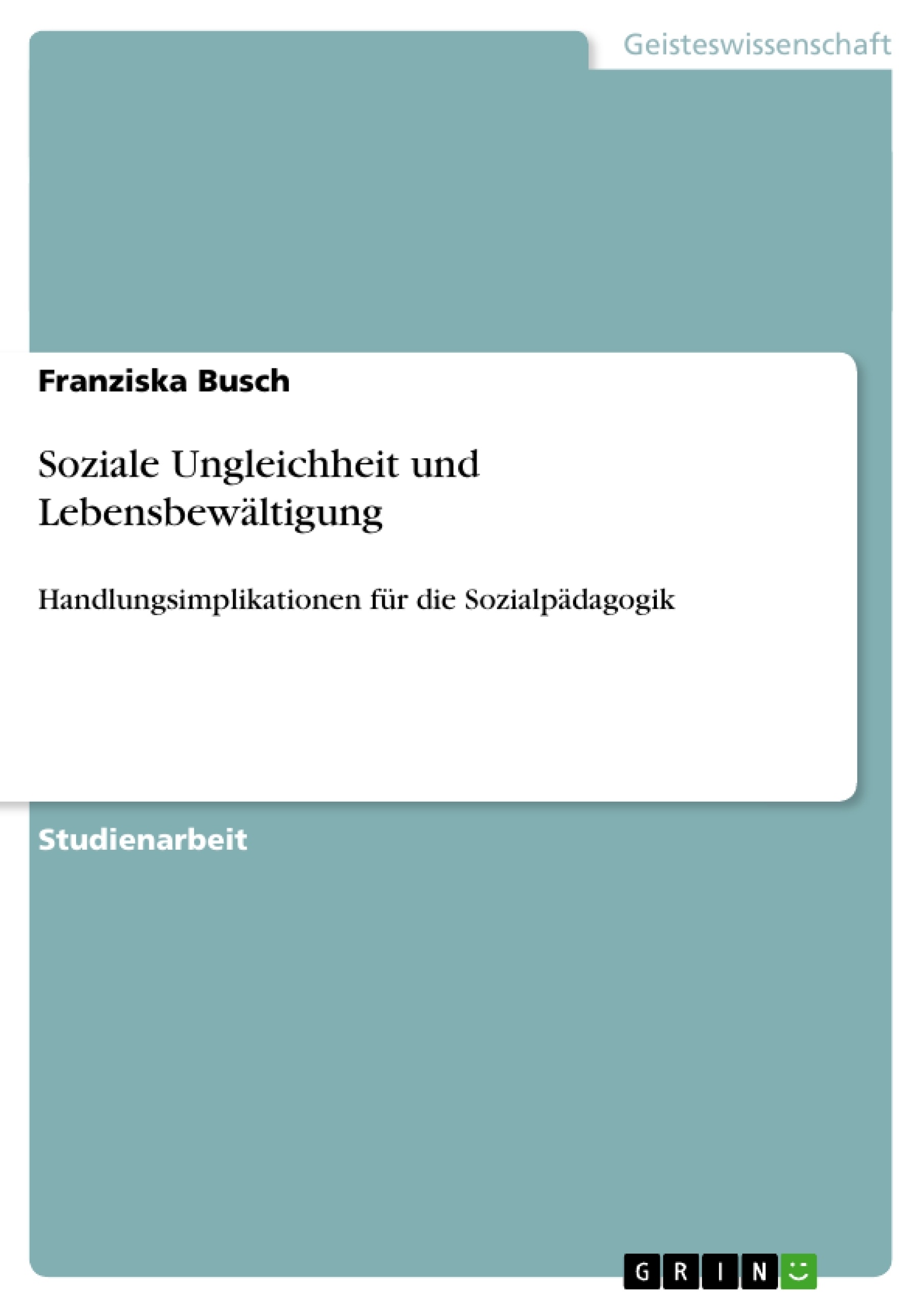Während in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts der wirtschaftliche Erfolg und damit verbundene Reichtum zu einem im internationalen Vergleich sehr guten System sozialer Sicherung führte, ist die heutige Tendenz der sozialpolitische Rückzug des Staates. Als Ursache hierfür können die Ölkrise und erste Rationalisierungstendenzen in den 1970er Jahren genannt werden. Verschärft wurden die Rationalisierungstendenzen durch das zunehmende Problem der Massen- und Langzeitarbeitslosigkeit (Schneider 1996, S. 174). Es entwickelte sich ein neues Leitmotiv der Politik: Verzicht und die damit einhergehende Favorisierung von Privatheit und Eigenvorsorge sowie die Idealisierung des Leistungsideals(ebd., S. 175). Leistung wurde zur moralischen Größe, zur Voraussetzung für den Anspruch auf soziale Gerechtigkeit, d.h. ohne Leistung (ohne Arbeit) keine soziale Gerechtigkeit und keine sozialen Leistungen (ebd., S. 181). „Die Sozialpolitik ist in diesen Zeiten die Fortschreibung überkommener Strukturen und Haushaltspositionen“, innerhalb der soziale Probleme auf haushaltspolitische Aspekte verkürzt werden und auf politisch aktive Gestaltung verzichtet wird (ebd., S. 176). An die Stelle des aktiven Sozialstaats tritt ein „aktivierender, die Hilfebedürftigen nicht mehr ohne entsprechende Gegenleistung alimentierender Sozialstaat“ (Butterwegge 2004, S. 594). Es gilt das Motto: „Fördern und fordern!“, wobei man sich nach Butterwegge nicht darum bemüht, die Chancen von sozial Benachteiligten zu verbessern (ebd., S. 594), so dass neue Ungerechtigkeiten entstehen (Opielka 2003, S. 545). „Eine an dieser sozialen Gerechtigkeit orientierte Sozial- und Gesellschaftspolitik wird zur Sicherung von Privilegien für Privilegierte“ (Schneider 1996, S. 179). Das heißt, das Sozialstaatsprinzip wurde zugunsten einer „neoliberalistischen Gesellschaft der Einzelkämpfer“ aufgegeben (Opielka 2003, S. 175). Dieses Verständnis von Sozialstaat hat nach Schneider verheerende Auswirkungen, da es in Anbetracht der Arbeitsmarktsituation nicht jedem Individuum möglich ist, Leistung zu erbringen. Somit führt der Sozialstaat im neoliberalistischen Sinne zur Spaltung der Gesellschaft (Schneider 1996, S. 182f.).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Bourdieu und soziale Ungleichheit
- Begriffsklärung: Soziale Ungleichheit
- Bourdieu's Habitustheorie
- Ökonomisches Kapital
- Kulturelles Kapital
- Soziales Kapital
- Das Konzept der Lebensbewältigung
- Exkurs: Zum Verhältnis von Sozialpädagogik und Sozialpolitik nach Böhnisch
- Handlungsimplikationen für die Sozialpädagogik
- Handlungsimplikationen auf individueller Ebene
- Empowerment
- Milieubildung
- Handlungsimplikationen auf gesellschaftlicher, politischer Ebene
- Empowerment: institutionelle Ebene
- Die Verantwortung der Sozialen Arbeit für die Gestaltung des Sozialen
- Zusammenfassung und Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Entstehung und den Folgen sozialer Ungleichheit und ihren Handlungsimplikationen für die Sozialpädagogik. Sie analysiert die Ursachen für die Zunahme sozialer Ungleichheit im Kontext des neoliberalen Staatsverständnisses und beleuchtet die Möglichkeiten der Sozialpädagogik zur Bewältigung und Reduzierung dieser Problematik sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene.
- Soziale Ungleichheit im Kontext des Neoliberalismus
- Die Habitustheorie von Pierre Bourdieu als Erklärungsmodell für soziale Ungleichheit
- Das Konzept der Lebensbewältigung im Umgang mit sozialer Ungleichheit
- Handlungsmöglichkeiten der Sozialpädagogik zur Förderung von Empowerment und Milieubildung
- Die Rolle der Sozialen Arbeit bei der Gestaltung des Sozialen und der Eindämmung sozialer Ungleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den aktuellen Stand der Sozialpolitik und die Folgen des neoliberalen Staatsverständnisses für die Sozialpädagogik. Sie stellt die Relevanz des Themas soziale Ungleichheit und Lebensbewältigung dar. Das zweite Kapitel analysiert die Entstehung sozialer Ungleichheit anhand der Habitustheorie von Pierre Bourdieu. Es werden die verschiedenen Kapitalformen, insbesondere das ökonomische, kulturelle und soziale Kapital, sowie deren Einfluss auf die soziale Positionierung von Individuen erläutert. Kapitel drei widmet sich dem Konzept der Lebensbewältigung, das die Bewältigungsstrategien von Menschen in schwierigen Lebenslagen betrachtet.
Der Exkurs in Kapitel vier beleuchtet das Verhältnis zwischen Sozialpädagogik und Sozialpolitik nach Böhnisch und stellt dessen Bedeutung für die weitere Analyse der Handlungsimplikationen dar. Das fünfte Kapitel widmet sich den Handlungsimplikationen für die Sozialpädagogik, die sich sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene aufbauen. Die Handlungsempfehlungen zielen auf eine Stärkung von Empowerment und Milieubildung sowie die Gestaltung des Sozialen im Sinne einer bedarfsgerechten Politik.
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, Neoliberalismus, Habitustheorie, Pierre Bourdieu, Lebensbewältigung, Sozialpädagogik, Sozialpolitik, Handlungsimplikationen, Empowerment, Milieubildung, soziale Gerechtigkeit, strukturelle Ungleichheit.
- Quote paper
- Franziska Busch (Author), 2006, Soziale Ungleichheit und Lebensbewältigung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85001