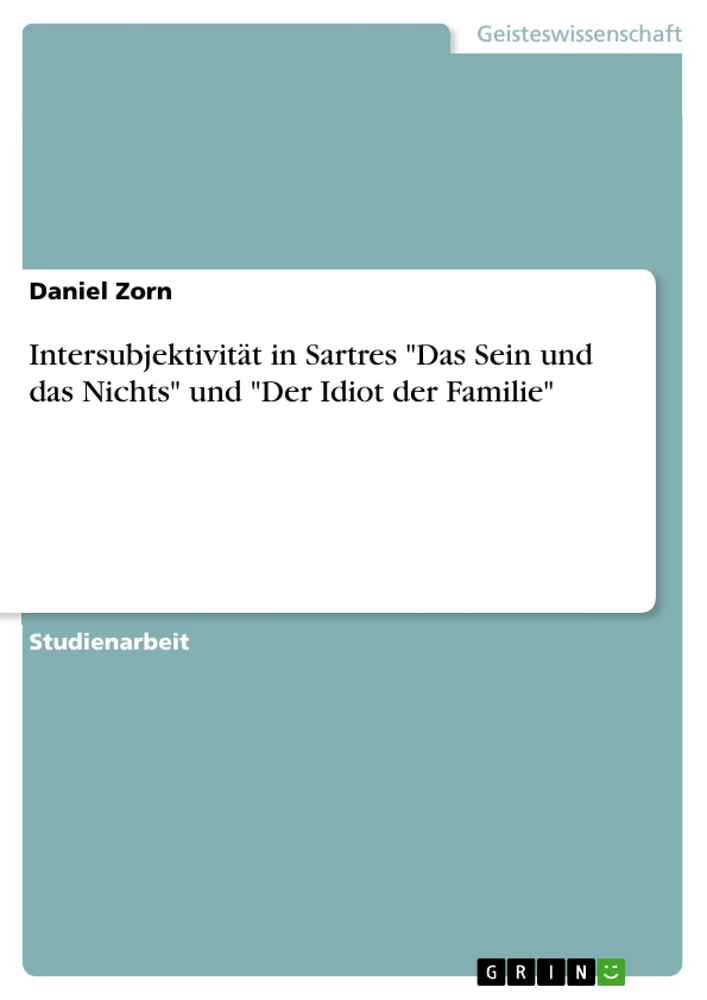Die vorliegende Arbeit will, grob ausgedrückt, Theorie und Anwendung der Sozialphilosophie Sartres – im Rahmen einer Theorie der Intersubjektivität – anhand zweier ausgewählter Teile untersuchen. So befasse ich mich im ersten Teil mit der berühmten phänomenologischen Untersuchung des Blicks in Sartres erstem Hauptwerk Das Sein und das Nichts , wobei ich zunächst in knapper Weise die wesentlichen Haltestellen der Argumentation darstellen will, um dann die sozialphilosophischen Implikationen betreffend eine Theorie der Intersubjektivität zusammenzufassen.
Obwohl es sich im Kontext sozialphilosophischer Untersuchungen anbieten würde, im Anschluss die Kritik der dialektischen Vernunft zu behandeln, da sie als Sartres genuin sozialphilosophisches Werk gilt, werde ich die Ergebnisse meiner ersten Untersuchung stattdessen auf Sartres „Alterswerk“, in diesem Falle seine Flaubertstudie Der Idiot der Familie , anwenden. Da eine Untersuchung, die auch nur annähernd dem gewaltigen qualitativen und auch quantitativen Umfang gerecht zu werden versucht, fast zum Scheitern verurteilt ist, jedenfalls aber den Rahmen dieser Arbeit sprengen würde, will ich mich auf ausgewählte Aspekte aus dem ersten Band der deutschen Ausgabe beschränken. Ziel meiner Untersuchung soll sein, die ausgewählten Teile miteinander zu vergleichen. Dabei soll geklärt werden, ob das Verhältnis der Schriften zueinander eher als Spannungsverhältnis zweier verschiedener Intersubjektivitätskonzepte verstanden werden muss, oder ob sich im Gegenteil die Darstellung in Der Idiot der Familie auf die grundlegenden sozialphilosophischen Implikationen in dem Blick-Kapitel aus Das Sein und das Nichts gründen lässt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Intersubjektivität in Das Sein und das Nichts
- 1. Hinführung: Grundgedanken in Das Sein und das Nichts.
- 2. Sartres Voruntersuchungen zur „Fremdexistenz“.
- 3. Der Andere als Gegenstand.....
- 4. Der Blick und die Scham
- 5. Der Subjekt-Andere.............
- 6. Die Konstitution des Ich durch den Anderen.
- 7. Auswertung.
- II. Intersubjektivität in Der Idiot der Familie.
- 1. Hinführung: Fragen der Methode..\li>
- 2. Die Kindheit Flauberts .
- 3. Die Mutter als die Andere ..
- III. Fazit......
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Theorie der Intersubjektivität bei Jean-Paul Sartre anhand von zwei ausgewählten Texten: „Das Sein und das Nichts“ und „Der Idiot der Familie“. Die Untersuchung analysiert die philosophischen Grundgedanken der Intersubjektivität in „Das Sein und das Nichts“, insbesondere die Rolle des Blicks und der Scham, um diese Ergebnisse anschließend auf Sartres Flaubertstudie „Der Idiot der Familie“ anzuwenden.
- Intersubjektivität als zentrales Konzept in Sartres Philosophie
- Die Rolle des „Anderen“ in der Konstitution des Selbstbewusstseins
- Die Bedeutung des Blicks und der Scham in der Interaktion zwischen Subjekt und Anderen
- Sartres Theorie der Freiheit im Kontext der Intersubjektivität
- Die Anwendung von Sartres Theorie auf die Analyse von Flauberts Leben und Werk
Zusammenfassung der Kapitel
I. Intersubjektivität in Das Sein und das Nichts
Dieses Kapitel behandelt die Grundgedanken in Sartres Hauptwerk „Das Sein und das Nichts“, das die Existenzweise des Menschen im Bezug zur Welt, zu sich selbst und zu anderen erfasst. Das Kapitel untersucht die Rolle des „Anderen“ in der Konstitution des Selbstbewusstseins und analysiert die Bedeutung des Blicks und der Scham in der Interaktion zwischen Subjekt und Anderen. Die Analyse beleuchtet, wie das Selbstbewusstsein durch die Beziehung zum Anderen konstituiert wird.
II. Intersubjektivität in Der Idiot der Familie
Dieses Kapitel untersucht die Anwendung von Sartres Theorie der Intersubjektivität auf die Analyse von Flauberts Leben und Werk in „Der Idiot der Familie“. Die Kapitel konzentriert sich insbesondere auf die Mutter als die „Andere“ und die Bedeutung ihrer Beziehung zu Flauberts Selbstfindungsprozess.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit behandelt die Theorie der Intersubjektivität bei Jean-Paul Sartre, insbesondere die Rolle des „Anderen“ in der Konstitution des Selbstbewusstseins, der Blick, die Scham, die Freiheit und die Anwendung dieser Konzepte auf die Analyse von Flauberts Leben und Werk in „Der Idiot der Familie“.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Sartre unter Intersubjektivität?
Intersubjektivität beschreibt bei Sartre die Beziehung zwischen dem Ich und dem Anderen. Zentral ist dabei die Erkenntnis, dass das Selbstbewusstsein erst durch die Begegnung mit einem anderen Subjekt konstituiert wird, was Sartre besonders durch das Konzept des Blicks verdeutlicht.
Welche Rolle spielt der „Blick“ in Sartres Philosophie?
Der Blick des Anderen verwandelt das Subjekt in ein Objekt. In diesem Moment erfährt sich der Mensch als ein Wesen, das für andere sichtbar und beurteilbar ist, was oft mit dem Gefühl der Scham einhergeht.
Wie wird Intersubjektivität in „Der Idiot der Familie“ thematisiert?
In diesem Spätwerk wendet Sartre seine Theorien auf die Biografie von Gustave Flaubert an. Er untersucht insbesondere die Beziehung Flauberts zu seiner Mutter als der „Anderen“ und wie diese Interaktion seine Identitätsbildung beeinflusste.
Gibt es einen Unterschied zwischen Sartres Konzepten in seinem Früh- und Spätwerk?
Die Arbeit untersucht, ob zwischen „Das Sein und das Nichts“ und „Der Idiot der Familie“ ein Spannungsverhältnis besteht oder ob die Flaubert-Studie auf den ursprünglichen sozialphilosophischen Implikationen des Blick-Kapitels aufbaut.
Was bedeutet „Die Konstitution des Ich durch den Anderen“?
Es bedeutet, dass ein Individuum sich seiner selbst erst dann voll bewusst wird, wenn es erkennt, dass es von einem anderen Subjekt wahrgenommen wird. Der Andere ist somit eine notwendige Bedingung für die Existenz des Selbstbewusstseins.
- Quote paper
- Daniel Zorn (Author), 2007, Intersubjektivität in Sartres "Das Sein und das Nichts" und "Der Idiot der Familie", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85034