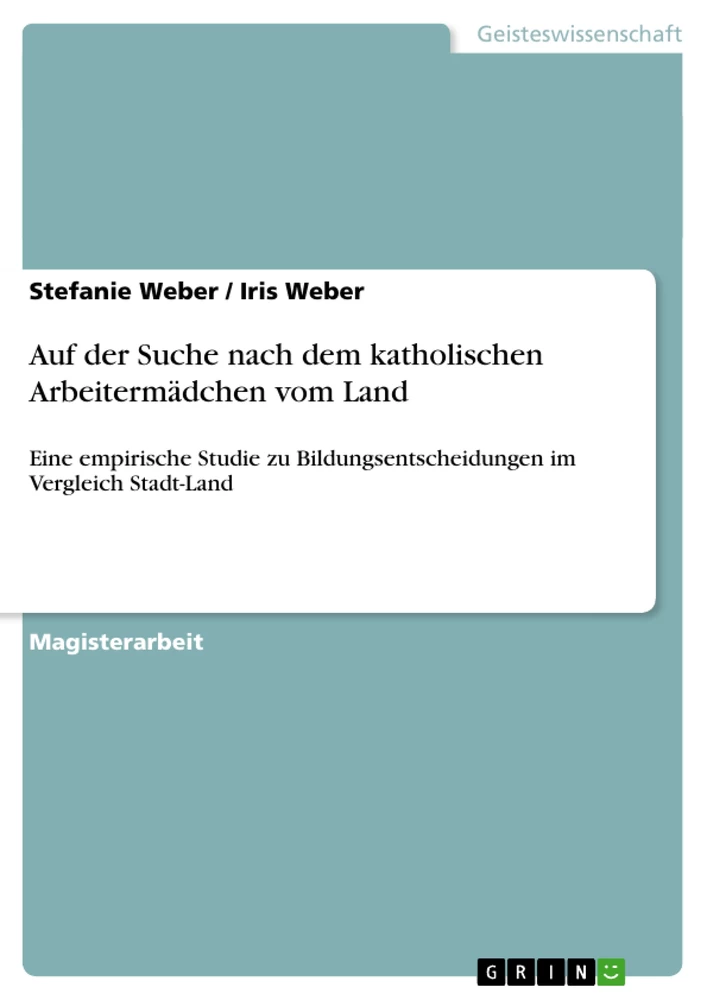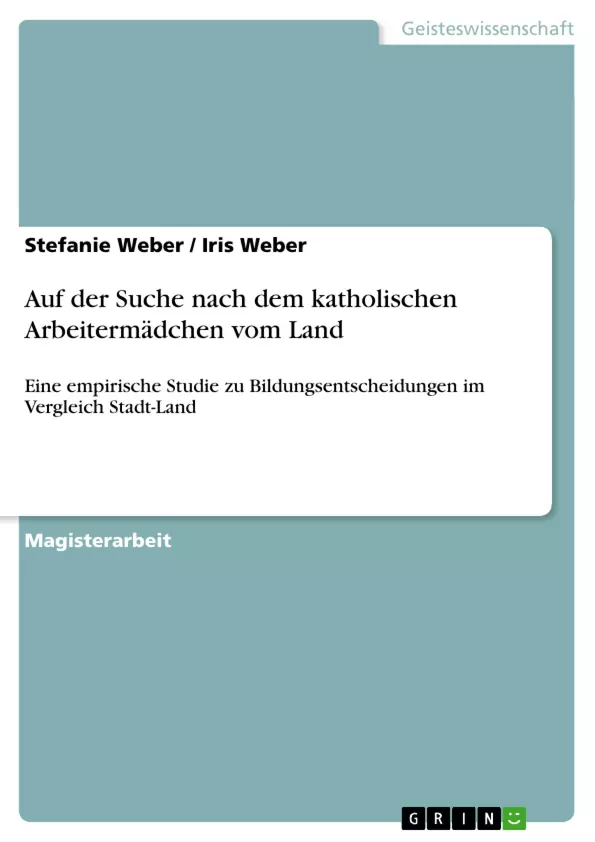Unser für diese Magisterarbeit gewähltes Thema „Auf der Suche nach dem katholi-schen Arbeitermädchen vom Land – Bildungsentscheidungen im Vergleich Stadt – Land“ berührt die zur Zeit – und insbesondere nach PISA und IGLU – heftig diskutierte und umstrittene Bildungspolitik in Deutschland und speziell in Bayern. In die Zeit unserer Forschung fiel die Veröffentlichung der 2. PISA-Studie (2003), der Rücktritt der nicht unumstrittenen bayerischen Kultusministerin Monika Hohlmeier und die überstürzte Einführung des achtjährigen Gymnasiums (genannt G 8) in Bayern.
Im Laufe der insgesamt 2 Jahre, die wir uns nun mit dem Thema Bildung beschäftigen, ist uns die Brisanz – und gleichzeitig unverantwortliche Ignoranz - der deutschen, speziell der bayerischen Politik gegenüber der durch mangelhafte Bildung ausgelösten Chancenungleichheit immer deutlicher geworden. Solange ein deutscher Tatbestand und Begriff wie „Bildungsarmut“ einfach nicht zur Kenntnis genommen wird und die Verwendung durch die Münchner Soziologin Jutta Allmendinger von Seiten der Landesregierung kritisiert wird , sind wir von echten Reformen noch weit entfernt.
Eltern, wie auch Lehrer und Direktoren der befragten Schulen sind äußerst sensibilisiert und wir hatten bei den vorgeschalteten Interviews, wie auch bei der Beantwortung der Fragebögen immer wieder das Gefühl offene Türen einzurennen und den verschiedenen Personengruppen ein – wenn auch kleines – Forum zur engagierten Meinungsäußerung über die bayerische, bzw. deutsche Schulpolitik zu bieten. So erklärten wir uns auch die hohe Rücklaufquote unserer Fragebögen.
Ausgangspunkt unseres Themas war neben der aktuellen und durchaus problematischen Situation vor allem eigene Erfahrungen mit Bildungsentscheidungen nach vier Jahren Grundschulzeit, sowie Beobachtungen im Bekanntenkreis und der ländlichen Nachbarschaft. Die Belastungen, denen die neun- und zehnjährigen Kinder im Jahr vor dem Übertritt ausgesetzt sind, wie auch die angespannte Situation der Lehrkräfte und die der oftmals um die Zukunft ihrer Kinder kämpfenden und sich ihrer Verantwortung sehr bewussten Eltern war für uns offensichtlich.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Bildungsbegriff und Bildung als interdisziplinäres Forschungsfeld.
- Kapitel 1: Vom ständisch geprägten Schulwesen zum dreigliedrigen Schulsystem (in Deutschland)
- 1.1 Ideengeschichtliche Wurzeln einer Schule für alle Kinder...
- 1.1.1 Erste Forderungen nach einer Bildung für alle Menschen: Johann Amos Comenius (1592-1670)...
- 1.1.2 Der Versuch, das öffentliche Schulwesen zu strukturieren: Marquis de Condorcet (1743-1794)...
- 1.1.3 Preußens Reformpläne unter Fichte, von Humboldt und von Süvern: Neuhumanismus und Folgezeit .
- 1.1.4 Gründung der Lehrervereine.
- 1.2 Allgemeine Schulpflicht und Mädchenbildung im 19. Jahrhundert.
- 1.3 Schulkompromisse in der Weimarer Republik..
- 1.4 Nationalsozialistische Schulpolitik......
- 1.5 Die Zeit nach 1945: Wiederherstellung des dreigliedrigen Schulsystems.
- 1.6 Schulreform und Bildungsexpansion von 1965 bis 1990.
- 1.7 Die Zeit nach PISA.
- Kapitel 2: Das jetzige Bildungssystem in Deutschland und Bayern.………………………….
- 2.1 Das dreigliedrige Bildungssystem in Deutschland, sowie bayerische Besonderheiten..
- 2.2. Durchlässigkeit im Schulsystem.
- 2.3. Ein Blick auf die Bildungsdiskussionen heute im Vergleich zu den 1960/1970er Jahren.........
- 2.4. Überblick über die Positionen der Parteien in Bayern, bzw. der im Bundestag vertretenen Parteien, zur Bildungspolitik, mit spezieller Anmerkung zu den PISA-Ergebnissen
- 2.4.1 Bildungspolitische Leitsätze der CDU/CSU
- 2.4.2 Die Bildungspolitik der bayerischen SPD..
- 2.4.3. Die neue Bildungspolitik der Grünen..
- 2.4.4. Die Bildungskampagne der FDP.
- 2.4.5. Die Bildungspolitik der Linkspartei ……………………..\li>
- Kapitel 3: Bildungsungleichheit und Bildungsentscheidungen
- 3.1 Theorien der Bildungssoziologie.
- 3.2 Ausgewählte soziologische Theorien zu Bildungsentscheidungen
- 3.3 Erste These: Bevorzugung,,bestimmter\" Kinder...........
- 3.4 Zweite These: Unterschiedliche Begabungen?
- Kapitel 4: Zur Dualität: Zentrum und Peripherie
- 4.1. Urbanisierung und Segregation
- 4.1.1 Urbanisierung als erste Stufe im Verstädterungsprozess
- 4.1.2 Das Phänomen der Segregation….….……………………..\li>
- 4.2 Suburbanisierung, Des- und Counterurbanisierung...
- 4.3 Reurbanisierung und aktuelle politische Tendenzen.....
- 4.4 Schrumpfungsprozesse in Stadt und Land............
- 4.5 Peripherisierung.
- 4.6 Regionale Disparitäten.......
- 4.7 Stadt- und Landbevölkerung..
- Kapitel 5: Forschungspraxis und Methodik.
- 5.1 Forschungstagebuch..........\li>
- 5.1.1 Unsere Vorstudie: Das Forschungspraktikum (FOPA)..\li>
- 5.1.2 Unsere qualitative Zusatzstudie: Langzeitprojekt (LAPO)...
- 5.1.3 Unsere Hauptstudie: Die Magisterarbeit (MA).
- 5.2 Praktische Durchführung...
- 5.2.1. Konzeption des Fragebogens.
- 5.2.1.1. Der Kinderfragebogen (KB).
- 5.2.1.2. Der Elternfragebogen (EB) .
- 5.2.2. Vorbereitungsphase, Genehmigungsverfahren und Durchführung.….….….….….……………..\li>
- 5.2.3. Thesenerstellung...
- 5.2.4. Datenkodierung, Dateneingabe und Datenauswertung ..
- 5.3. Methodik..\li>
- 5.3.1. Die Stichprobe.
- 5.3.2. Der Rücklauf.
- 5.3.3. Bayerisch-Schwaben
- 5.3.3.1. Die Stadt Augsburg.
- 5.3.3.2. Die Landkreise in Bayerisch-Schwaben
- 5.3.4. Die wichtigsten Kennwerte aus unserer Forschung ......
- Kapitel 6: Thesen: Begründungen, Theorien, Inhalte und Ergebnisse .....
- 6.1. Schüler der ländlichen Regionen Schwabens sind nach wie vor benachteiligt.
- 6.2. Stadt-Eltern sind bildungsorientierter als Land-Eltern. Für Land-Eltern hat die Hauptschule einen höheren Stellenwert als Vorbereitung auf einen praktischen Beruf. Stadt-Eltern ziehen einen möglichst hohen Schulabschluss vor......
- 6.3. Die Schulwahlentscheidungen am Ende der Grundschulzeit sowie die Lehrerempfehlungen richten sich nach der Schichtzugehörigkeit der Eltern.
- 6.4. Mädchen, besonders in den ländlichen Regionen, werden nach wie vor benachteiligt, und zwar einerseits aufgrund des traditionellen Rollenverständnisses der Eltern und andererseits aufgrund des heimlichen Lehrplans.......
- 6.5. Die Jungen aus der Stadt sind die großen Verlierer der Bildungsexpansion................
- 6.6. Die Land-Frau erlangt ihre soziale Bestätigung über Kinder, die Stadt-Frau über ein erfolgreiches Berufsleben.
- 6.7. Bereits in den Köpfen 10-Jähriger herrscht ein ausgeprägtes Schichtbewusstsein. Je höher die Schicht der Kinder, desto klarer ist die Vorstellung über Schulbildung und Berufsziel..
- 6.8. Stadt-Eltern streben eine möglichst hohe Schulbildung für ihre Kinder an. Sie wollen um jeden Preis verhindern, dass ihr Kind auf eine Hauptschule (=“Restschule“) gehen muss.
- 6.9. Die Investitionen in die außerschulische Bildung sind in Stadt und Land gleich hoch und schichtabhängig. Ganztagesschulen würden die vorhandene Chancenungleichheit verbessern....
- 6.10. Das dreigliedrige Schulsystem ist veraltet, fördert die soziale Ungleichheit und benachteiligt die Kinder auf dem Land. …………………………………..\li>
- 6.11. Lehrer sind vor allem in der Stadt gesellschaftlich nicht angesehen - auf dem Land genießt der Lehrer noch mehr Autorität und Ansehen. Lehrern wird besonders die Kompetenz bei Übergangsentscheidungen abgesprochen........
- 6.12. Der Bildungsnotstand in Deutschland ist die Folge eines Erziehungsnotstandes....
- 6.13. Die Einführung des G8 in Bayern ist für Eltern ein Grund ihr Kind nicht auf das Gymnasium zu schicken, um ihm den Leistungsdruck, der nach PISA sowieso enorm gestiegen ist, zu ersparen....
- 6.14. Bayern hat kein Interesse an der Integration von ausländischen SchülerInnen......
- 6.15. Was beeinflusst die Schulwahl?.........
- 6.16. Ergebnisse ohne Hypothesenbindung ..
- 6.16.1. Hat die Konfession irgendeinen Einfluss auf die Schullaufbahn?
- 6.16.2. Einstellungen der Eltern zu Schule und Beruf nach Kinderanzahl, Nationalität, Schicht und Wohnort..
- 6.16.3. Wollen Eltern und Kinder auf dieselbe Schule wechseln?
- 6.16.4. Sind sich Eltern und Kinder bezüglich des Notendurchschnitts einig? ...
- 6.16.5. Wer half den Eltern bei der Entscheidung und wer half den Kindern? ………………………………..
- 6.16.6. Was sind die Lieblingsfächer der Kinder?
- 6.16.7. Nicht berücksichtigte Fragen
- Bildungsungleichheit und Bildungsentscheidungen im Kontext von Stadt und Land
- Soziologische Theorien zur Erklärung von Bildungsungleichheit
- Die Rolle von Geschlecht, Schicht und Konfession in Bildungsentscheidungen
- Der Einfluss des dreigliedrigen Schulsystems auf Bildungschancen
- Der Vergleich von Bildungsaspirationen und -realitäten von Eltern und Kindern
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht die Bildungsentscheidungen von Familien in Stadt und Land. Die Arbeit beleuchtet die Unterschiede in den Bildungsaspirationen und -entscheidungen von Eltern und Kindern in urbanen und ländlichen Regionen Bayerns.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in den Bildungsbegriff und die Bildung als interdisziplinäres Forschungsfeld. In Kapitel 1 wird ein historischer Überblick über die Entwicklung des deutschen Schulwesens gegeben. Kapitel 2 beschreibt das aktuelle Bildungssystem in Deutschland und Bayern, einschließlich der Diskussionen um Durchlässigkeit und Bildungspolitik. Kapitel 3 behandelt die Thematik der Bildungsungleichheit und Bildungsentscheidungen aus soziologischer Sicht. Kapitel 4 widmet sich der Dualität von Zentrum und Peripherie, wobei die Auswirkungen von Urbanisierung, Segregation und Peripherisierung auf Bildungsentscheidungen untersucht werden. Kapitel 5 präsentiert die Forschungsmethodik, einschließlich der Stichprobe, Datenerhebung und -auswertung. Kapitel 6 analysiert die empirischen Ergebnisse der Studie und leitet daraus verschiedene Thesen ab, die die Bildungsungleichheit zwischen Stadt und Land beleuchten.
Schlüsselwörter
Bildungsentscheidungen, Bildungsungleichheit, Stadt-Land-Differenz, Schulsystem, Sozialstruktur, Schichtzugehörigkeit, Familien, Eltern, Kinder, Bayern, Empirische Forschung
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Kernfrage der Magisterarbeit?
Die Arbeit untersucht Bildungsentscheidungen im Vergleich zwischen Stadt und Land und fragt nach den Ursachen für Chancenungleichheit.
Gibt es eine Benachteiligung ländlicher Regionen in Bayern?
Ja, die These der Arbeit lautet, dass Schüler in ländlichen Regionen Schwabens nach wie vor gegenüber städtischen Schülern benachteiligt sind.
Wie unterscheiden sich Stadt- und Land-Eltern in ihren Bildungszielen?
Stadt-Eltern streben oft den höchstmöglichen Abschluss an, während Land-Eltern der Hauptschule einen höheren Stellenwert als Vorbereitung auf praktische Berufe beimessen.
Welchen Einfluss hat die Schichtzugehörigkeit auf die Schulwahl?
Die Untersuchung zeigt, dass sich sowohl Schulwahlentscheidungen als auch Lehrerempfehlungen stark nach der sozialen Schicht der Eltern richten.
Werden Mädchen in ländlichen Regionen heute noch benachteiligt?
Die Arbeit stellt die These auf, dass Mädchen auf dem Land aufgrund traditioneller Rollenbilder und des „heimlichen Lehrplans“ weiterhin benachteiligt werden.
Was bedeutet der Begriff „Bildungsarmut“ in dieser Studie?
Er beschreibt die mangelhafte Teilhabe an Bildungschancen, die oft politisch ignoriert wird und zu dauerhafter Chancenungleichheit führt.
- Arbeit zitieren
- Stefanie Weber (Autor:in), Iris Weber (Autor:in), 2006, Auf der Suche nach dem katholischen Arbeitermädchen vom Land, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85040