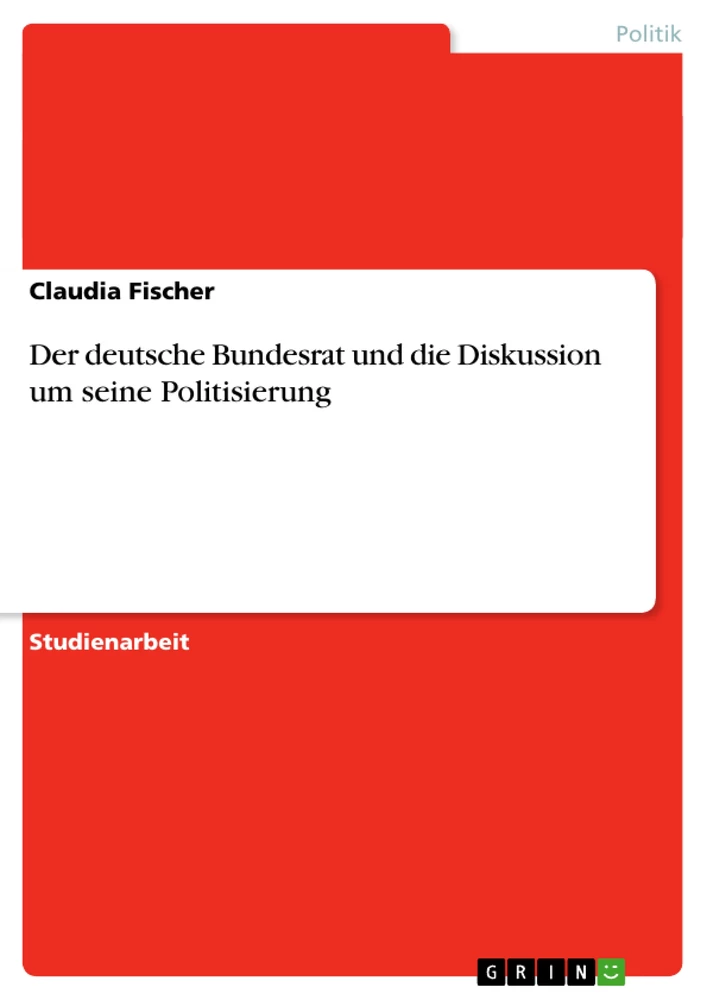„Das föderalistische System (wird) seit Jahren kritisiert – und man kann nicht behaupten, dass es dafür keine guten Gründe gebe. Vom eigentlichen Leitbild des Föderalismus haben wir uns inzwischen ziemlich weit entfernt: Grundsätzlich sollten die Länder ihre Angelegenheiten weitgehend in eigener Verantwortung und nach Maßgabe der in ihren Parlamenten gebildeten Mehrheitsauffassungen gestalten. Das war einmal, denn der Bund hat im Laufe der Jahre immer mehr Aufgaben an sich gerissen (…).“ Demnach ist verständlich, dass in der stets geäußerten Kritik am Föderalismus „dasjenige Organ, in dem das föderalistische Prinzip seinen organisatorischen Ausdruck finden sollte“ in den Mittelpunkt kritischer Diskussionen rückte: Der Bundesrat. Es ist bekannt, dass unter den Demokratien, föderalistisch verfasste eine Minderheit darstellen. Sogar in dieser kleineren Auswahl ist „der Bundesrat, so wie ihn das Grundgesetzt geschaffen hat, eine eigentümliche und einzigartige Institution.“3 Zwar haben sämtliche föderalistische Demokratien ein Zwei-Kammer-Parlament, in dem ein Haus in irgendeiner Weise die Gliedstaaten and den Entscheidungen des Ganzen teilhaben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die historische Entwicklungslinie des Bundesrates
- Seine Vorläufer
- Zwischen Bundesrats- und Senatslösung – Die Entscheidung des Parlamentarischen Rates
- Die Parteipolitisierung des Bundesrates
- Grundsätzliche Positionen
- Der „,unpolitische“ Bundesrat
- Der,,politische“ Bundesrat
- Parteipolitik in Geschichte und Praxis des Bundesrates
- Grundsätzliche Positionen
- Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Parteipolitisierung des Bundesrates
- Die Absicht der Verfassungsgeber
- Bundesrat und Föderalismusverständnis
- Der Bundesrat als oberstes Bundesorgan
- Verfassungsrechtliche Kompetenzen des Bundesrates
- Der Bundesrat in der Gesetzgebung – keine zweite Kammer
- Der Bundesrat im Parteienstaat
- Legitimationsdefizit des Bundesrates?
- Ausprägungen der Parteipolitisierung des Bundesrates
- Der Bundesrat als Instrument der Opposition?
- Koalitionsvereinbarungen über das Abstimmungsverhalten
- Grenzen und Relativierung der Parteipolitisierung
- Zur Differenzierung von Länder- und Parteiinteressen
- Die zentrale Rolle der Länderinteressen - Der Bundesrat als Instrument gegen Kompetenzbeschneidungen der Länder
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage der Parteipolitisierung des deutschen Bundesrates. Dabei soll untersucht werden, inwieweit eine solche Entwicklung in der Praxis stattgefunden hat, welche verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen diese Entwicklung beeinflussen und welche Ausprägungen der Politisierung sich beobachten lassen. Darüber hinaus werden die Grenzen und Relativierungen dieser Entwicklung in Bezug auf die Interessen der Bundesländer beleuchtet.
- Die historische Entwicklung des Bundesrates und seine Vorläufer
- Die unterschiedlichen Positionen zum Verhältnis von Länder- und Parteiverantwortung im Bundesrat
- Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit der Parteipolitisierung des Bundesrates
- Die verschiedenen Ausprägungen der Parteipolitisierung
- Die Grenzen und Relativierungen der Parteipolitisierung im Kontext von Länderinteressen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Kritik am föderalen System und stellt den Bundesrat als zentralen Akteur in der Diskussion dar. Sie führt den Leser in die Thematik der Parteipolitisierung des Bundesrates ein und skizziert die Zielsetzung der Arbeit.
Kapitel 1 untersucht die historische Entwicklungslinie des Bundesrates, beginnend mit seinen Vorläufern im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation und dem Deutschen Bund. Die Diskussion um die Bundesratslösung und die Senatslösung im Rahmen der Paulskirchenverfassung wird ebenfalls beleuchtet.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Parteipolitisierung des Bundesrates. Es werden die grundsätzlichen Positionen zum ,,unpolitischen“ und ,,politischen“ Bundesrat sowie die Rolle der Parteipolitik in Geschichte und Praxis des Bundesrates beleuchtet.
Kapitel 3 widmet sich der verfassungsrechtlichen Zulässigkeit der Parteipolitisierung. Die Absichten der Verfassungsgeber, das Föderalismusverständnis und die Rolle des Bundesrates als oberstes Bundesorgan werden analysiert. Darüber hinaus wird die Kompetenz des Bundesrates in der Gesetzgebung und im Kontext des Parteienstaates beleuchtet.
Kapitel 4 behandelt verschiedene Ausprägungen der Parteipolitisierung, unter anderem die Rolle des Bundesrates als Instrument der Opposition und das Abstimmungsverhalten im Rahmen von Koalitionsvereinbarungen.
Kapitel 5 befasst sich mit den Grenzen und Relativierungen der Parteipolitisierung. Die Unterscheidung von Länder- und Parteiinteressen sowie die Rolle des Bundesrates als Instrument gegen Kompetenzbeschneidungen der Länder werden diskutiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem deutschen Bundesrat und der Frage seiner Politisierung. Dabei stehen zentrale Begriffe wie Föderalismus, Parteipolitik, Verfassungsrecht, Länderinteressen, Zweikammersystem und die historische Entwicklung des Bundesrates im Mittelpunkt.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Bundesrat und welche Funktion hat er?
Der Bundesrat ist ein Verfassungsorgan, durch das die Bundesländer an der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes sowie in Angelegenheiten der EU mitwirken.
Was versteht man unter der Politisierung des Bundesrates?
Es bezeichnet die Entwicklung, bei der Abstimmungen im Bundesrat weniger von Länderinteressen als vielmehr von parteipolitischen Strategien und Oppositionsinteressen geprägt sind.
Ist die Parteipolitisierung verfassungsrechtlich zulässig?
Die Arbeit analysiert die Absichten der Verfassungsgeber und diskutiert, ob der Bundesrat im Parteienstaat seine ursprüngliche föderale Funktion noch voll erfüllt.
Wie beeinflussen Koalitionsvereinbarungen das Abstimmungsverhalten?
Oft wird im Voraus festgelegt, wie ein Land im Bundesrat stimmt, was dazu führen kann, dass bei Uneinigkeit der Koalitionspartner Enthaltungen erfolgen.
Dient der Bundesrat als Instrument der Opposition?
In Zeiten unterschiedlicher Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat kann die Opposition im Bund den Bundesrat nutzen, um Gesetzesvorhaben der Regierung zu blockieren oder zu verändern.
- Citar trabajo
- Claudia Fischer (Autor), 2007, Der deutsche Bundesrat und die Diskussion um seine Politisierung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85184