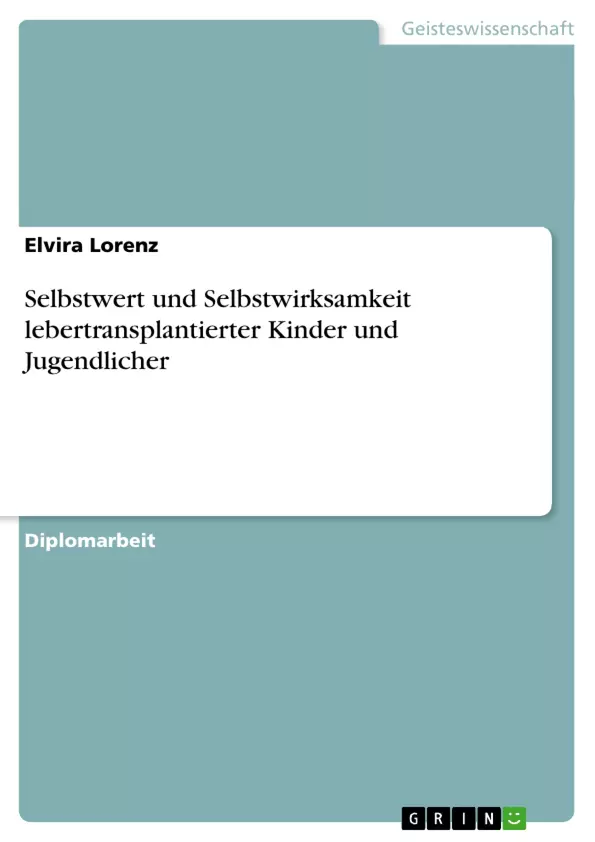Die vorliegende Studie untersucht das Ausmaß des Selbstwertes und der Selbstwirksamkeit von Kindern und Jugendlichen nach einer Lebertransplantation, wobei in der Literatur über diesbezügliche erhöhte Werte und das Vorhandensein von Abwehrpozessen bei chronisch Erkrankten, als mögliche Bewältigungsstrategie, berichtet wurde.
Dazu wurden Werte von 35 lebertransplantierten Kindern und Jugendlichen am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf in der Aussagen-Liste zum Selbstwertgefühl für Kinder und Jugendliche (ALS) und ausschließlich von 26 betroffenen Jugendlichen in der Rosenbergskala zum globalen Selbstwertgefühl (RSS) und in der Allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) erhoben. Die Teilnehmer waren zum Zeitpunkt der Untersuchung zwischen 98 und 221 Monate alt. Die Transplantation fand frühestens mit einem Monat und spätestens mit 15 Jahren statt. Die häufigste Diagnose war biliäre Atresie (50 %). 20 Kinder hatten eine Lebendspende erhalten.
Im Normvergleich weisen die untersuchten Kinder und Jugendlichen signifikant höhere Werte in den beiden Selbstwert-Skalen (ALS und RSS) auf. Hinsichtlich der Selbstwirksamkeit (SWE) finden sich bei den betroffenen Jugendlichen keine signifikant höheren Werte als bei der Normpopulation. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede in den Hauptskalen erweisen sich als nicht überzufällig. Es wurden keine Zusammenhänge zwischen den beiden Konstrukten (ALS- und SWE-Skala) und dem postoperativen Zeitraum festgestellt. Das hohe Ausmaß der „positiven Illusion“ bei lebertransplantierten Jugendlichen geht mit niedrigerer selbsteingeschätzter psychosozialer Belastung einher. Ein negativer Zusammenhang findet sich bei der entsprechenden Substichprobe zwischen der „positiven Illusion“ und der fremdangegebenen Belastung (Nebenwirkungen). Es besteht bei einem Drittel von lebertransplantierten Jugendlichen ein sicherer Hinweis auf das Vorhandensein von Abwehrprozessen.
Die Befunde der vorliegenden Arbeit indizieren, dass das Ausmaß des Selbstwertes bei lebertransplantierten Kindern und Jugendlichen überprüft werden sollte, um im Falle eines Hinweises auf Abwehrprozesse oder diesbezüglicher niedrigerer Werte rechtzeitig gezielte Fördermaßnahmen ergreifen zu können.
Inhaltsverzeichnis
- Zusammenfassung
- Einleitung
- Lebererkrankung und Transplantation bei Kindern
- Funktion und Struktur der Leber
- Leberfunktion und zentrales Nervensystem
- Lebererkrankungen im Kindesalter
- Biliäre Atresie
- Stoffwechselerkrankungen
- Intrahepatische cholestatische Lebererkrankungen
- Akut-fulminantes Leberversagen
- Maligne Tumore
- Lebertransplantation als Behandlungsmethode
- Historische Entwicklung der Lebertransplantation bei Kindern
- Splitliver-Technik und Lebendspende
- Überleben und Wachstum von Kindern nach LTX
- Selbstwert und Selbstwirksamkeit
- Selbstkonzept
- Selbstwirksamkeit
- Selbstwert
- Vergleich der beiden theoretischen Konstrukte
- Zusammenhang von Selbstwert/Selbstwirksamkeit und Lebererkrankungen bei Kindern und Jugendlichen: ein Forschungsüberblick
- Selbstwirksamkeit und chronische Erkrankung
- Selbstwert und chronische Erkrankung
- Selbstkonzept und Lebertransplantation
- Fragestellung und Hypothesen
- Theoretischer Ausgangspunkt
- "Positive Illusion" als Abwehrprozess ...
- Fragestellungen
- Hypothesen….....
- Methode
- Durchführung der Untersuchung
- Rahmenbedingungen
- Teilnehmerauswahl
- Untersuchungsverlauf
- Stichprobenbeschreibung
- Soziodemographische Merkmale
- Krankheitsbezogene Merkmale….
- Testpsychologische Verfahren
- Die Aussagen-Liste zum Selbstwertgefühl für Kinder und Jugendliche (ALS)
- Rosenberg-Skala zum globalen Selbstwertgefühl (RSS) ..
- Allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung (SWE) /General Perceived Self-Efficacy Scale (GSE)
- Zusätzliche Verfahren
- Statistische Auswertung der Daten
- Ergebnisse
- Non-Responder Analyse
- Geschlechtsspezifische Vergleiche
- Überprüfung der Normalverteilungsannahme
- Vergleich lebertransplantierter Kinder und Jugendlicher mit der Altersnorm…………………………..
- Normvergleich hinsichtlich des Selbstwertes
- Normvergleich hinsichtlich der Selbstwirksamkeit
- Zusammenhangsanalysen
- Zusammenhang zwischen dem Selbstwert und der Selbstwirksamkeit lebertransplantierter Kinder und Jugendlicher mit dem postoperativen Zeitraum. .........
- Zusammenhang zwischen der „positiven Illusion“ lebertransplantierter Jugendlicher und der Belastung
- Ergänzende Analysen
- Diskussion
- Selbstwert und Selbstwirksamkeit lebertransplantierter Kinder und Jugendlicher..........
- Erklärungsansätze.......
- Methodische Kritik
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit zielt darauf ab, das Ausmaß des Selbstwertes und der Selbstwirksamkeit bei Kindern und Jugendlichen nach einer Lebertransplantation zu untersuchen. Dabei wird die Hypothese verfolgt, dass chronisch erkrankte Kinder und Jugendliche einen erhöhten Selbstwert und Selbstwirksamkeit aufweisen, um mit ihrer Erkrankung besser umgehen zu können. Die Arbeit untersucht zudem, ob die "positive Illusion", eine Art Abwehrprozess, bei diesen Jugendlichen zur Reduktion der Belastung beiträgt.
- Selbstwert und Selbstwirksamkeit bei lebertransplantierten Kindern und Jugendlichen
- Einfluss der Lebertransplantation auf das Selbstbild und die Selbsteinschätzung
- Die Rolle der "positiven Illusion" als Abwehrprozess
- Zusammenhänge zwischen Selbstwert, Selbstwirksamkeit und psychosozialer Belastung
- Entwicklung von Fördermaßnahmen für lebertransplantierte Kinder und Jugendliche
Zusammenfassung der Kapitel
- Zusammenfassung: Die Studie untersucht den Selbstwert und die Selbstwirksamkeit von Kindern und Jugendlichen nach einer Lebertransplantation und stellt einen erhöhten Selbstwert fest, der mit der "positiven Illusion" als Abwehrprozess in Verbindung steht. Die Ergebnisse deuten auf die Notwendigkeit von Fördermaßnahmen hin, um die psychische Gesundheit dieser Patientengruppe zu unterstützen.
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Lebererkrankung und Transplantation bei Kindern ein und erläutert die Bedeutung von Selbstwert und Selbstwirksamkeit für die Bewältigung chronischer Erkrankungen. Sie stellt die Forschungsfrage und die Hypothesen der Studie vor.
- Lebererkrankung und Transplantation bei Kindern: Dieses Kapitel liefert einen umfassenden Überblick über die Funktion der Leber, Lebererkrankungen im Kindesalter und die Lebertransplantation als Behandlungsmethode. Es beleuchtet die historische Entwicklung der Lebertransplantation bei Kindern und die Splitliver-Technik sowie Lebendspende.
- Selbstwert und Selbstwirksamkeit: Dieses Kapitel definiert die theoretischen Konstrukte Selbstwert und Selbstwirksamkeit und erklärt ihre Bedeutung für die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen.
- Zusammenhang von Selbstwert/Selbstwirksamkeit und Lebererkrankungen bei Kindern und Jugendlichen: ein Forschungsüberblick: Dieses Kapitel präsentiert einen Forschungsüberblick über den Zusammenhang zwischen Selbstwert und Selbstwirksamkeit bei chronisch erkrankten Kindern und Jugendlichen. Es beleuchtet die Rolle des Selbstwertes und der Selbstwirksamkeit in der Bewältigung chronischer Erkrankungen, insbesondere im Kontext der Lebertransplantation.
- Fragestellung und Hypothesen: Dieses Kapitel stellt die Forschungsfrage und die Hypothesen der Studie vor. Es basiert auf dem theoretischen Hintergrund und der aktuellen Forschungslage zur "positiven Illusion" als Abwehrprozess.
- Methode: Dieses Kapitel beschreibt die Methode der Studie, einschließlich der Stichprobenbeschreibung, der Testverfahren und der statistischen Auswertung.
- Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Studie, einschließlich des Normvergleichs, der geschlechtsspezifischen Unterschiede und der Zusammenhangsanalysen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen der Studie sind: Lebertransplantation, Selbstwert, Selbstwirksamkeit, chronische Erkrankung, "positive Illusion", Abwehrprozess, psychosoziale Belastung, Kinder und Jugendliche. Die Studie befasst sich mit dem Zusammenhang zwischen diesen Konstrukten und der psychischen Gesundheit von lebertransplantierten Kindern und Jugendlichen.
Häufig gestellte Fragen
Wie wirken sich Lebertransplantationen auf das Selbstwertgefühl von Kindern aus?
Studien zeigen oft signifikant höhere Selbstwert-Werte bei betroffenen Kindern im Vergleich zur Normpopulation, was als Bewältigungsstrategie gedeutet wird.
Was ist die "positive Illusion" bei chronisch kranken Jugendlichen?
Es handelt sich um einen Abwehrprozess, bei dem die eigene Situation positiver wahrgenommen wird, um die psychosoziale Belastung zu reduzieren.
Gibt es Unterschiede bei der Selbstwirksamkeit?
Interessanterweise fanden sich bei der Selbstwirksamkeit (SWE) keine signifikant höheren Werte als bei der gesunden Normpopulation.
Welche Rolle spielen Abwehrprozesse nach der Transplantation?
Bei etwa einem Drittel der Jugendlichen gibt es deutliche Hinweise auf Abwehrprozesse, die helfen, die Belastungen der chronischen Erkrankung zu verarbeiten.
Was war die häufigste Diagnose in der untersuchten Stichprobe?
Die biliäre Atresie war mit 50 % die häufigste Ursache für die Lebertransplantation bei den teilnehmenden Kindern.
- Quote paper
- Elvira Lorenz (Author), 2007, Selbstwert und Selbstwirksamkeit lebertransplantierter Kinder und Jugendlicher, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85189