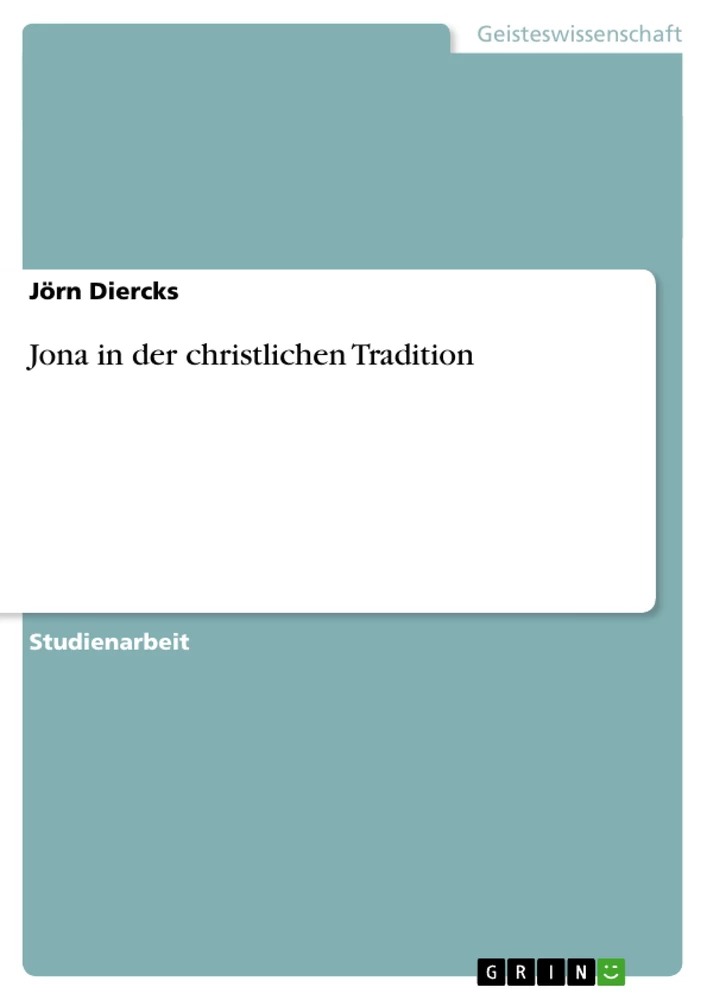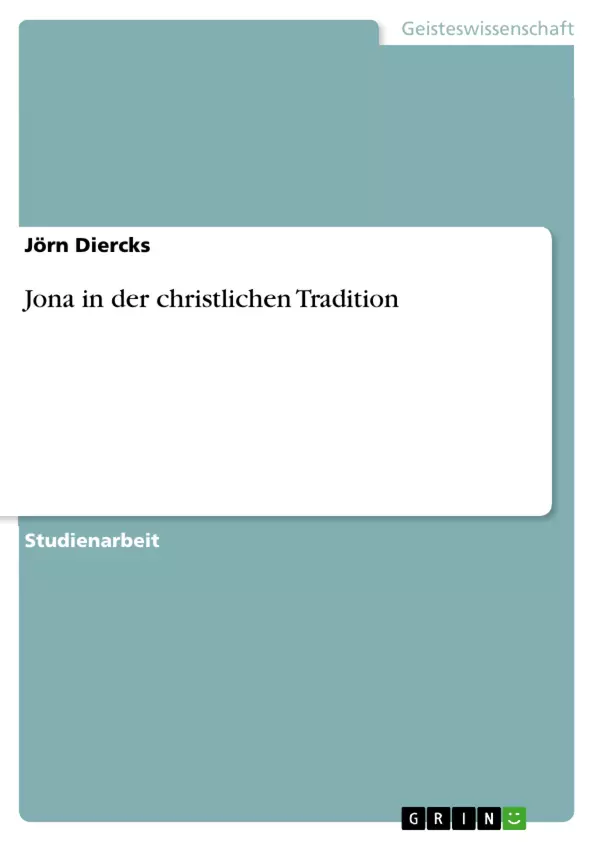Unsere Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Thema Jona in der christlichen Tradition. "Tradition" kommt vom lateinischen tradere und bedeutet "übergeben". Damit ist die "Übernahme und Weitergabe von Sitte, Brauch, Konvention, Lebenserfahrung und Institutionen" gemeint. Traditionen werden von Generation zu Generation unabhängig von der jeweiligen historischen Situation übergeben. Auch religionsgeschichtlich sind Traditionen festzustellen.
Zunächst gehen unsere Überlegungen also dahin, in welchen Bereichen des christlichen Lebens die Jona-Geschichte Beachtung findet. Interessant erscheint uns hier auch der Umstand, daß viele die Jona-Geschichte kennen, wobei aber einige die Geschichte nicht mit der Bibel in Zusammenhang bringen. Dies führt uns zu dem Schluß, daß es noch andere Arten der Überlieferung geben muß als nur die christlich theologische, also durch Kirche und Bibel.
Uwe Steffen, dessen Buch "Die Jona-Geschichte: Ihre Auslegung und Darstellung im Judentum, Christentum und Islam" die Grundlage des Seminars bildete, beschäftigte sich in diesem Buch neben dem theologischen Aspekt auch mit den Darstellungen der Jona-Geschichte in der Kunst. Er untersuchte verschiedene Epochen und ihre Bildnisse. An diesem Buch wollen wir uns orientieren, seine Untersuchungen aufgreifen und mit einer Bildbesprechung (Bilder im Anhang) ergänzen und vergleichen.
Im theologischen Bereich untersucht Steffen verschiedene Deutungen von Luther, Lange und anderen Exegeten. Auch hier wollen wir einen Vergleich mit anderen Interpretationen, wie die von Hans Walter Wolff, Rüdiger Lux, Wolfgang Schnell und noch einigen anderen anstellen.
Über Steffen hinausgehend möchten wir mit dieser wissenschaftlichen Arbeit auch noch einen anderen Aspekt des Lebens bearbeiten: den naturwissenschaftlichen Aspekt. Die Aufgabe der Naturwissenschaft besteht darin, "Erscheinungen und Vorgänge in der Natur ... zu ergründen und ... zu beschreiben und zu erklären." Die Naturwissenschaften sollen also Antworten geben, also quasi eine Wahrheit beschließen. Hieraus entwickelt sich eine gewisse Problematik, wenn Naturwissenschaft und christliche Tradition aufeinander treffen. Die offenen Fragen, ungeklärte Wunder und andere Vorgänge der Bibel stoßen oft auf Widerstand im Bereich der Naturwissenschaften. Gerade auch die Jona-Geschichte erscheint im naturwissenschaftlichen Licht geradezu unmöglich.
Inhaltsverzeichnis
- Jona in der christlichen Tradition
- Jona in den Naturwissenschaften
- Welcher Fisch verschluckte Jona?
- Warum starb Jona nicht?
- Die Bedeutung von Dröschers Theorie
- Jona in der christlichen Theologie
- Jona in der frühchristlichen Theologie
- Deutungen von Jona
- Martin Luther (1483-1546)
- Johann Kaspar Lavater (1741-1801)
- Ernst Lange (1927-1974)
- Weitere Exegeten des 20. Jahrhunderts
- Jona in der christlichen Kunst
- Die Anfänge der Jona-Darstellungen
- Die Darstellung Jonas in Katakomben und auf Sarkophagen
- Die Entwicklung der Bildmotive
- Die Kürbislaube
- Bildbesprechung
- Riten und Märchen
- Wiedergeburtsriten
- Die Stadien der Wiedergeburtsriten
- Wiedergeburtssymbolik im Märchen
- Jona in Riten und Märchen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Rezeption der Jona-Geschichte in der christlichen Tradition, indem sie die naturwissenschaftlichen, theologischen und künstlerischen Aspekte beleuchtet. Ziel ist es, die anhaltende Bedeutung und Aktualität des Jonamotyvs aufzuzeigen.
- Naturwissenschaftliche Interpretationen des Tierwunders
- Theologische Deutungen der Jona-Geschichte in verschiedenen Epochen
- Die Entwicklung der künstlerischen Darstellung Jonas im Laufe der christlichen Geschichte
- Vergleich der Jona-Erzählung mit Archetypen in Riten und Märchen
- Die Aktualität des Jonamotyvs in der heutigen Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Jona in den Naturwissenschaften: Dieses Kapitel untersucht die naturwissenschaftliche Erklärbarkeit des Tierwunders im Buch Jona, insbesondere die These von Vitus B. Dröscher, dass ein Pottwal Jona verschluckt und wieder ausgespien haben könnte. Es werden wissenschaftliche Erkenntnisse zu Pottwalen und deren Verhalten herangezogen, um die Plausibilität dieser Theorie zu beleuchten. Die Diskussion um die Überlebensfähigkeit Jonas unter den gegebenen Umständen wird kritisch betrachtet, wobei die Ausführungen Dröschers als einen Versuch der Glaubwürdigkeitsgewinnung für die biblische Erzählung dargestellt werden. Die anhaltende Auseinandersetzung der Wissenschaft mit dieser Geschichte betont ihre bis heute bestehende Relevanz.
Jona in der christlichen Theologie: Dieses Kapitel analysiert die theologische Rezeption der Jona-Geschichte im Christentum. Es beginnt mit der frühchristlichen Theologie und ihren unterschiedlichen Deutungen, die zwischen Volksfrömmigkeit (Auferstehungssymbolik) und theologischer Interpretation (Bußgedanke) schwanken. Anschließend werden die Interpretationen von Luther, Lavater und Lange untersucht, welche die Geschichte allegorisch und moralisch deuten, oft in Bezug auf das eigene Wirken und den Glauben. Die Ausführungen weiterer Exegeten des 20. Jahrhunderts werden vorgestellt, wobei die Uneinigkeit über die literarische Gattung des Buches Jona (Prophetenlegende, Novelle, Midrasch etc.) und die Übereinstimmung in der Betonung der universalen Gottesbarmherzigkeit und des Bußgedanken hervorgehoben werden.
Jona in der christlichen Kunst: Dieses Kapitel befasst sich mit der Darstellung der Jona-Geschichte in der christlichen Kunst. Es beschreibt die Anfänge der Jona-Darstellungen in der frühchristlichen Grabkunst (Katakombenmalerei, Sarkophage), die oft den Auferstehungsgedanken betonen und antike Symbole verwenden. Die Entwicklung der Bildmotive wird verfolgt, wobei die Veränderung von der Darstellung eines Seeungeheuers hin zum Wal im Laufe der Jahrhunderte beschrieben wird. Es wird die Dreiteilung der Darstellung (Meerwurf, Ausspeien, Ruhe in der Laube) als Symbol des christlichen Heilsweges erläutert, wobei auch Abweichungen vom biblischen Text und der Einfluss antiker Mythen thematisiert werden.
Riten und Märchen: Dieses Kapitel untersucht die Symbolik von Wiedergeburtsriten und Märchen und stellt Parallelen zur Jona-Geschichte her. Die drei Phasen der Wiedergeburtsriten (Trennung, Einweihung, Rückkehr) werden erläutert und mit dem Aufbau von Märchen verglichen, wobei der archetypische Charakter des Motivs des Verschlingens und Wiederauftauchens hervorgehoben wird. Die Rolle der Mutter als Symbol für Erneuerung und Wiedergeburt in Märchen wird im Zusammenhang mit der Rolle Gottes in der Jona-Geschichte betrachtet.
Jona in Riten und Märchen: Dieses Kapitel vergleicht die Struktur der Jona-Geschichte mit den drei Phasen der Wiedergeburtsriten und dem typischen Aufbau von Märchen. Es werden Parallelen in der Dreiteilung (Trennung, Transformation, Rückkehr) und der Symbolik von Tod und Wiedergeburt aufgezeigt. Die Rolle der Sonne im Tageszyklus sowie die Rolle der Mutter/Gottes als Verkörperung von Gut und Böse werden als zentrale Vergleichspunkte herangezogen. Die Bedeutung des "drei Tage und drei Nächte"-Motivs im Kontext des Sonnenzyklus wird diskutiert.
Schlüsselwörter
Jona, Buch Jona, Tierwunder, Pottwal, christliche Tradition, Theologie, frühchristliche Kunst, Sarkophage, Katakombenmalerei, Exegese, Luther, Lavater, Lange, Wiedergeburtsriten, Märchen, Archetypen, Barmherzigkeit Gottes, Buße, Umkehr, Auferstehung, Novelle, universale Gnade, Aktualität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: Jona in der christlichen Tradition
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Rezeption der Jona-Geschichte in der christlichen Tradition aus naturwissenschaftlicher, theologischer und künstlerischer Perspektive. Sie beleuchtet die anhaltende Bedeutung und Aktualität des Jonamotyvs.
Welche Aspekte der Jona-Geschichte werden behandelt?
Die Arbeit umfasst naturwissenschaftliche Interpretationen des „Tierwunders“ (Welcher Fisch verschluckte Jona? Warum starb er nicht?), theologische Deutungen in verschiedenen Epochen (Frühchristentum, Luther, Lavater, Lange u.a.), die Entwicklung der künstlerischen Darstellung Jonas (Katakomben, Sarkophage etc.), sowie Vergleiche mit Archetypen in Riten und Märchen (Wiedergeburtsriten).
Welche naturwissenschaftlichen Aspekte werden betrachtet?
Der Schwerpunkt liegt auf der Erklärbarkeit des „Tierwunders“ durch naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Insbesondere wird die These von Vitus B. Dröscher diskutiert, wonach ein Pottwal Jona verschluckt und wieder ausgespien haben könnte. Die Überlebensfähigkeit Jonas unter diesen Umständen wird kritisch beleuchtet.
Wie wird die theologische Rezeption der Jona-Geschichte dargestellt?
Die Arbeit analysiert die theologische Deutung der Jona-Geschichte vom Frühchristentum bis ins 20. Jahrhundert. Sie beleuchtet die Interpretationen von bedeutenden Theologen wie Luther, Lavater und Lange und zeigt die Uneinigkeit über die literarische Gattung des Buches Jona (Prophetenlegende, Novelle, Midrasch etc.) auf. Die Betonung der universalen Gottesbarmherzigkeit und des Bußgedanken wird hervorgehoben.
Wie wird die Jona-Geschichte in der christlichen Kunst dargestellt?
Das Kapitel zur christlichen Kunst beschreibt die Entwicklung der Jona-Darstellungen von der frühchristlichen Grabkunst (Katakombenmalerei, Sarkophage) bis zur späteren Kunst. Es wird die Dreiteilung der Darstellung (Meerwurf, Ausspeien, Ruhe in der Laube) als Symbol des christlichen Heilsweges erläutert. Der Einfluss antiker Mythen und Abweichungen vom biblischen Text werden thematisiert.
Welche Parallelen zwischen der Jona-Geschichte, Riten und Märchen werden gezogen?
Die Arbeit untersucht Parallelen zwischen der Jona-Geschichte und Wiedergeburtsriten sowie Märchen. Die drei Phasen der Wiedergeburtsriten (Trennung, Einweihung, Rückkehr) werden mit dem Aufbau von Märchen und der Jona-Geschichte verglichen. Der archetypische Charakter des Motivs des Verschlingens und Wiederauftauchens wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Jona, Buch Jona, Tierwunder, Pottwal, christliche Tradition, Theologie, frühchristliche Kunst, Sarkophage, Katakombenmalerei, Exegese, Luther, Lavater, Lange, Wiedergeburtsriten, Märchen, Archetypen, Barmherzigkeit Gottes, Buße, Umkehr, Auferstehung, Novelle, universelle Gnade, Aktualität.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Ziel ist es, die anhaltende Bedeutung und Aktualität des Jonamotyvs aufzuzeigen, indem die naturwissenschaftlichen, theologischen und künstlerischen Aspekte der Rezeption der Jona-Geschichte in der christlichen Tradition beleuchtet werden.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Jona in der christlichen Tradition, Jona in den Naturwissenschaften, Jona in der christlichen Theologie, Jona in der christlichen Kunst, Riten und Märchen und eine Zusammenfassung.
- Quote paper
- Jörn Diercks (Author), 1999, Jona in der christlichen Tradition, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8521