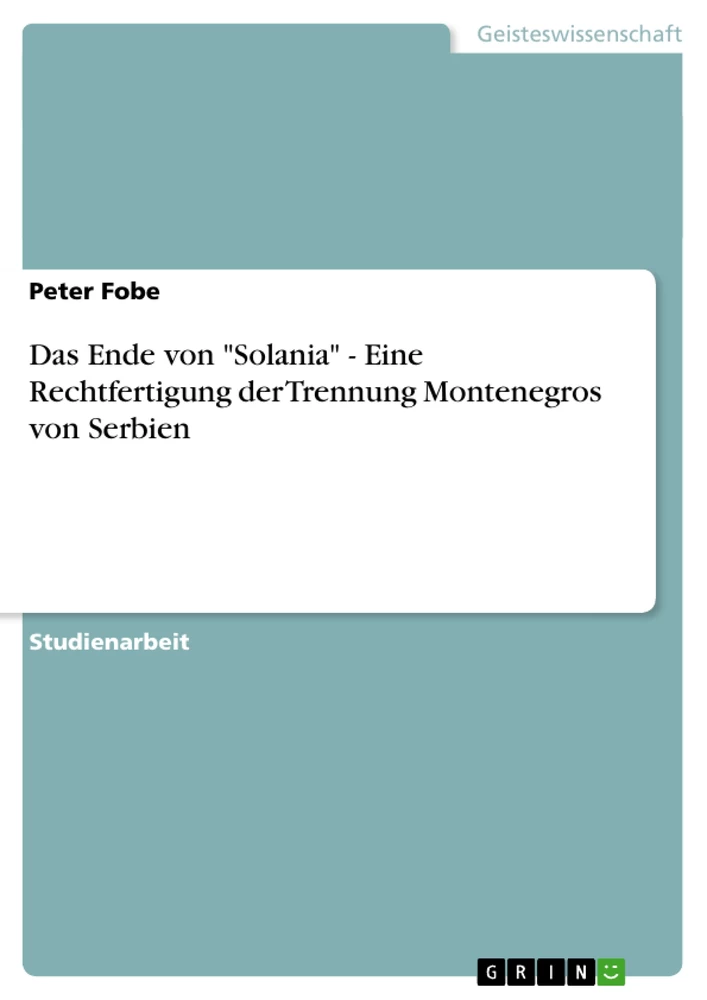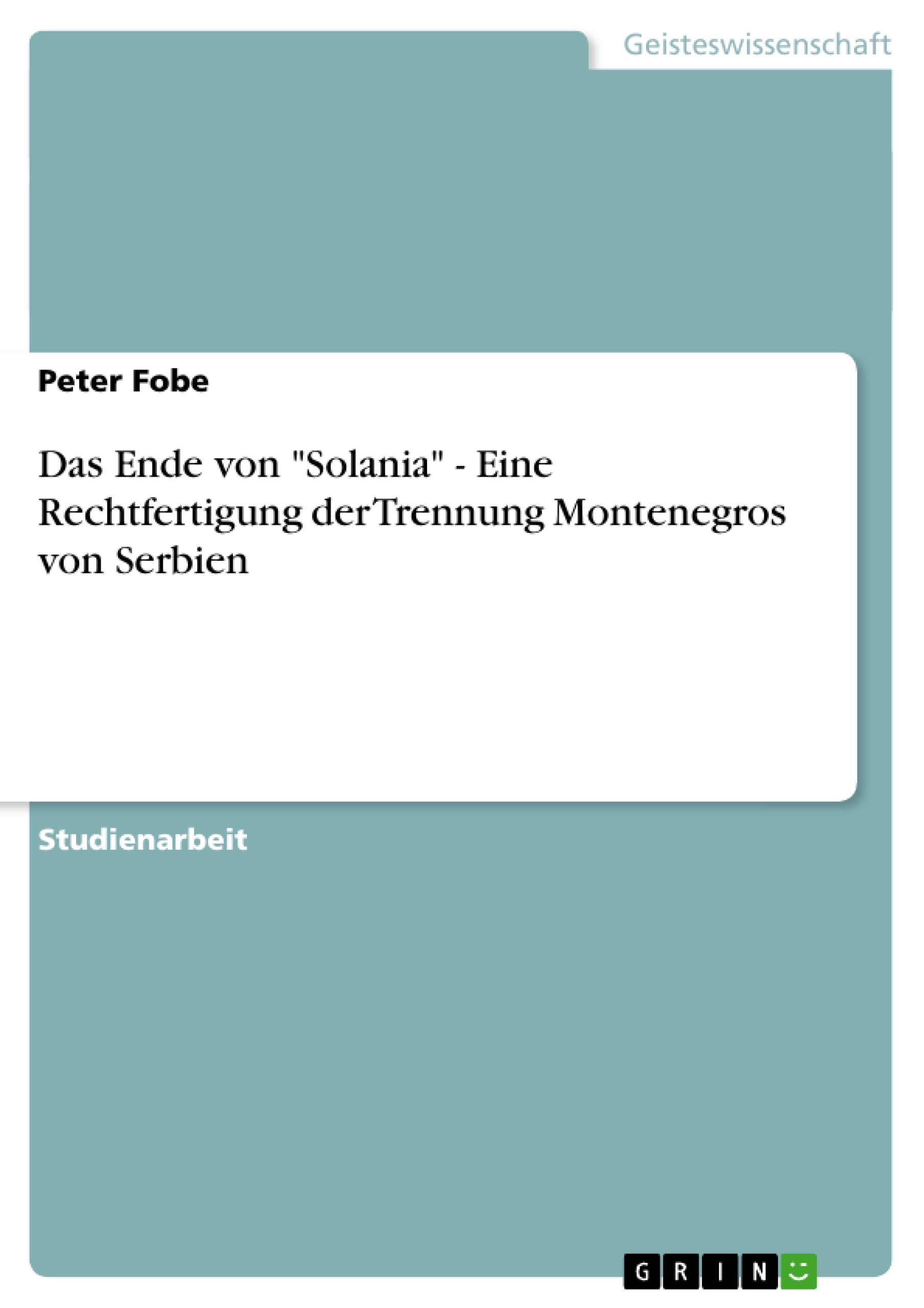Das Aufkommen sezessionistischer Tendenzen berührt im Kern immer auch ein zentrales Problem der politischen Philosophie: die moralische Rechtfertigbarkeit politischer Herrschaft. Das Infragestellen bestehender Verhältnisse der Machtverteilung und -ausübung innerhalb eines Staates impliziert stets zwei wesentliche Aspekte, der sich jede ernsthafte Theorie einer Moral politischer Herrschaft annehmen muss. Nämlich erstens, was einen beliebigen Träger politischer Macht zu dessen besonderem Status berechtigt und zweitens, ob und (wenn ja) warum man verpflichtet ist, Regeln und Gesetze zu befolgen, die dieser erlässt?
Die Geschichte hat gezeigt, dass Sezession keine Erfindung des 20. Jahrhunderts ist. Weiterhin muss man konstatieren, dass trotz umfassender Dekolonisierungsprozesse nach dem Zweiten Weltkrieg und der Konsolidierung des internationalen Staatensystems im Rahmen der Vereinten Nationen die Neubildung von Staaten durch Sezession auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts ein aktuelles Thema bleibt. Es stellt sich also die Frage nach dem Warum, oder besser danach, ob mit zunehmender Umsetzung des Prinzips der Selbstbestimmung der Völker in die Neugründung souveräner Staaten in den letzten sechzig Jahren eine Entwicklung entfacht worden ist, die perspektivisch zu einer unüberschaubaren Zersplitterung der Staatenwelt und zum Bedeutungsverlust von Nationalstaaten führen könnte.
Während die Vereinten Nationen in ihrem Gründungsjahr 1945 noch aus 51 Mitgliedern bestanden, wehen heute bereits die Landesflaggen von 192 souveränen Staaten am East River in New York. Jüngstes Mitglied der UN und aktuellstes Beispiel für eine erfolgreiche Staatensezession ist die Republik Montenegro, deren Bürger sich per Referendum zum Austritt aus der Union mit Serbien entschieden haben und die UN-Generalsekretär Kofi Annan am 28. Juni 2006 offiziell im Kreise der Vereinten Nationen begrüßt hat. Die junge Eigenstaatlichkeit Montenegros bildet den konkreten Anlass, aus politisch-philosophischer Sicht anhand verschiedener Aspekte aufzuzeigen, dass Staatensezession im Allgemeinen, und das montenegrinische Beispiel im Besonderen, unter bestimmten Voraussetzungen moralisch legitim ist.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Sezessionstheorien im Überblick
- Remedial Right Only Theories
- Primary Right Theories
- Politische Ordnungsversuche auf dem Balkan
- Der Zerfall des sozialistischen Jugoslawiens
- Der Bosnienkrieg (1992-1995)
- Der Kosovokrieg (1998-1999)
- Das Referendum über die Trennung Montenegros von Serbien
- Politischer Aspekt: Warum wurde abgestimmt?
- Territorialer Aspekt: Worüber wurde abgestimmt?
- Prozessualer Aspekt: Wie wurde abgestimmt?
- Folgeorientierte Bedenken zur montenegrinischen Eigenstaatlichkeit
- Weitere Fragmentierung der Region?
- Gerechte Verteilung der Scheidungsfolgen?
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit setzt sich zum Ziel, die moralische Legitimität von Staatensezession am Beispiel der Trennung Montenegros von Serbien zu beleuchten. Sie analysiert das Referendum über die Unabhängigkeit Montenegros unter Rückgriff auf philosophische Theorien zur politischen Selbstbestimmung und die politische Situation auf dem Balkan.
- Moralische Rechtfertigung politischer Herrschaft
- Sezessionstheorien und deren Anwendung
- Politische Konflikte auf dem Balkan im 20. Jahrhundert
- Das Referendum über die Unabhängigkeit Montenegros
- Folgeorientierte Bedenken zur montenegrinischen Eigenstaatlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den historischen und aktuellen Kontext von Staatensezession im Zusammenhang mit der fragilen Staatlichkeit und dem Wandel des internationalen Staatensystems. Anschließend werden die wichtigsten Sezessionstheorien vorgestellt, die sich in zwei Richtungen unterscheiden: Remedial Right Only Theories und Primary Right Theories. Das Kapitel über politische Ordnungsversuche auf dem Balkan beleuchtet den Zerfall Jugoslawiens, den Bosnienkrieg und den Kosovokrieg, um den Hintergrund des montenegrinischen Referendums zu verdeutlichen. Im nächsten Kapitel wird das Referendum selbst analysiert, indem die politischen, territorialen und prozessualen Aspekte hinterfragt werden. Die Arbeit schließt mit einer Diskussion über die Folgen einer allzu liberalen Ausübung des Rechts auf Sezession, wobei die mögliche Fragmentierung der Region und die gerechte Verteilung der Scheidungsfolgen im Vordergrund stehen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der politischen Philosophie wie politischer Selbstbestimmung, Staatensezession, Legitimität von Herrschaftsausübung, Fragiler Staatlichkeit, ethnische Konflikte, internationale Politik und dem Fall Montenegros. Sie analysiert die theoretischen und praktischen Aspekte von Sezession im Kontext des Balkans und diskutiert die moralischen und politischen Herausforderungen, die mit der Trennung von Staaten verbunden sind.
Häufig gestellte Fragen
Wann wurde Montenegro ein unabhängiger Staat?
Montenegro wurde am 28. Juni 2006 offiziell als 192. Mitglied in die Vereinten Nationen aufgenommen, nachdem sich die Bürger in einem Referendum für die Trennung von Serbien entschieden hatten.
Was sind 'Remedial Right Only Theories' in Bezug auf Sezession?
Diese Theorien besagen, dass ein Recht auf Sezession nur als letztes Mittel (Abhilfe) bei schwerwiegenden Ungerechtigkeiten oder Menschenrechtsverletzungen besteht.
Warum ist das Beispiel Montenegro völkerrechtlich und philosophisch interessant?
Es dient als Fallstudie für eine moralisch legitime Staatensezession, die durch ein friedliches Referendum und unter Einhaltung internationaler Standards vollzogen wurde.
Welche Bedenken gibt es gegenüber Kleinstaatensezessionen?
Kritiker befürchten eine unüberschaubare Zersplitterung der Staatenwelt (Balkanisierung), den Bedeutungsverlust von Nationalstaaten und Probleme bei der gerechten Verteilung von "Scheidungsfolgen".
Welche Rolle spielten die Balkankriege für die Unabhängigkeit Montenegros?
Der Zerfall Jugoslawiens sowie die Kriege in Bosnien und im Kosovo bildeten den instabilen politischen Rahmen, der den Wunsch Montenegros nach souveräner Eigenstaatlichkeit verstärkte.
- Citation du texte
- Peter Fobe (Auteur), 2006, Das Ende von "Solania" - Eine Rechtfertigung der Trennung Montenegros von Serbien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85245