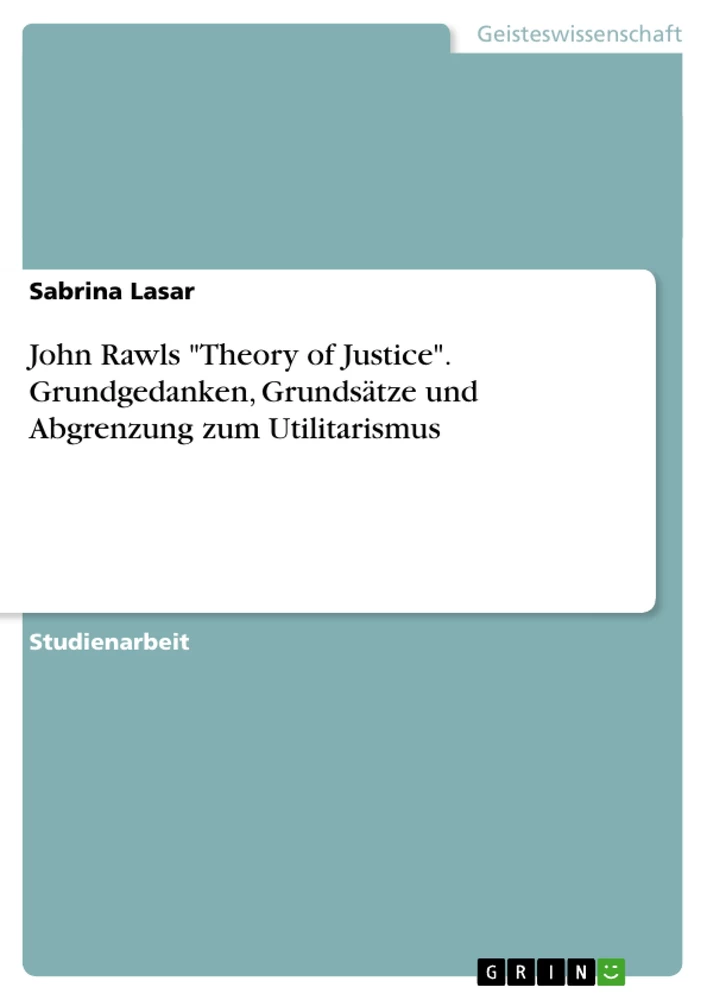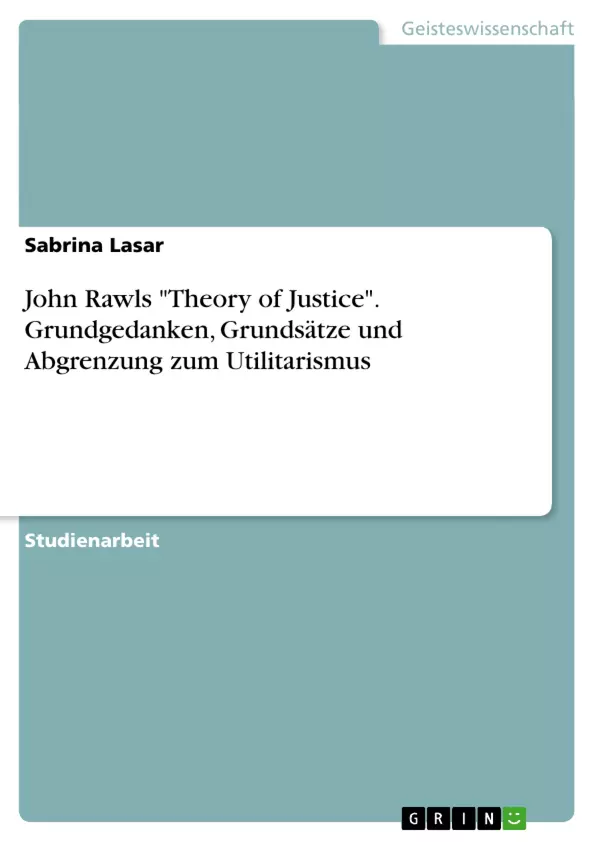Jahrhunderte lang waren soziale sowie politische Fragen ein wichtiger Bestandteil der Philosophie. Angefangen bei Platons Politeia über Hobbes’ Leviathan, Rousseaus Gesellschaftsvertrag, bis hin zu Kants Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre. Sie alle beschäftigten sich mit der Ordnung des menschlichen Zusammenlebens. Doch seit der Mitte des 19. Jahrhunderts hat die politische Philosophie an Bedeutung verloren. Die großen Philosophen beschäftigten sich mit Sprache und Logik und wandten sich der Wissenschafts- und Erkenntnistheorie zu. Mehr als 200 Jahre später, im Jahr 1979, wurde dann A Theory of Justice von John Rawls veröffentlicht. Dieses Buch läutete die Renaissance der politischen Philosophie ein.
Rawls Absicht war es, eine Moralphilosophie zu erarbeiten, die ein Gegenmodell zum Utilitarismus darstellt, der bis dahin hauptsächlich als theoretische Grundlage der neueren Moralphilosophie galt. Autoren wie David Hume, John Stuart Mill und Adam Smith vertraten diesen Ansatz. Dazu versucht er, „die herkömmliche Theorie des Gesellschaftsvertrags von Locke, Rousseau und Kant zu verallgemeinern und auf eine höhere Abstraktionsstufe zu heben“ und zusätzlich „eine systematische Analyse der Gerechtigkeit zu liefern, die […] der vorherrschenden utilitaristischen Tradition überlegen ist“ (vgl. Rawls, S. 12). Sein Buch stellt den Versuch dar die Kriterien anzugeben, nach denen sich beurteilen lässt, ob eine Gesellschaft in gerechter Weise eingerichtet ist oder nicht. Dazu benötigt es bestimmte Gerechtigkeitsgrundsätze, die angeben, welche Rechte jedem Individuum zustehen und wie die sozialen und wirtschaftlichen Güter einer Gesellschaft auf die in ihr lebenden Menschen zu verteilen sind. Dabei muss beachtet werden, dass diese Verteilung gerecht erfolgt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Grundgedanken der Rawlschen Gerechtigkeitstheorie
- Begründung der Gerechtigkeitsgrundsätze
- Überlegungs-Gleichgewicht
- Gerechtigkeit als Fairness
- Der Urzustand
- Schleier des Nichtwissens
- Gleichheit
- Rationalität
- Gegenseitiges Desinteresse
- Gerechtigkeitssinn
- Theorie des Guten und Grundgüter
- Die Grundsätze der Gerechtigkeit
- Der erste Grundsatz
- Der zweite Grundsatz
- Die Maximin-Regel
- Die Vorrangregel
- Das Differenzprinzip
- Der Utilitarismus
- Was heißt Utilitarismus?
- Utilitarismus und Theorie der Gerechtigkeit - ein Vergleich
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit John Rawls' Theorie der Gerechtigkeit, einem zentralen Werk der modernen politischen Philosophie. Das Ziel ist es, die Grundgedanken, Grundsätze und die Abgrenzung zum Utilitarismus zu beleuchten.
- Der Begriff der sozialen Gerechtigkeit und seine Bedeutung für die Grundstruktur der Gesellschaft
- Die Begründung der Gerechtigkeitsgrundsätze durch den Urzustand und die Prinzipien der Fairness
- Die beiden Gerechtigkeitsgrundsätze: Gleichheit der Grundrechte und gerechte Verteilung sozialer und wirtschaftlicher Güter
- Der Utilitarismus als Gegenmodell und seine Unterschiede zu Rawls' Theorie
- Kritikpunkte und offene Fragen zur Rawlschen Gerechtigkeitstheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der politischen Philosophie und die Bedeutung von John Rawls' Werk „A Theory of Justice“ ein. Sie erläutert Rawls' Absicht, eine alternative Moralphilosophie zum Utilitarismus zu entwickeln und die Kriterien für eine gerechte Gesellschaft zu definieren.
Die Grundgedanken der Rawlschen Gerechtigkeitstheorie
Dieser Abschnitt befasst sich mit der Definition von Gerechtigkeit und ihrer Rolle in der Gesellschaft. Rawls betont die Bedeutung von Gerechtigkeit als Grundlage für soziale Institutionen und stellt die Frage, wie diese Institutionen gerecht gestaltet werden können.
Begründung der Gerechtigkeitsgrundsätze
Die Begründung der Gerechtigkeitsgrundsätze erfolgt über den Urzustand, in dem Menschen unter dem „Schleier des Nichtwissens“ Prinzipien für ihre Gesellschaft festlegen. Dieser Abschnitt beleuchtet die Bedeutung von Fairness und die Prinzipien des Urzustands, wie Gleichheit, Rationalität und Gerechtigkeitssinn.
Die Grundsätze der Gerechtigkeit
Dieser Teil beschreibt die beiden Gerechtigkeitsgrundsätze von Rawls: den ersten Grundsatz, der die Gleichheit der Grundrechte und -pflichten festhält, und den zweiten Grundsatz, der soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten nur dann erlaubt, wenn sie allen, insbesondere den Schwächsten, zugutekommen.
Der Utilitarismus
Dieser Abschnitt stellt kurz den Utilitarismus vor und vergleicht ihn mit Rawls' Theorie der Gerechtigkeit. Der Schwerpunkt liegt auf den Unterschieden in den Prinzipien und der Zielsetzung beider Ansätze.
Schlussbemerkungen
Dieser Abschnitt dient der kritischen Betrachtung von Rawls' Theorie und stellt einige Kritikpunkte und offene Fragen zur Debatte.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter in dieser Arbeit sind: soziale Gerechtigkeit, Gerechtigkeitsgrundsätze, Urzustand, Schleier des Nichtwissens, Gleichheit, Fairness, Utilitarismus, Grundrechte, soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten, Differenzprinzip.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Kern von John Rawls' "Theorie der Gerechtigkeit"?
Rawls entwirft eine Theorie der "Gerechtigkeit als Fairness", die Kriterien für eine gerechte Grundstruktur der Gesellschaft festlegt.
Was bedeutet der "Schleier des Nichtwissens"?
Es ist ein Gedankenexperiment, bei dem Menschen über Gerechtigkeitsprinzipien entscheiden, ohne ihre eigene soziale Stellung, Talente oder Interessen zu kennen.
Wie unterscheiden sich Rawls' Theorie und der Utilitarismus?
Während der Utilitarismus das Gesamtwohl maximiert (auch auf Kosten Einzelner), schützt Rawls die unverletzlichen Grundrechte jedes Individuums.
Was besagt das Differenzprinzip?
Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind nur dann gerechtfertigt, wenn sie den am wenigsten begünstigten Mitgliedern der Gesellschaft den größten Vorteil bringen.
Welche zwei Gerechtigkeitsgrundsätze nennt Rawls?
1. Gleiche Grundfreiheiten für alle. 2. Chancenungleichheiten müssen mit Ämtern für alle offenstehen und den Schwächsten nützen.
- Quote paper
- Sabrina Lasar (Author), 2007, John Rawls "Theory of Justice". Grundgedanken, Grundsätze und Abgrenzung zum Utilitarismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85282