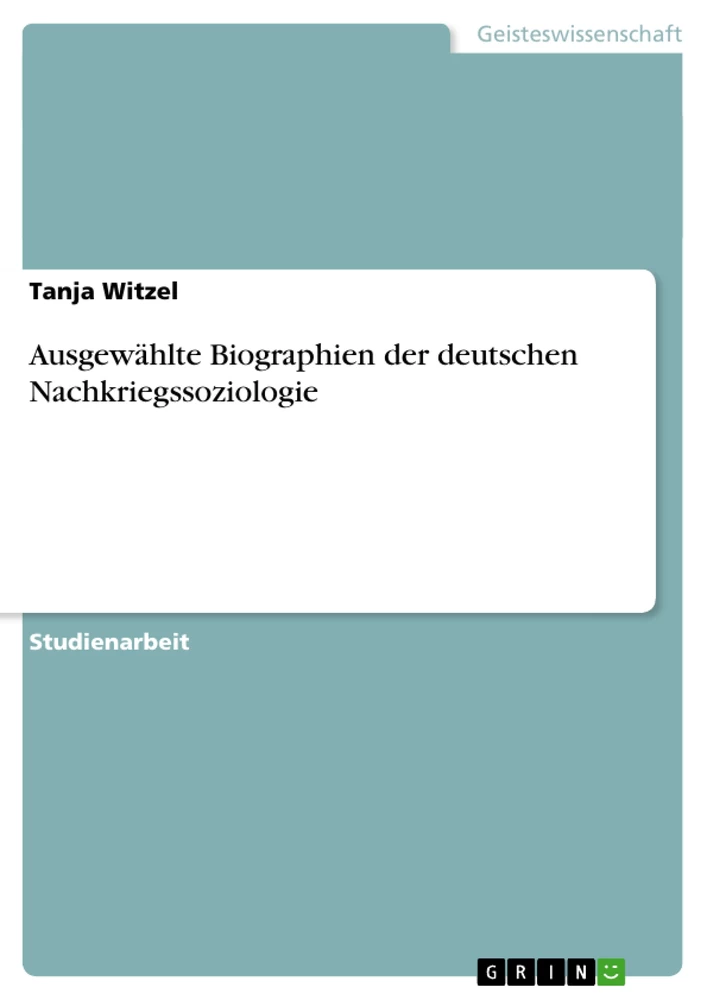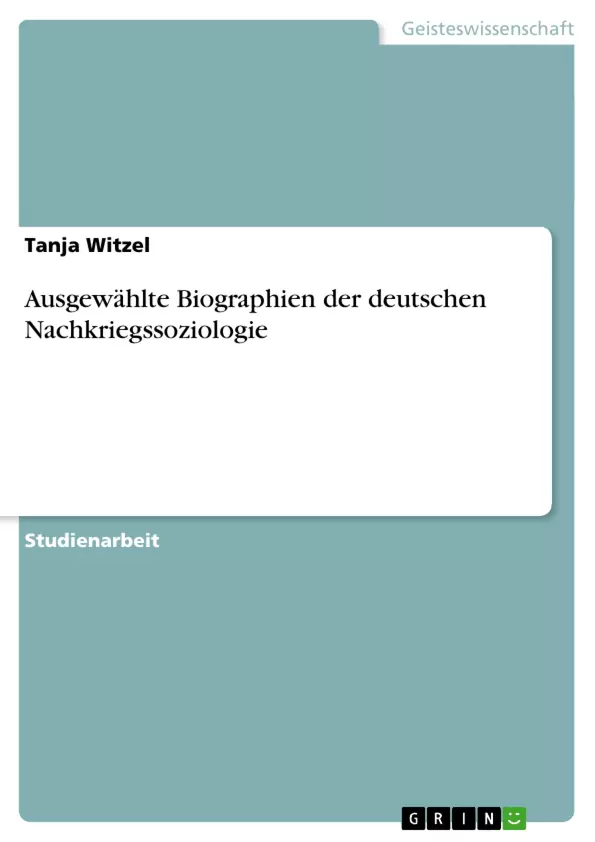Die Professionalisierung der deutschen Soziologie, die bis heute nur als bedingt vollzogen an-gesehen werden kann, nahm ihren Ursprung nach Meinung vieler Autoren bei einigen wenigen Persönlichkeiten, welche nahezu alle vor oder während des zweiten Weltkrieges emigrierten und nach 1945 allmählich nach Deutschland zurückgekehrt waren. Zu nennen sind hier René König, welcher zu Beginn der 50er Jahre die Kölner Schule begründen sollte, die Frankfurter Theodor Adorno und Max Horkheimer und Helmut Schelsky, der auch während des NS-Regimes Deutschland nicht verließ. Die Institutionalisierung des Faches als anerkannte Hochschuldisziplin mit einheitlichen Lehrinhalten aber war nach Bude und Neidhardt „das Werk einer Nachkriegskohorte von Soziologen, die durch die „Heroen“ der 50er angezogen und beeindruckt waren, sich seit Ende der 50er Jahre dann aber zunehmend verselbständigten und ... zunehmend den Ton angaben“ . War also diese (Nachkriegs-)“Kohorte der Disziplinmacher“ eine Gründergeneration, wie Burkart Lutz vermutet ? Oder sind die Ursprünge der Professionalisierung der deutschen Soziologie bei den klassischen Theoretikern der 20er Jahre zu suchen ?
Die vorliegende Arbeit soll an ausgewählten Beispielen aufzeigen, welchen Professionalisierungsbeitrag die Generation der 1945 zwischen 15 und 20jährigen in einer Zeit leistete, in der die Etablierung der Soziologie als anerkanntes Fach „von oben“ von statten ging: Die DGS war bereits gegründet als es noch keine Professoren für Soziologie gab, und Professoren wiederum waren habilitiert bevor soziologische Lehrstühle eingerichtet wurden. Zwar stand dies einem „organischen Wachsen“ der Disziplin entgegen, doch bot sich durch fehlende Strukturvorgaben Raum für die subjektive Entfaltung des jeweiligen Wissenschaftlers und dem für ihn/ sie relevanten Forschungsbereich. Eine Vielzahl methodischer und theoretischer Ansätze waren das Resultat. Wenngleich diese Art der „Selbstprofessionalisierung“ viele Vorteile für den einzelnen Forscher mit sich brachte, hatte sie auch den folgenschweren Nebeneffekt, daß die Soziologen dieser Zeit lange Jahre nicht gewohnt waren, Verantwortung für die von ihnen zu vermittelnde Lehre und den soziologischen Nachwuchs zu übernehmen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Analyse der Biographien
- Burkhart Lutz
- Renate Mayntz
- Dieter Claessens
- Typenbildung anhand der Lebensläufe
- Gemeinsamkeiten in Biographie und Professionalisierungsgeschichte der Nachkriegsgeneration – Versuch einer Typologie
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Professionalisierung der deutschen Soziologie nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie untersucht anhand ausgewählter Biographien, welchen Beitrag die Generation der 1945 zwischen 15 und 20jährigen zur Etablierung der Soziologie als anerkanntes Fach leistete. Die Arbeit analysiert, inwieweit diese Generation an alte Theorien anknüpfte oder neue Theorien und methodologisches Rüstzeug entwickelte.
- Die Rolle der Nachkriegsgeneration bei der Professionalisierung der Soziologie
- Die Entwicklung von neuen Theorien und methodologischen Ansätzen
- Der Einfluss verschiedener soziologischer Schulen, wie der Kölner Schule, der Frankfurter Schule und der Industriesoziologie
- Die Bedeutung von Forschung, Lehre und Selbstdarstellung für die Professionalisierung
- Die Herausforderungen der Professionalisierung in einer Zeit des Umbruchs und der Etablierung der Soziologie als eigenständige Disziplin
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einführung beleuchtet die Entstehung der deutschen Nachkriegs-Soziologie und stellt die Frage, ob die Professionalisierung durch die Nachkriegsgeneration oder bereits durch die „Heroen“ der 50er Jahre initiiert wurde.
Im zweiten Kapitel werden die Biographien von Burkhart Lutz, Renate Mayntz und Dieter Claessens analysiert. Dabei wird untersucht, wie ihre jeweiligen Lebensläufe und Erfahrungen ihren Weg zur Soziologie beeinflussten und welchen Beitrag sie zur Entwicklung der Disziplin leisteten.
Kapitel 3 befasst sich mit der Typenbildung anhand der Lebensläufe der analysierten Soziologen. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihren Biographien und ihren professionellen Karrieren herausgearbeitet.
Das vierte Kapitel untersucht die Gemeinsamkeiten in Biographie und Professionalisierungsgeschichte der Nachkriegsgeneration. Es wird versucht, eine Typologie der soziologischen Professionalisierung in dieser Zeit zu entwickeln.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themenbereiche Nachkriegs-Soziologie, Professionalisierung, Biographie, Kölner Schule, Frankfurter Schule, Industriesoziologie, empirische Sozialforschung, Theoriebildung, Methodologie, Lehre, Selbstdarstellung und Konsensbildung.
Häufig gestellte Fragen
Wer prägte die deutsche Nachkriegssoziologie?
Wichtige Rückkehrer aus der Emigration waren René König, Theodor Adorno und Max Horkheimer, während Helmut Schelsky in Deutschland blieb.
Welchen Beitrag leistete die „Nachkriegskohorte“?
Die Generation der 1945 zwischen 15 und 20-Jährigen trieb die Institutionalisierung und Professionalisierung des Fachs an den Hochschulen maßgeblich voran.
Welche Biographien werden in der Arbeit analysiert?
Die Arbeit untersucht beispielhaft die Lebensläufe von Burkhart Lutz, Renate Mayntz und Dieter Claessens.
Was bedeutet „Selbstprofessionalisierung“ in diesem Kontext?
Da feste Strukturen fehlten, entwickelten Wissenschaftler oft eigenständige methodische und theoretische Ansätze in ihren jeweiligen Forschungsbereichen.
Welche soziologischen Schulen waren einflussreich?
Die Arbeit nennt die Kölner Schule, die Frankfurter Schule sowie die Industriesoziologie als prägende Richtungen der Zeit.
- Quote paper
- M.A. Tanja Witzel (Author), 2004, Ausgewählte Biographien der deutschen Nachkriegssoziologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85320