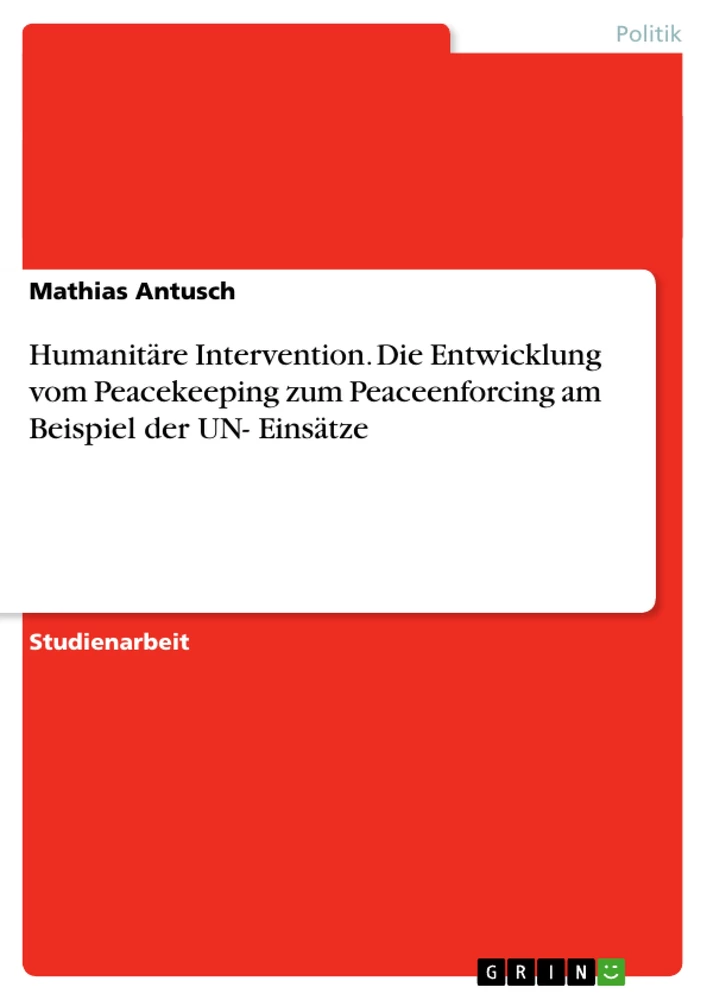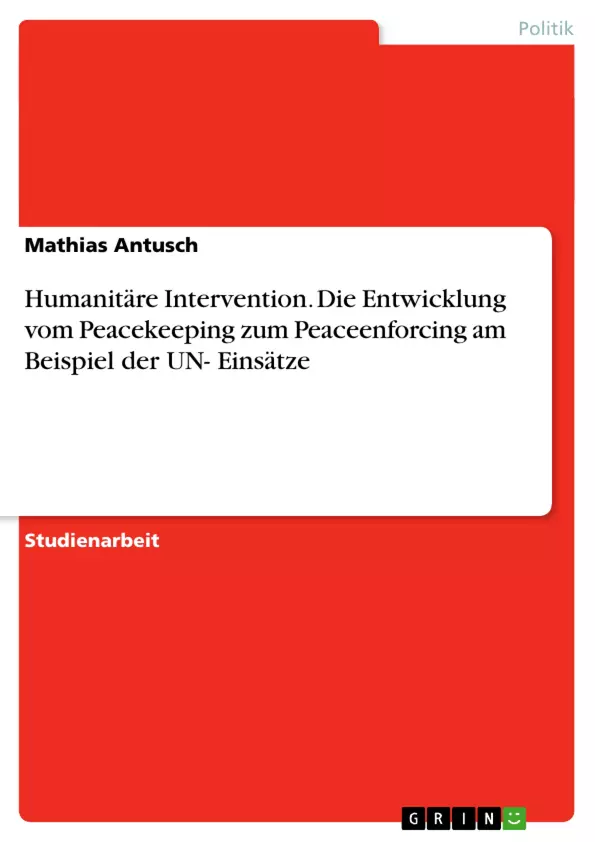Die Vereinten Nationen setzen sich im 1. Artikel ihrer Charta unter anderem zum Ziel, „...den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren und zu diesem Zweck wirksame Kollektivmaßnahme zu treffen, um Bedrohungen des Friedens zu verhüten und zu beseitigen...“.1
Dazu gehören auch humanitäre Interventionen, sogenannte Peacekeeping- und Peaceenforcing- Einsätze. Die Entstehung, Entwicklung und die Problematik dieser Kollektivmaßnahmen der Vereinten Nationen sollen in dieser Arbeit dargestellt werden.
Im ersten Teil wird der Unterschied zwischen Intervention im eigentlichen Sinne und dem Begriff der humanitären Intervention erläutert. Darauf aufbauend wird im zweiten Teil der Arbeit gezeigt, wie die UNO diese Kollektivmaßnahmen in der Vergangenheit mit Hilfe von Peacekeeping- Einsätzen umgesetzt hat. An Hand des Beispiels Jugoslawien gehe ich im dritten Teil auf die Entwicklung vom Peacekeeping zum Peaceenforcing ein. Am Schluss der Arbeit soll der Frage nachgegangen werden, ob Peacekeeping- oder Peaceenforcing- Einsätze ein geeignetes Mittel zur Herstellung von Frieden in Krisenregionen darstellen, oder ob es anderer Maßnahmen bedarf.
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- 3.I. Einleitung
- II Die humanitäre Intervention der UNO – von Peacekeeping zu Peaceenforcing
- 1. Humanitäre Intervention
- 1.1 Der Begriff der humanitären Intervention
- 1.2 Die völkerrechtliche Betrachtungsweise
- 1.3 Sind humanitäre Einsätze Aufgabe der UNO?
- 2. Die Peacekeeping- Einsätze der UNO
- 2.1 Die Entstehung von Peacekeeping
- 2.2 Ziel und Aufgaben bei Peacekeeping- Einsätzen
- 2.3 Die Problematik von Peacekeeping
- 3. Vom Peacekeeping zum Peaceenforcing
- 3.1 Der Unterschied zwischen Peacekeeping und Peaceenforcing
- 3.2 Das Scheitern von Peaceenforcing in Jugoslawien
- III Fazit und Ausblick
- IV Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Entwicklung von Peacekeeping zu Peaceenforcing im Kontext humanitärer Interventionen der Vereinten Nationen. Die Arbeit untersucht die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen sowie die Herausforderungen und Probleme, die mit diesen Kollektivmaßnahmen verbunden sind.
- Der Begriff der humanitären Intervention und seine völkerrechtliche Einordnung
- Die Entstehung und Entwicklung von Peacekeeping-Einsätzen der UNO
- Die Problematik von Peacekeeping und die Herausforderungen von Peaceenforcing
- Die Rolle der UNO bei der Herstellung von Frieden und Sicherheit
- Die Frage nach der Wirksamkeit von Peacekeeping- und Peaceenforcing-Einsätzen
Zusammenfassung der Kapitel
I Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der humanitären Interventionen der Vereinten Nationen ein und erläutert die Zielsetzung der Arbeit. Sie stellt den Zusammenhang zwischen der Charta der Vereinten Nationen und den Peacekeeping- und Peaceenforcing-Einsätzen her.
II Die humanitäre Intervention der UNO – von Peacekeeping zu Peaceenforcing
1. Humanitäre Intervention
Dieses Kapitel definiert den Begriff der humanitären Intervention und unterscheidet ihn von herkömmlichen Interventionen. Es beleuchtet die völkerrechtlichen Grundlagen für humanitäre Interventionen und stellt die Frage, ob solche Einsätze in den Aufgabenbereich der UNO fallen.
2. Die Peacekeeping- Einsätze der UNO
Dieser Abschnitt widmet sich der Entstehung und Entwicklung von Peacekeeping-Einsätzen. Er beschreibt die Ziele und Aufgaben von Peacekeeping-Missionen sowie die Herausforderungen und Probleme, die mit diesen Einsätzen verbunden sind.
3. Vom Peacekeeping zum Peaceenforcing
Das Kapitel beleuchtet den Unterschied zwischen Peacekeeping und Peaceenforcing und analysiert die Entwicklung von Peacekeeping zu Peaceenforcing. Am Beispiel des Jugoslawien-Konflikts werden die Herausforderungen und das Scheitern von Peaceenforcing beleuchtet.
Schlüsselwörter
Humanitäre Intervention, Peacekeeping, Peaceenforcing, Vereinte Nationen, Charta der Vereinten Nationen, Völkerrecht, Sicherheitsrat, Menschenrechtsverletzungen, Friedenssicherung, Krisenregionen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Peacekeeping und Peaceenforcing?
Peacekeeping erfolgt meist mit Einverständnis der Konfliktparteien und dient der Überwachung von Friedensabkommen, während Peaceenforcing (Friedenserzwingung) militärische Gewalt auch gegen den Willen von Parteien einsetzt.
Welche völkerrechtliche Grundlage haben humanitäre Interventionen?
Die Grundlage bildet die UN-Charta, insbesondere das Ziel, den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren, wobei die Souveränität von Staaten oft im Spannungsfeld steht.
Warum scheiterte Peaceenforcing im Jugoslawien-Konflikt?
Die Arbeit analysiert das Scheitern anhand der komplexen ethnischen Spannungen, unklarer Mandate und der Schwierigkeit, Frieden allein durch militärischen Zwang von außen herzustellen.
Sind humanitäre Einsätze eine Kernaufgabe der UNO?
Ja, gemäß Artikel 1 der UN-Charta ist die Wahrung der internationalen Sicherheit und das Treffen wirksamer Kollektivmaßnahmen eine zentrale Zielsetzung der Vereinten Nationen.
Welche Probleme bringen Peacekeeping-Einsätze mit sich?
Probleme sind oft mangelnde Ressourcen, die Abhängigkeit von der Kooperation der Kriegsparteien und das Risiko, bei Gewalteskalationen machtlos zuzusehen.
- Citation du texte
- Mathias Antusch (Auteur), 2002, Humanitäre Intervention. Die Entwicklung vom Peacekeeping zum Peaceenforcing am Beispiel der UN- Einsätze, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8535