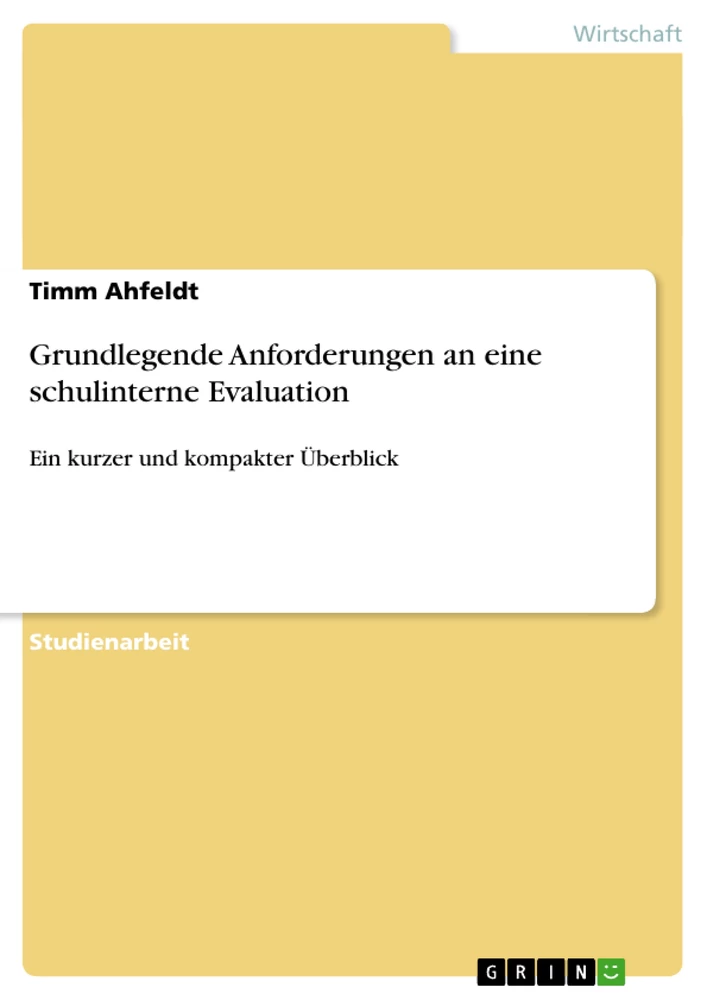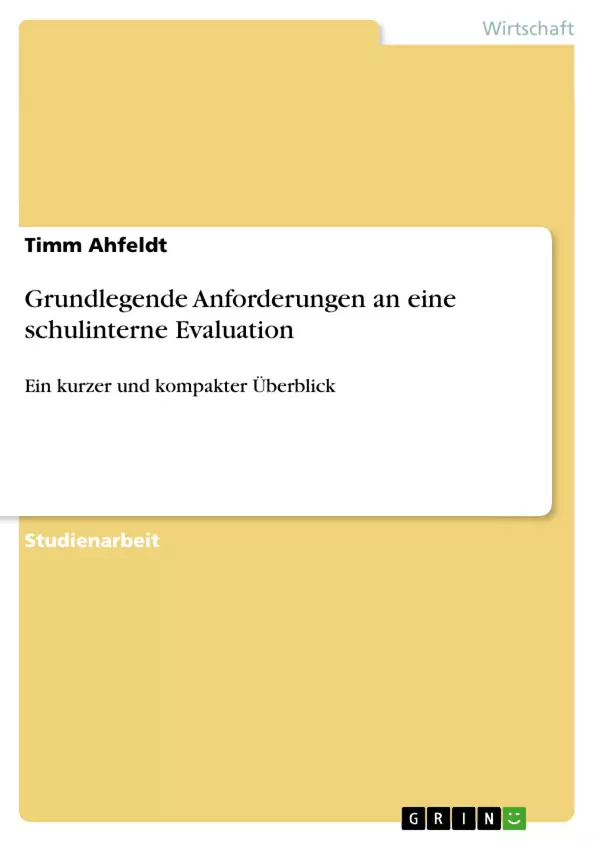Für viele hoch entwickelte Länder hat sich Qualität an Schulen in den letzten Jahren zu einem immer wichtigeren Produktionsfaktor entwickelt. Das Arbeitspotential einer Volkswirtschaft ist längst nicht mehr primär von der Zahl der Arbeitskräfte und dem Altersaufbau, sondern im zunehmenden Maße von seiner eigenen Qualität, sprich Bildung, abhängig. Es geht darum, den Unternehmen in Zukunft genügend qualifizierte Fachkräfte zu liefern, um den Standort Deutschland, im Zuge der unaufhaltsam fortschreitenden Globalisierung, auch in Zukunft noch wettbewerbsfähig halten zu können (Vgl. Schmidt 2007, S. 57).
In diesem Zusammenhang sind natürlich die Schulen und vor allem auch die berufsbildenden Schulen gefragt. Diese stehen in Zeiten zunehmender Schulautonomie, wo sie ihre Arbeit mehr und mehr selbständig gestalten, stärker in der Verantwortung als je zuvor (Vgl. Wyrwal 2006, S. 250). Die Schulen sollten ihre eigene Arbeit deshalb mehr aus einer marktorientierten Sichtweise betrachten und sich selbst als Betrieb zur Herstellung des Produktes Bildung sehen, welches sie über die Schüler dem Kunden, d.h. der Volkswirtschaft verkaufen. Daraus folgt, dass sich die Qualitätspolitik der Schulen an den Bedürfnissen des Kunden und damit an der Gesamtwirtschaft zu orientieren hat. Diese Denkweise könnte den Blick der Schulen dafür schärfen, welcher Fachkräfte es unserer Volkswirtschaft in Zukunft tatsächlich bedarf. Das Produkt Bildung ist nämlich sehr komplex und differenziert. Deshalb müssen sich die Schulen, um bei der marktorientierten Sichtweise zu bleiben, durch Produktdifferenzierung ein eigenes Profil schaffen, was im Grundsatz schon durch die verschiedenen Schulformen geschieht. Dies ist allerdings im Bereich der beruflichen Schulen durch die Ausrichtung auf berufliche Kompetenzen weiter zu schärfen (Vgl. Schmidt 2007, S. 60 f.).
Sich ein eigenes, differenziertes Profil zu verschaffen, verstärkt aber auch die Forderung, die schulischen und außerschulischen Prozesse fortlaufend zu evaluieren. Evaluation meint dabei „die systematische Untersuchung der Qualität bzw. des Nutzens eines Gegenstands“ (Hense 2006, S. 23). Auf die Organisation Schule bezogen soll Evaluation die Weiterentwicklung des Unterrichts unterstützen und ist ein Instrument, den Erfolg und die Wirksamkeit der gemeinsamen Arbeit zu überprüfen und die Arbeit des Betriebs Schule zu optimieren (Vgl. Schmidt 2007, S. 59; Strittmatter 1998, S. 219).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Aufgaben- und Zielformulierung
- 2. Grundlegende Anforderungen an die Selbstevaluation
- 2.1 Sinnhaftigkeit, Einstellung und Haltung
- 2.2 Konzeptionelle Vorüberlegungen
- 2.3 Planung, Durchführung und Auswertung
- 3. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit den grundlegenden Anforderungen an eine schulinterne Evaluation. Ziel ist es, einen Überblick über die wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Selbstevaluation zu schaffen. Diese Anforderungen können unabhängig von der Schulform auf jede Selbstevaluation angewendet werden und umfassen Aspekte der Sinnhaftigkeit, konzeptionellen Vorüberlegungen, Planung, Durchführung und Auswertung.
- Sinnhaftigkeit und Relevanz der schulischen Selbstevaluation
- Wichtigkeit der Einstellung und Haltung gegenüber Evaluation
- Konzeptionelle Grundvoraussetzungen für eine erfolgreiche Selbstevaluation
- Praktische Aspekte der Planung, Durchführung und Auswertung von Evaluationsprojekten
- Beitrag der Selbstevaluation zur Qualitätsentwicklung und Profilierung der Schule
Zusammenfassung der Kapitel
1. Aufgaben- und Zielformulierung
Dieses Kapitel untersucht die zunehmende Bedeutung von Qualität in Schulen und die Rolle der Selbstevaluation in der Qualitätsentwicklung. Es wird betont, dass Schulen zunehmend eigenverantwortlich ihre Arbeit gestalten und daher die Notwendigkeit zur Selbstevaluation steigt.
2. Grundlegende Anforderungen an die Selbstevaluation
2.1 Sinnhaftigkeit, Einstellung und Haltung
Der Abschnitt 2.1 beleuchtet die Bedeutung der Einstellung und Haltung gegenüber Evaluation. Die Autoren argumentieren, dass Schulen eine positive und konstruktive Haltung gegenüber Evaluation entwickeln müssen, um den Nutzen der Selbstevaluation zu maximieren. Auch wird die Notwendigkeit einer Abkehr von einer defizitorientierten Sichtweise auf Evaluation betont.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter schulinterner Selbstevaluation?
Selbstevaluation ist die systematische Untersuchung der Qualität und des Nutzens der eigenen Arbeit durch die Schule selbst, um Unterricht und Prozesse zu optimieren.
Warum ist Evaluation für berufsbildende Schulen heute so wichtig?
In Zeiten zunehmender Schulautonomie tragen Schulen mehr Eigenverantwortung für ihr Profil und müssen sicherstellen, dass sie qualifizierte Fachkräfte für die globale Wirtschaft hervorbringen.
Welche Haltung ist für eine erfolgreiche Evaluation nötig?
Schulen sollten eine positive, konstruktive Haltung einnehmen und sich von einer rein defizitorientierten Sichtweise lösen, um Evaluation als Chance zur Weiterentwicklung zu begreifen.
Was sind die Phasen eines Evaluationsprojekts?
Ein typisches Projekt umfasst die konzeptionelle Vorüberlegung, die detaillierte Planung, die Durchführung der Datenerhebung und die abschließende Auswertung.
Wie hängen Schulprofil und Evaluation zusammen?
Durch Evaluation können Schulen ihr spezifisches Profil (z.B. Ausrichtung auf bestimmte berufliche Kompetenzen) schärfen und dessen Wirksamkeit gegenüber der Volkswirtschaft belegen.
- Quote paper
- Timm Ahfeldt (Author), 2007, Grundlegende Anforderungen an eine schulinterne Evaluation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85371