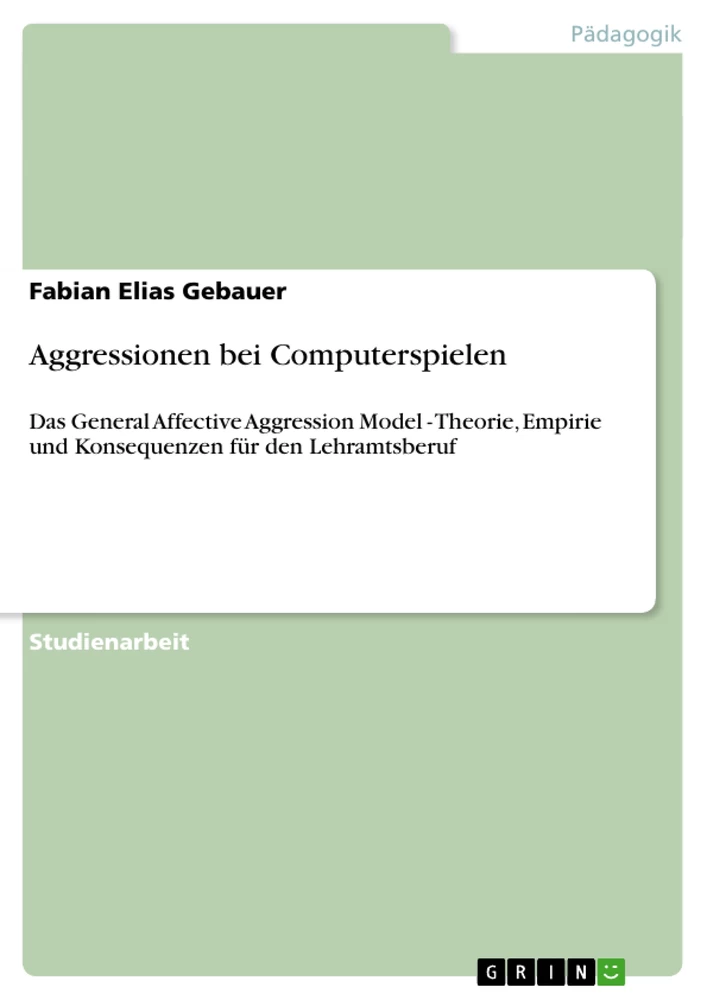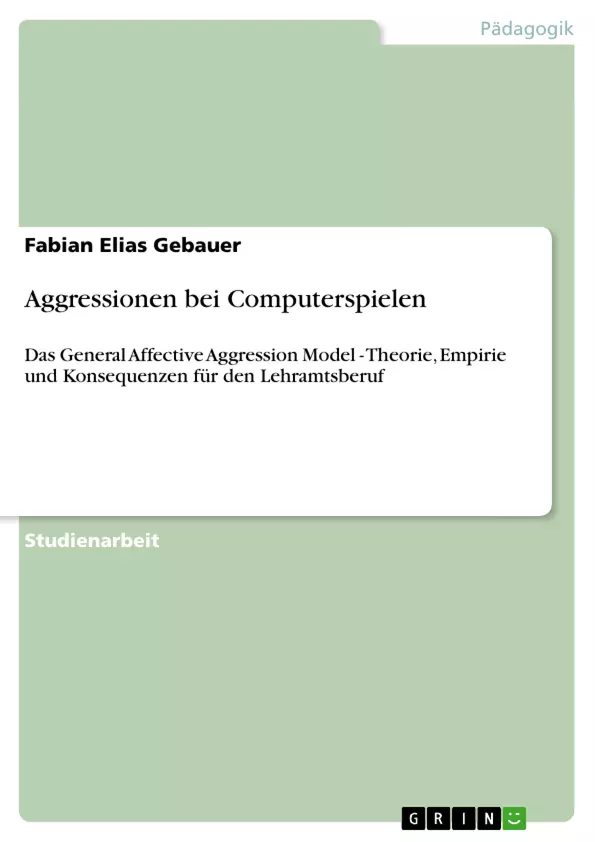[Aus der Einleitung] Seit dem Schulmassaker in Littleton am 20. April 1999 diskutiert die deutsche Öffentlichkeit über ein mögliches Verbot von ‚Killerspielen‘, jenen Computerspielen also, in denen der Spieler in 3D-Perspektive durch eine virtuelle Actionwelt rennt und – so der Vorwurf – als alleiniges Ziel das brutale Abschlachten von Gegnern, seien es Terroristen oder unschuldige Passanten, hat. Auch Robert Steinhäuser setzte sich häufig an den PC um Counter-Strike zu spielen – ebenso ein Spiel, dessen Reiz sich größtenteils auf die Ausschaltung von anderen Spielern beschränkt. Am 24.06.2002 beendete er sein Leben, nachdem er 16 Menschen an seiner ehemaligen Schule, dem Erfurter Johann-Gutenberg-Gymnasium, mit einer Pistole umgebracht hatte, wobei sein martialischer Auftritt mit Sturmhaube und schwarzer Kleidung Parallelen zu den Protagonisten des Computerspiels erkennen ließen.
Spätestens seit dieser Tat wird im öffentlichen Diskurs angenommen, dass häufige Ausübung von brutalen Gewaltakten in Computerspielen die Bereitschaft zu Gewalttaten in der realen Welt äußerst stark fördert. Diese Annahme führte nicht nur zu einem neuen Jugendschutzgesetz, sondern einer beständigen Forderung verschiedener Politiker nach einem kompletten Verbot von ‚Killerspielen‘, welches unablässig gefordert wird. Bei soviel politischer Überzeugung entsteht die Frage, ob das Bild, welches Politiker und Medien der Öffentlichkeit von solchen Computerspielen suggerieren, wissenschaftlich fundiert ist, ob gewalttätige Handlungen in der Virtualität Rückschlüsse auf die Gewaltbereitschaft des Spielers in der realen Welt möglich machen.
Katharsisthese, Erregungsthese, Suggestionsthese, Habitualisierungsthese und noch viele andere stellten die Wissenschaftler auf, ohne jedoch einen Konsens finden zu können, da keine dieser Modelle als Antwort ausreicht. In der nachfolgenden Arbeit, soll das General Affective Aggression Model (GAAM) – das aktuell modernste Modell – zusammen mit zwei auf dem GAAM basierenden empirischen Studien vorgestellt und kritisch besprochen werden. Hiernach werden mögliche Konsequenzen für die pädagogische Arbeit des Lehrers thematisiert, wobei dafür Schulkinder und ihr Konsum von gewalthaltigen Computerspielen in den Fokus rücken. Im Fazit soll – soweit möglich – ein Urteil zu der Annahme, dass Gewalt in Computerspielen zu einer Aggressions-Steigerung führe und Gewaltbereitschaf in der Realität fördere, gefällt und das GAAM abschließend reflektiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das General Affective Aggression Model
- Kurzfristige Auswirkungen von gewalthaltigen Computerspielen
- Langfristige Auswirkungen von gewalthaltigen Computerspielen
- Empirische Studien zum GAAM
- Anderson & Dill: Kurz- und langfristige Auswirkungen von gewalthaltigen Computerspielen
- Frindte & Obwexer: Kurzfristige Auswirkungen von gewalthaltigen Computerspielen
- Zusammenfassung
- Konsequenzen für den Lehramtsberuf
- Medienkonsum der 12- bis 19-Jährigen
- Persönliche Konsequenzen für mich als Lehrer
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Thematik von Aggressionen bei Computerspielen, insbesondere im Kontext des General Affective Aggression Model (GAAM). Ziel ist es, das GAAM als aktuelles Modell zur Erklärung der Wirkung von Computerspielen auf Aggression zu untersuchen und seine empirische Fundierung zu beleuchten. Zudem sollen die Konsequenzen für den Lehramtsberuf im Hinblick auf den Medienkonsum von Jugendlichen beleuchtet werden.
- Das General Affective Aggression Model als Erklärung für die Wirkung von Computerspielen auf Aggression.
- Empirische Studien zum GAAM und deren Ergebnisse.
- Die Relevanz des GAAM für die pädagogische Praxis, insbesondere im Umgang mit Computerspielen im Unterricht.
- Der Einfluss von Computerspielen auf die Entwicklung von Aggression bei Jugendlichen.
- Mögliche Konsequenzen für den Lehramtsberuf im Umgang mit dieser Thematik.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung thematisiert die öffentliche Diskussion um "Killerspiele" im Kontext von Schulmassakern und stellt die Frage nach der wissenschaftlichen Fundierung der Annahme, dass Computerspiele die Gewaltbereitschaft erhöhen. Sie führt verschiedene Theorien zur Wirkung von Mediengewalt an und kündigt die Untersuchung des General Affective Aggression Model (GAAM) an.
- Das General Affective Aggression Model: Dieses Kapitel präsentiert das GAAM als ein kognitives Modell, das die kurz- und langfristigen Auswirkungen von Computerspielen auf Aggression erklärt. Dabei werden die verschiedenen Ebenen des Modells (Input Variablen, Appraisal Processes und Output) erläutert.
- Kurzfristige Auswirkungen von gewalthaltigen Computerspielen: Hier werden die kurzfristigen Effekte des GAAM im Detail beschrieben. Der Kreislauf der Aggression wird dargestellt, wobei die Input Variablen, die appraisal Prozesse und die Auswirkung auf das Verhalten des Spielers beleuchtet werden.
- Langfristige Auswirkungen von gewalthaltigen Computerspielen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die langfristigen Auswirkungen von gewalthaltigen Computerspielen, die durch das GAAM erklärt werden können. Es wird darauf eingegangen, wie sich wiederholter Konsum von gewalthaltigen Spielen auf die Persönlichkeit und das Verhalten des Spielers auswirken kann.
- Empirische Studien zum GAAM: In diesem Kapitel werden zwei empirische Studien vorgestellt, die das GAAM untersuchen. Die Studien von Anderson & Dill sowie Frindte & Obwexer werden zusammengefasst und kritisch bewertet.
- Konsequenzen für den Lehramtsberuf: Hier wird der Fokus auf die Relevanz des GAAM für die pädagogische Arbeit gelegt. Der Medienkonsum von Jugendlichen und die möglichen Folgen für die Entwicklung von Aggression werden beleuchtet. Zudem werden persönliche Konsequenzen für den Lehrer im Umgang mit dieser Thematik aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Aggression, Computerspiele, General Affective Aggression Model (GAAM), Mediengewalt, Medienkonsum, Jugendlicher, Lehramtsberuf, Empirische Studien, Kurz- und Langfristige Auswirkungen, Gewaltbereitschaft, Pädagogische Praxis.
Häufig gestellte Fragen
Führen gewalthaltige Computerspiele zu realer Gewalt?
Die Arbeit untersucht diese Frage anhand des General Affective Aggression Model (GAAM) und kommt zu dem Schluss, dass es keine einfache Antwort, aber messbare Einflüsse auf die Aggressionsbereitschaft gibt.
Was erklärt das General Affective Aggression Model (GAAM)?
Das GAAM ist ein kognitives Modell, das beschreibt, wie Input-Variablen (wie Spielinhalte) kurz- und langfristig die Persönlichkeit und das Aggressionsverhalten beeinflussen können.
Was sind die langfristigen Auswirkungen von "Killerspielen"?
Wiederholter Konsum kann laut GAAM zur Habitualisierung (Gewöhnung) an Gewalt führen und aggressive Denkmuster in der Persönlichkeit verankern.
Welche Konsequenzen ergeben sich für Lehrer?
Lehrer müssen für den Medienkonsum ihrer Schüler sensibilisiert sein und medienpädagogische Ansätze nutzen, um einen kritischen Umgang mit Gewaltspielen zu fördern.
Was besagt die Katharsisthese?
Die Katharsisthese behauptet, dass das Ausleben von virtueller Gewalt Aggressionen abbaut – eine Theorie, die durch moderne Modelle wie das GAAM weitgehend widerlegt wurde.
- Arbeit zitieren
- Fabian Elias Gebauer (Autor:in), 2007, Aggressionen bei Computerspielen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85422