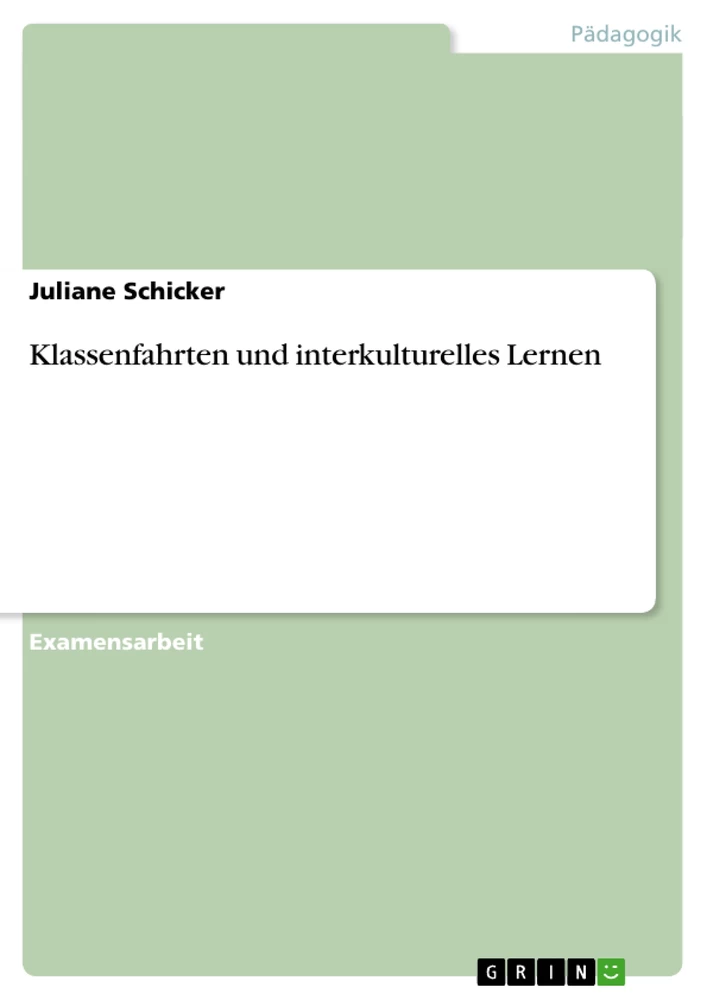In dieser Arbeit möchte ich ausgehend von meinen persönlichen Erfahrungen darstellen, wie internationale Klassenfahrten mit Schülern gestaltet werden müssen, damit diese mit Hilfe der Verständigungssprache Englisch interkulturell lernen können. Interkulturelles Lernen ist ein Schwerpunkt der Englischdidaktik: Schüler sollen andere Kulturen kennen lernen und ihre Erfahrungen mit fremden Menschen, Sprachen und Bräuchen auf der Basis ihrer eigenen Kultur machen. Im Klassenraum interkulturell zu arbeiten ist möglich, wie viele Publikationen zeigen. Ich erlebte aber in meinen Hospitationen und Praktika an sachsen-anhaltinischen Schulen und meinen Nachhilfetätigkeiten mit Schülern, dass es sich als schwierig erweist, den Schülern dort reale interkulturelle Situationen zu bieten. Ich musste feststellen, dass der Englischunterricht konstruiert ist und auf die Institution Schule begrenzt bleibt, d.h. nicht die Lebenswirklichkeit der Schüler einbezieht.
Zunächst erscheint es mir angesichts der zahlreichen Publikationen zum Thema „Inter-kulturellen Lernen“ wichtig, eine Orientierung für den Leser zu schaffen, was interkulturelles Lernen bedeutet und welche Konzepte es umfasst. Im zweiten Kapitel wird daher versucht, durch ein stimmiges Kultur-Konzept die beim interkulturellen Lernen zu erwerbenden interkulturellen Kompetenzen und ihre Integration in das schulische Lernen zu rechtfertigen. Im dritten Kapitel stelle ich kurz unterschiedliche Konzepte internationaler Begegnungen vor und diskutiere ihren Wert für das interkulturelle Lernen. Danach werden wissenschaftliche Erkenntnisse zur Organisation einer für den Erwerb der interkulturellen Kompetenz wertvollen Begegnung zusammengetragen und mit praktischen Beispielen versehen. Im vierten Kapitel werden Fragebögen ausgewertet, die von fünf Lehrerinnen, die selbst eine internationale Begegnung durchgeführt haben, ausgefüllt wurden. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse vergleiche ich mit den theoretischen Gesichtspunkten aus den vorangegangenen Kapiteln und bewerte sie. Im Anhang ist eine tabellarische und teilweise auch grafische Auswertung der Fragen zu finden. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vorwort
- Einleitende Bemerkungen
- Definition „Internationale Klassenfahrten“
- Zum Aufbau der Arbeit
- Theoretische Grundlagen
- Interkulturelles Lernen – Lernen in Kulturen
- Die im Schüleraustausch zu entwickelnden Kompetenzen innerhalb der verschiedenen Stufen interkulturellen Lernens
- Stufe 1 - Ethnozentrismus
- Stufe 2 - Ethnorelativismus
- Grenzen eines lern- und prozessorientierten Englischunterrichts – Ein Plädoyer für die internationale Klassenfahrt
- Internationale Klassenfahrten - Begegnung mit anderen Kulturen
- Der Wert internationaler Klassenfahrten
- Verschiedene Typen internationaler Klassenfahrten
- Internationale Klassenfahrten
- Gestaltung der Planung
- Gestaltung der Durchführung
- Gestaltung der Nachbereitung
- Fragebogenauswertungen
- „Teil I: Persönliche Fragen“ (Fragen A1 bis A23)
- „Teil II: Allgemeine Informationen zum Austausch an Ihrer Schule (englischsprachige Austausche)“ (Fragen B1 bis B29)
- „Teil III: Meinungen zum Austausch“ (Fragen C1 bis C10)
- Zusammenfassung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Bedeutung von Klassenfahrten für interkulturelles Lernen. Die Arbeit untersucht, wie Klassenfahrten Schüler*innen dabei unterstützen können, andere Kulturen kennenzulernen und interkulturelle Kompetenzen zu entwickeln. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Planung, Durchführung und Nachbereitung internationaler Klassenfahrten gelegt.
- Interkulturelles Lernen als pädagogisches Ziel
- Die Rolle von Klassenfahrten bei der Förderung interkultureller Kompetenzen
- Praxisbeispiele und Erfahrungen aus der Perspektive von Schüler*innen und Lehrkräften
- Die Bedeutung von Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung für den Lernerfolg
- Herausforderungen und Chancen im Bereich der internationalen Klassenfahrten
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Bedeutung von interkulturellem Lernen. Sie definiert den Begriff „Internationale Klassenfahrten“ und skizziert den Aufbau der Arbeit.
- Das zweite Kapitel beleuchtet die theoretischen Grundlagen des interkulturellen Lernens. Es diskutiert die verschiedenen Stufen interkulturellen Lernens und die damit verbundenen Kompetenzen. Außerdem werden die Grenzen eines lern- und prozessorientierten Englischunterrichts im Kontext von Klassenfahrten reflektiert.
- Das dritte Kapitel widmet sich den internationalen Klassenfahrten als Begegnung mit anderen Kulturen. Es beleuchtet den Wert dieser Reisen für die Entwicklung interkultureller Kompetenzen und analysiert verschiedene Typen von Klassenfahrten. Der Schwerpunkt liegt auf der Planung, Durchführung und Nachbereitung von Klassenfahrten.
- Das vierte Kapitel präsentiert Ergebnisse einer Fragebogenanalyse, die Einblicke in die Erfahrungen und Meinungen von Schüler*innen und Lehrkräften zu internationalen Klassenfahrten liefert.
Schlüsselwörter
Interkulturelles Lernen, Klassenfahrten, Schüleraustausch, Fremdsprachenunterricht, interkulturelle Kompetenz, Kulturelle Begegnung, Bildungsreisen, pädagogische Praxis, Lernerfahrungen, Fragebogenanalyse, Empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet interkulturelles Lernen im Englischunterricht?
Schüler sollen fremde Kulturen, Sprachen und Bräuche kennenlernen und diese Erfahrungen auf Basis ihrer eigenen Kultur reflektieren.
Warum sind internationale Klassenfahrten so wertvoll?
Sie bieten reale interkulturelle Situationen, die im oft konstruierten und auf die Schule begrenzten Englischunterricht nur schwer simuliert werden können.
Welche Stufen des interkulturellen Lernens gibt es?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Stufe 1 (Ethnozentrismus) und Stufe 2 (Ethnorelativismus), die Schüler während eines Austauschs durchlaufen können.
Was ist bei der Planung einer internationalen Klassenfahrt wichtig?
Eine sorgfältige Gestaltung der Vorbereitung, Durchführung und insbesondere der Nachbereitung ist entscheidend, um den Erwerb interkultureller Kompetenz zu sichern.
Welche Rolle spielt die Sprache Englisch bei diesen Reisen?
Englisch dient als Verständigungssprache (Lingua Franca), um die Kommunikation in realen Begegnungssituationen mit Menschen anderer Kulturen zu ermöglichen.
- Quote paper
- Juliane Schicker (Author), 2007, Klassenfahrten und interkulturelles Lernen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85580