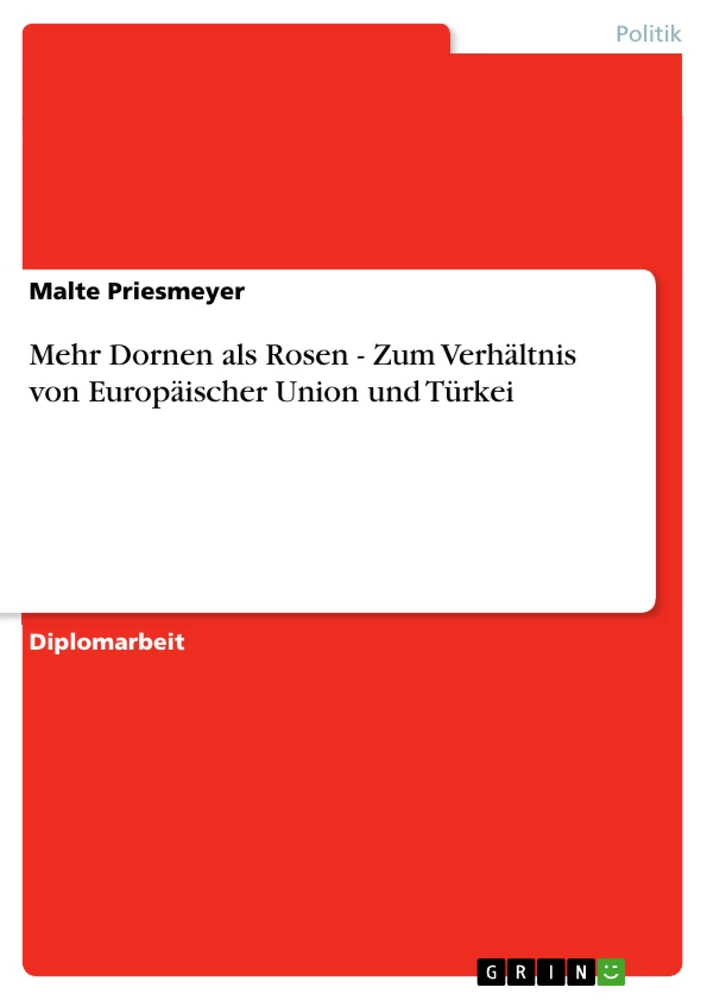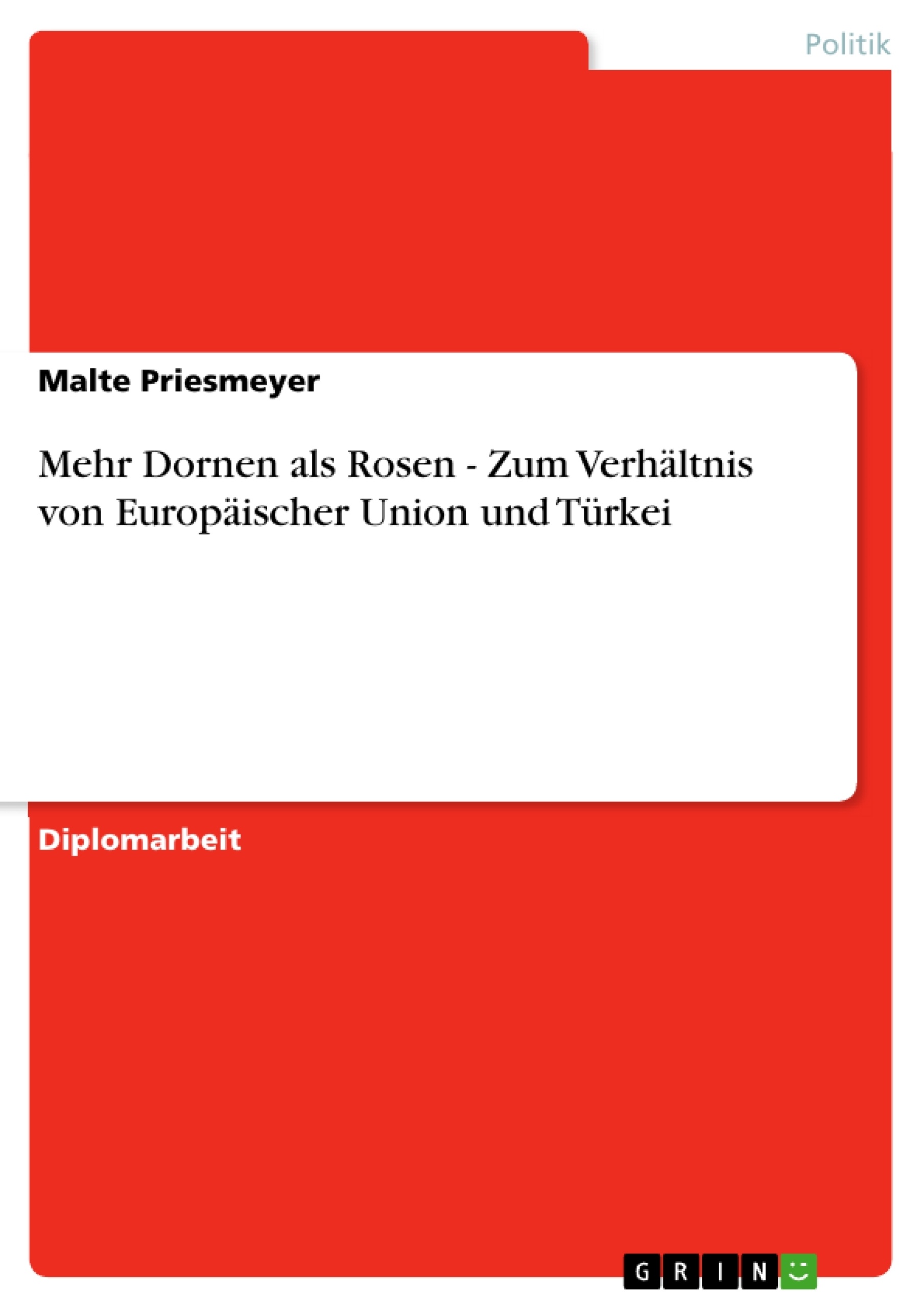"Die Europäische Union hat für das dritte Jahrtausend zwei Antworten in Richtung Türkei (…) zur Auswahl: 1) Wir verrammeln die Tore Europas vor Euch, weil Euer Land ökonomisch und sozial instabil ist, Menschenrechte verletzt werden und fundamentalistische Strömungen stärker werden. Oder 2) Wir öffnen Euch die Tore Europas, gerade weil Ihr in Schwierigkeiten steckt, wir gliedern Euch ein, um Euch zu helfen, den Marsch nach Europa weiterzuführen."
Auf den ersten Blick scheint es, daß Europa wohl den zweiten Weg gehen wird, denn der Europäische Rat von Helsinki hat am 10. und 11. Dezember 1999 die Republik Türkei in den Kreis der Kandidaten für den Beitritt zur Europäischen Union aufgenommen. Das Signal bleibt freilich deklaratorisch, denn die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen ist mit diesem Beschluß zunächst nicht verbunden - und wird es auf der Grundlage des letzten EU-Kommissionsberichts auch nicht werden. .
Kann die Europäische Union mit der Türkei auf absehbare Zeit Beitrittsverhandlungen beginnen, vom Beitritt selbst ganz zu schweigen? Besteht in der EU der Wille, die Türkei eines Tages aufzunehmen? Und liegt die Vollmitgliedschaft überhaupt im Interesse der Türkei selbst? Diesen Fragen wird im Laufe der vorliegenden Arbeit nachgegangen, schwerpunktmäßig anhand der aktuellen Entwicklungen der zweiten Hälfte der 1990er Jahre.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Überblick
- ,,Der Westen“ als Ziel
- Die türkische ,,Westbindung“
- Das Konzept
- Die Westbindung der Republik Türkei
- Die Assoziierung mit der Europäischen Gemeinschaft
- „Kopenhagen“ – die Regeln für den Beitritt
- Die Türkei - ein Europäischer Staat?
- Politisches System und Demokratische Strukturen
- Parlament und Regierung
- Justizwesen und Korruptionsbekämpfung
- Politischer Einfluß des Militärs
- Menschenrechte und Minderheiten
- Menschenrechtsverletzungen
- Die Todesstrafe
- Minderheitenprobleme und Minderheitenschutz
- Zwischenergebnis: die Türkei – ein Europäischer Staat
- Reif für den Binnenmarkt?
- Warum eine Zollunion? Der theoretische Rahmen
- Die Praxis türkischer Wirtschaftskraft: zwischen Estland und Polen
- Die gespaltene“ Volkswirtschaft
- Der Arbeitsmarkt: wird Europa „überflutet“?
- Schon integriert? Der türkische Außenhandel
- Der Zollunionvertrag und die Zollunion
- Gemeinsame Handelsbeziehungen in der Zollunion
- Viel Arbeit: der „Gemeinschaftsrechtliche Besitzstand“
- Das Paket,,Zollunion“
- Das Paket,,Europäische Strategie“
- Sonstige Bereiche des GRBSt
- Zwischenergebnis: nicht reif für den Binnenmarkt
- Gefährdet Ankara die Stabilität der EU?
- Die Türkei und die GASP
- Die außenpolitische Lage der Türkei
- Der Streit mit Griechenland I: Die Zypernfrage
- Der Streit mit Griechenland II: Die Ägäisfrage
- Weitere Fragen einer türkischen EU-Mitgliedschaft
- Auswirkungen auf das institutionelle Gleichgewicht
- Die Positionen der Mitgliedstaaten und der anderen Kandidaten
- Zwischenergebnis: überschaubare Risiken für die EU
- Ankara muß ins Boot. Plädoyer für eine glaubwürdige Beitrittsstrategie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit analysiert das Verhältnis der Europäischen Union zur Türkei und setzt sich kritisch mit der Frage auseinander, ob ein Beitritt der Türkei in absehbarer Zeit realistisch ist. Dabei wird insbesondere die aktuelle Entwicklung in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre betrachtet.
- Die Türkei und die ,,Westbindung“
- Die türkische Demokratie und ihre politische und wirtschaftliche Situation im Kontext der europäischen Kriterien
- Die Rolle des Militärs in der türkischen Politik
- Die Auswirkungen einer türkischen Mitgliedschaft auf die Stabilität der EU
- Die Herausforderungen und Chancen für die Türkei im Hinblick auf einen Beitritt
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Diplomarbeit stellt die zentrale Frage nach der Möglichkeit eines Beitritts der Türkei zur Europäischen Union in den Kontext der aktuellen Debatte. Sie skizziert den Weg der türkisch-westlichen Beziehungen bis zum Europäischen Rat von Helsinki 1999, der die Türkei als Beitrittskandidaten akzeptierte.
- ,,Der Westen“ als Ziel: Dieses Kapitel analysiert die türkische ,,Westbindung“, die sich auf die Annäherung und Integration in europäische Strukturen bezieht. Die Geschichte der türkischen Annäherung an den Westen wird beleuchtet, insbesondere die Assoziierung mit der Europäischen Gemeinschaft und die Anwendung der „Kopenhagen“-Kriterien.
- Die Türkei - ein Europäischer Staat?: Dieses Kapitel untersucht die türkische Demokratie und deren Entwicklung im Hinblick auf die europäischen Anforderungen. Themen wie das politische System, die Rolle des Militärs, der Menschenrechtsschutz und die Lage von Minderheiten werden analysiert.
- Reif für den Binnenmarkt?: Dieses Kapitel befasst sich mit der wirtschaftlichen Situation der Türkei und ihrer Fähigkeit zur Integration in den EU-Binnenmarkt. Die türkische Wirtschaftskraft wird im Vergleich zu anderen Beitrittskandidaten betrachtet, sowie die Herausforderungen im Bereich des Arbeitsmarktes und der Übernahme des „Gemeinschaftsrechtlichen Besitzstandes“.
- Gefährdet Ankara die Stabilität der EU?: Dieses Kapitel untersucht die außenpolitische Lage der Türkei und analysiert die potenziellen Auswirkungen einer türkischen Mitgliedschaft auf die Stabilität der EU. Die Konflikte mit Griechenland um Zypern und die Ägäis stehen im Zentrum der Diskussion.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Türkei und ihren Beziehungen zur Europäischen Union. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Türkei, Europäische Union, Beitritt, Demokratie, Menschenrechte, Minderheiten, Wirtschaft, Zollunion, Außenpolitik, Stabilität, Ägäisfrage, Zypernfrage.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bedeutung hatte der EU-Gipfel von Helsinki 1999 für die Türkei?
In Helsinki wurde die Türkei offiziell als Beitrittskandidat für die Europäische Union anerkannt, was einen Meilenstein in den türkisch-europäischen Beziehungen darstellte.
Was sind die Kopenhagener Kriterien?
Dies sind die Voraussetzungen für einen EU-Beitritt, darunter eine stabile Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die Wahrung der Menschenrechte und eine funktionsfähige Marktwirtschaft.
Welche Rolle spielt das türkische Militär in der Politik?
Die Arbeit analysiert den traditionell starken politischen Einfluss des Militärs in der Türkei, der oft im Konflikt mit den demokratischen Standards der EU stand.
Was ist die Zollunion zwischen der EU und der Türkei?
Die Zollunion ermöglicht den freien Warenverkehr für Industrieprodukte und war ein wichtiger Schritt zur wirtschaftlichen Integration der Türkei in den europäischen Binnenmarkt.
Was sind die größten Hindernisse für einen EU-Beitritt der Türkei?
Die Arbeit nennt Menschenrechtsfragen, Minderheitenprobleme (z.B. die Kurdenfrage), wirtschaftliche Instabilität und außenpolitische Konflikte (Zypern, Ägäis) als zentrale Hürden.
- Quote paper
- Malte Priesmeyer (Author), 2000, Mehr Dornen als Rosen - Zum Verhältnis von Europäischer Union und Türkei, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8559