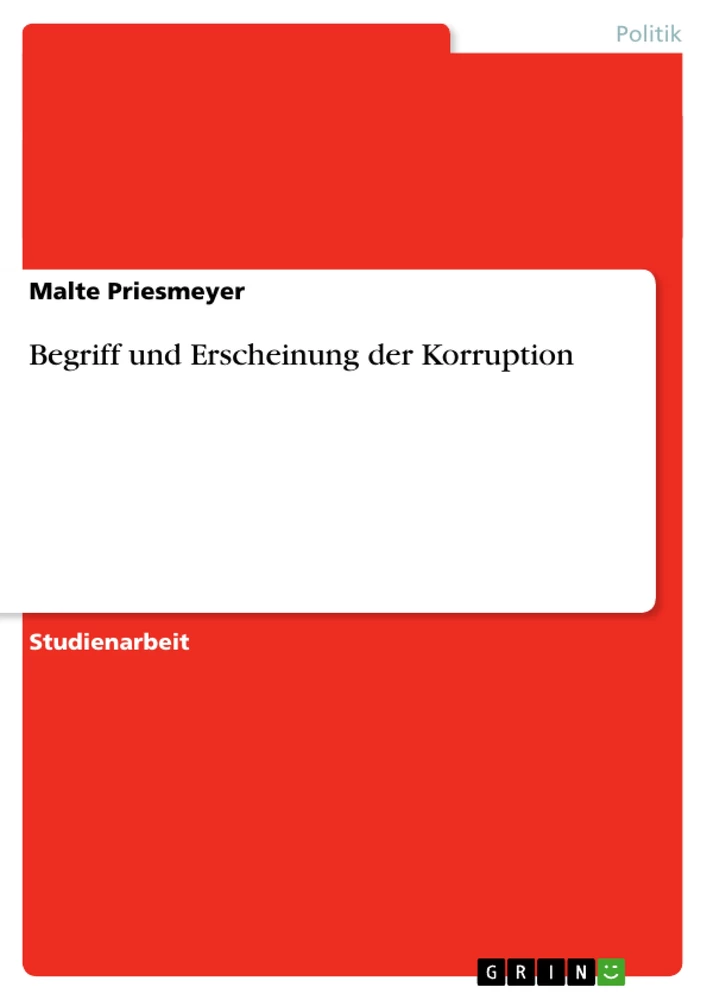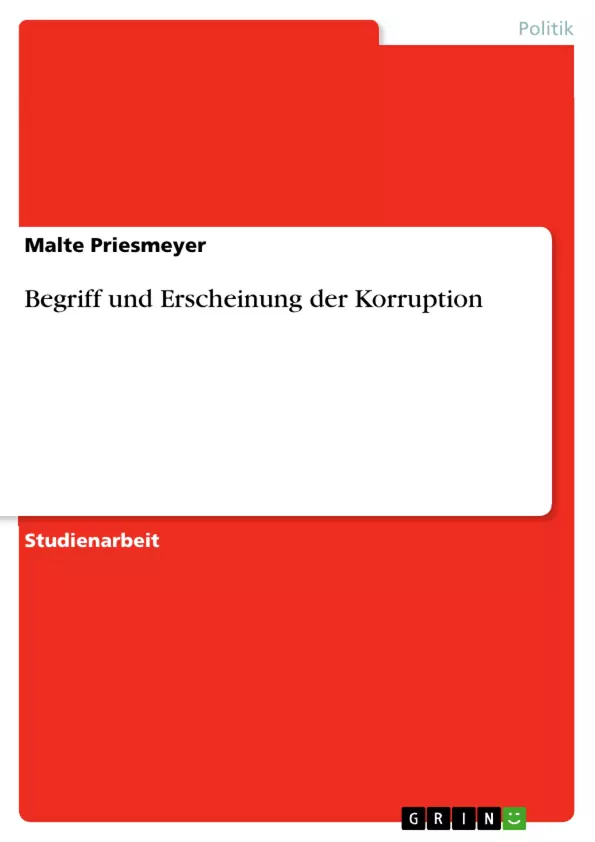Zum Thema "Korruption" begegnen dem interessierten Leser allein in der deutschsprachigen Literatur Unmengen verschiedener Meinungen, Blickwinkel und mit ihr befaßter Wissenschaftsdisziplinen. Juristen, Soziologen, Politik- und Wirtschaftswissenschaftler, sogar Theologen finden sich unter den Autoren. Die vorliegende Arbeit konzentriert sich im Folgenden vor allem auf die sozialwissenschaftliche "Blickrichtung". Gezeigt werden soll, wie schwer es ist, "Korruption" als Begriff - und damit als Vorgang - klar einzugrenzen. Dazu wird zunächst die Bandbreite der Versuche zur Begriffsbestimmung dargestellt, ergänzt um einen Blick auf die Prämissen solcher Definitionsversuche. Es folgt eine kurze Übersicht der Erscheinungsformen und Ursachen von Korruption. Auch auf die für den modernen Staat durchaus problematischen Folgen der Korruption sollen beleuchtet werden. Hierzu werden die Erklärungs- und Darstellungsansätze den Wirkungen von Korruption zugeordnet. Den Abschluß bildet das sich aus den Folgen der Korruption ergebende Problembild sowie diverse Anregungen zur Korruptionsbekämpfung.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- "Der" Begriff der Korruption
- Geltungsbedingungen der Korruptionsbegriffe
- Systematik der Formen und Ursachen von Korruption
- Darstellungskriterien der Korruption
- Folgen der Korruption und Korruptionsbekämpfung
- Schlußbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Begriff der Korruption aus sozialwissenschaftlicher Perspektive und beleuchtet die Schwierigkeiten, diesen Begriff klar einzugrenzen. Sie analysiert die verschiedenen Definitionsansätze, zeigt die Erscheinungsformen und Ursachen von Korruption auf und betrachtet die problematischen Folgen für den modernen Staat. Abschließend werden verschiedene Ansätze zur Korruptionsbekämpfung vorgestellt.
- Definition und Abgrenzung des Begriffs "Korruption"
- Analyse der verschiedenen Definitionsansätze
- Erscheinungsformen und Ursachen von Korruption
- Folgen von Korruption für den modernen Staat
- Ansätze zur Korruptionsbekämpfung
Zusammenfassung der Kapitel
-
Vorbemerkung
Die Einleitung stellt die Vielfältigkeit der Perspektiven auf das Thema Korruption in der Literatur dar und fokussiert auf die sozialwissenschaftliche Betrachtungsweise. Sie betont die Komplexität des Begriffs und die Schwierigkeiten seiner Einordnung.
-
"Der" Begriff der Korruption
Dieses Kapitel beleuchtet die Schwierigkeiten, einen einheitlichen Korruptionsbegriff zu finden. Es zeigt die Vielfalt der Definitionsansätze in der Literatur auf und analysiert die Grenzen derartiger Versuche. Zudem werden die strafrechtlichen Definitionen von Korruption im deutschen Strafgesetzbuch und die Definition von Werner Vahlenkamp vorgestellt, die Korruption als Missbrauch einer amtlichen oder wirtschaftlichen Funktion mit dem Ziel, einen persönlichen Vorteil zu erlangen, definiert.
-
Geltungsbedingungen der Korruptionsbegriffe
Dieses Kapitel wird sich mit den Bedingungen befassen, die für die verschiedenen Korruptionsbegriffe gelten. Es wird untersucht, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit ein Verhalten als Korruption eingestuft werden kann.
-
Systematik der Formen und Ursachen von Korruption
Dieses Kapitel behandelt die verschiedenen Formen und Ursachen von Korruption. Es soll untersucht werden, welche Arten von Korruption es gibt und welche Faktoren zu ihrem Auftreten beitragen.
-
Darstellungskriterien der Korruption
Dieses Kapitel stellt die Kriterien vor, anhand derer Korruption dargestellt werden kann. Es soll untersucht werden, welche Merkmale Korruption auszeichnen und wie sie gemessen werden kann.
-
Folgen der Korruption und Korruptionsbekämpfung
Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Folgen von Korruption und den Möglichkeiten ihrer Bekämpfung. Es untersucht, welche negativen Auswirkungen Korruption auf Gesellschaft und Wirtschaft hat und welche Maßnahmen zur Bekämpfung der Korruption ergriffen werden können.
Schlüsselwörter
Korruption, Begriff, Definition, Erscheinungsformen, Ursachen, Folgen, Korruptionsbekämpfung, sozialwissenschaftliche Perspektive, Strafgesetzbuch, moderne Gesellschaft, staatliche Institutionen, wirtschaftliche Entwicklung, ethische Normen.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Korruption sozialwissenschaftlich definiert?
Korruption wird oft als Missbrauch einer amtlichen oder wirtschaftlichen Funktion definiert, um einen persönlichen Vorteil zu erlangen, wobei eine klare Abgrenzung schwierig bleibt.
Welche Erscheinungsformen von Korruption gibt es?
Die Arbeit untersucht verschiedene Formen, von Bestechung im öffentlichen Dienst bis hin zu korruptiven Netzwerken in der Wirtschaft.
Was sind die Hauptursachen für Korruption?
Ursachen liegen häufig in mangelnden Kontrollmechanismen, ökonomischen Anreizen, aber auch in gesellschaftlichen Normen und ethischen Defiziten.
Welche Folgen hat Korruption für den Staat?
Korruption untergräbt das Vertrauen in staatliche Institutionen, verzerrt den Wettbewerb und schadet der wirtschaftlichen Entwicklung sowie der sozialen Gerechtigkeit.
Wie kann Korruption effektiv bekämpft werden?
Die Arbeit schlägt diverse Maßnahmen vor, darunter strengere strafrechtliche Verfolgung, Transparenzregeln und die Förderung ethischer Normen in Organisationen.
- Quote paper
- Malte Priesmeyer (Author), 1997, Begriff und Erscheinung der Korruption, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8560