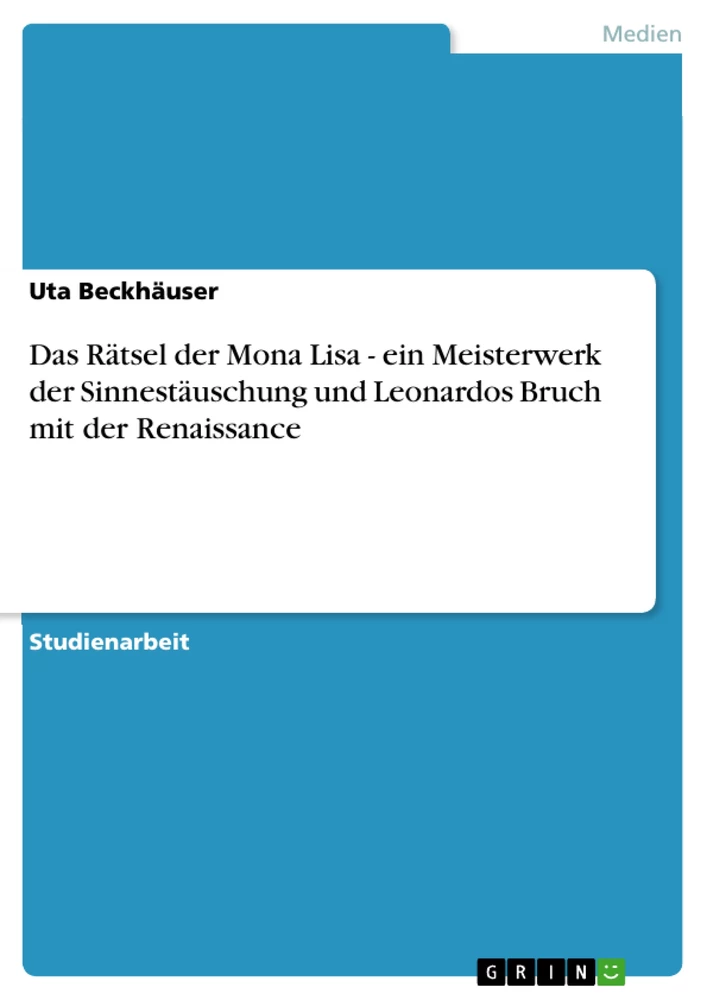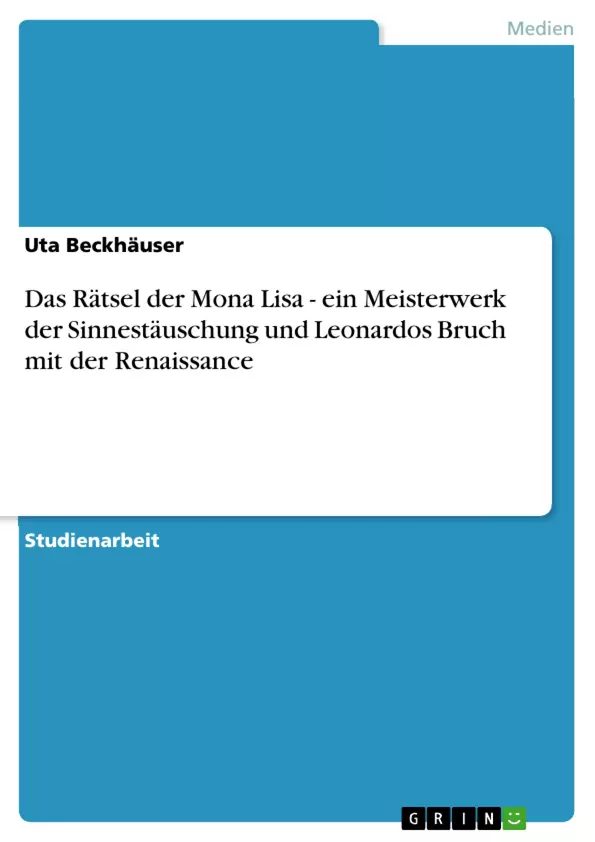Vor circa 100 Jahren geschah etwas Unfassbares: Das wohl berühmteste und zugleich rätselhafteste Gemälde der europäischen Kunstgeschichte verschwand aus dem Louvre: die Mona Lisa von Leonardo da Vinci (Abb. 1). Unvorstellbar nicht nur für Frankreich, sondern auch für die ganze Welt. Erst 2 Jahre später wurde es dem Louvre wieder zurückgebracht: Ein Italiener - die genauen Umstände sind bis heute nicht geklärt - wollte es seinem Land zurückgeben (vgl. Caparros 2005). Obwohl Leonardo das Gemälde seinem Lieblingsschüler Salai vermacht hatte , aus dessen Nachlass es später in die Kunstsammlungen des Königs von Frankreich gelangte und somit rechtmäßiges Eigentum von Frankreich war, war der Italiener davon überzeugt, dass Frankreich die Mona Lisa gestohlen hatte.
Kaum ein halbes Jahrhundert später, 1956, wurde das Gemälde durch ein Säureattentat schwer beschädigt (vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Mona_Lisa) – die Welt war schockiert. Heute befindet es sich hinter Panzerglas im Louvre und wird bewacht wie kein anderes Gemälde. Erst, nachdem durch diese Unglücksfälle die inhaltliche Brisanz des Bildes ins allgemeine Bewusstsein gedrungen war, beschäftigte man sich verstärkt mit der Deutung der Mona Lisa. Kein Bild der abendländischen Kunstgeschichte hat die Phantasien so angeregt wie die Mona Lisa und kein anderes Kunstwerk ist so häufig reproduziert und verfremdet worden. Doch warum kann ein Portrait soviel Aufsehen erregen? Was ist es, was die Mona Lisa unsterblich zu machen scheint und jedem den Atem stocken lässt?
Bis heute existieren viele Rätsel, Mythen und Verschwörungstheorien um das so geheimnisvolle Lächeln einer Frau, die Leonardo zwischen 1503 und 1506 gemalt haben soll. In dieser Arbeit sollen einige dieser Theorien angesprochen und diskutiert werden, um am Ende die Mona Lisa ein wenig zu enträtseln. Außerdem ordne ich das Portrait in die damals vorherrschenden Landschafts- und Portraitvorstellungen ein, um zu zeigen, dass Leonardo keineswegs ein typischer Renaissancekünstler war, sondern sich über die Konventionen seiner Zeit hinwegsetzte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gegenstand und Zielsetzung der Arbeit
- Hauptteil
- Die Darstellung
- Die Identität
- Landschafts- und Portraitdarstellungen im 15./16. Jahrhundert
- Die Idealität der Renaissance und Leonardos Gegenkonzept
- Florentiner Frauenportraits
- Die Sfumato Technik und die Erkenntnis des binuklearen Sehens
- Interpretation
- Das Thema der Mona Lisa: Veränderung
- Die innere Wende, der Zwiespalt
- Zeithistorischer Hintergrund und dessen Bedeutung für das Werk
- Schluss
- Zusammenfassung
- Ausblick: Die nie alternde Mona Lisa
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit zielt darauf ab, das Rätsel der Mona Lisa zu entschlüsseln. Sie untersucht das Portrait in Bezug auf seine Darstellung, Identität, künstlerische Technik und Interpretation. Das Ziel ist es, die Mona Lisa in den Kontext der Landschafts- und Portraitdarstellungen der Renaissance einzubinden und aufzuzeigen, wie Leonardo da Vinci sich von den Konventionen seiner Zeit abhob.
- Die Darstellung der Mona Lisa und ihre Abweichungen von der Renaissance-Ästhetik
- Die Identität der Mona Lisa und die verschiedenen Theorien über die dargestellte Person
- Leonardos innovative Sfumato-Technik und ihre Bedeutung für die Wahrnehmung
- Die Interpretation des geheimnisvollen Lächelns und dessen Bezüge zur Zeitgeschichte
- Leonardos Bruch mit den Idealvorstellungen der Renaissance im Kontext seiner Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik ein und erläutert den Gegenstand und die Zielsetzung der Arbeit. Sie beleuchtet die Geschichte des Gemäldes und seine Bedeutung für die Kunstgeschichte. Der Hauptteil beschäftigt sich mit der Darstellung, der Identität, der künstlerischen Technik und der Interpretation des Bildes. Er analysiert die Abweichungen von der Renaissance-Ästhetik und stellt verschiedene Theorien zur Identität der Mona Lisa vor. Zudem wird Leonardos Sfumato-Technik und ihr Einfluss auf die Wahrnehmung des Gemäldes untersucht. Im Kapitel zur Interpretation wird das geheimnisvolle Lächeln der Mona Lisa in den Kontext der Zeitgeschichte eingeordnet und Leonardos Bruch mit den Idealvorstellungen der Renaissance beleuchtet.
Schlüsselwörter
Mona Lisa, Leonardo da Vinci, Renaissance, Portraitmalerei, Sfumato-Technik, Landschaftsdarstellung, Zeithistorischer Kontext, Gemäldesprache, Identität, Mythen, Verschwörungstheorien, Künstlerische Technik, Interpretation, Gegenkonzept.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt die Mona Lisa als Bruch mit der Renaissance?
Leonardo setzte sich über die damaligen Konventionen der Idealität hinweg und schuf ein Porträt, das durch psychologische Tiefe statt starrer Idealisierung besticht.
Was ist die Sfumato-Technik?
Es ist eine Maltechnik, bei der Farben und Konturen weich ineinander verfließen („verraucht“), was besonders das rätselhafte Lächeln und den lebendigen Ausdruck ermöglicht.
Welche Theorien gibt es zur Identität der Mona Lisa?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Mythen und Theorien, wobei die Identifizierung als Lisa del Giocondo die gängigste, aber nicht die einzige diskutierte Möglichkeit ist.
Was macht die Landschaft im Hintergrund so besonders?
Leonardo nutzte eine innovative Landschaftsdarstellung, die sich von den typischen Florentiner Frauenporträts seiner Zeit durch eine fast mystische Atmosphäre unterscheidet.
Wann wurde die Mona Lisa aus dem Louvre gestohlen?
Das Gemälde wurde vor etwa 100 Jahren (1911) gestohlen und kehrte erst zwei Jahre später nach Frankreich zurück.
Wie wird das Thema „Veränderung“ im Bild interpretiert?
Das Porträt wird als Darstellung einer inneren Wende und eines Zwiespalts gesehen, der auch den zeithistorischen Hintergrund widerspiegelt.
- Arbeit zitieren
- Uta Beckhäuser (Autor:in), 2007, Das Rätsel der Mona Lisa - ein Meisterwerk der Sinnestäuschung und Leonardos Bruch mit der Renaissance, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85702