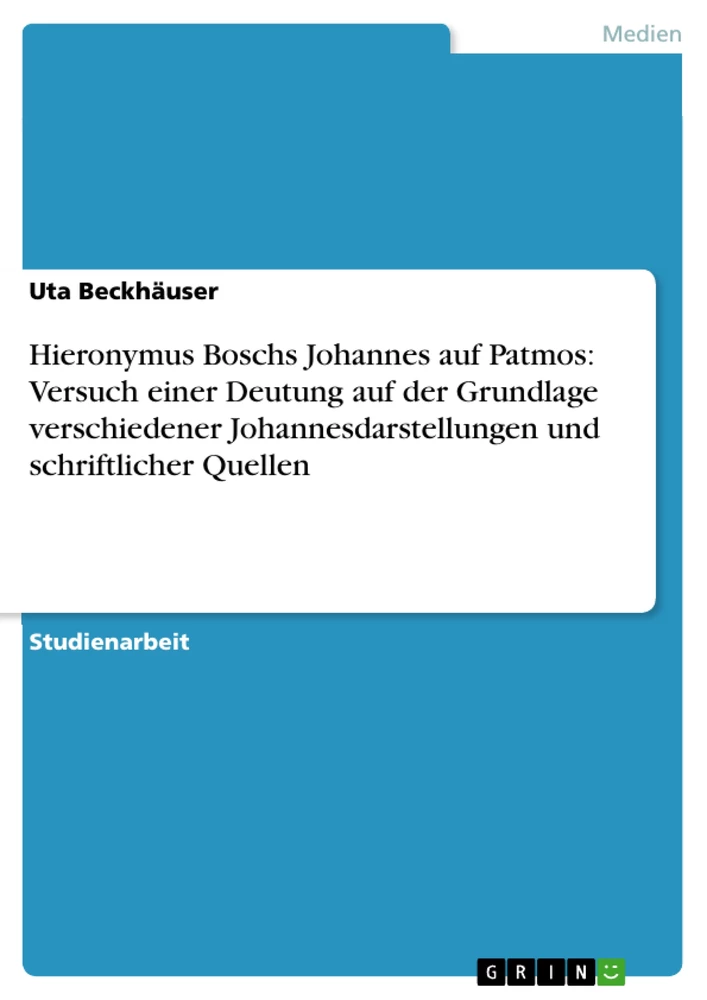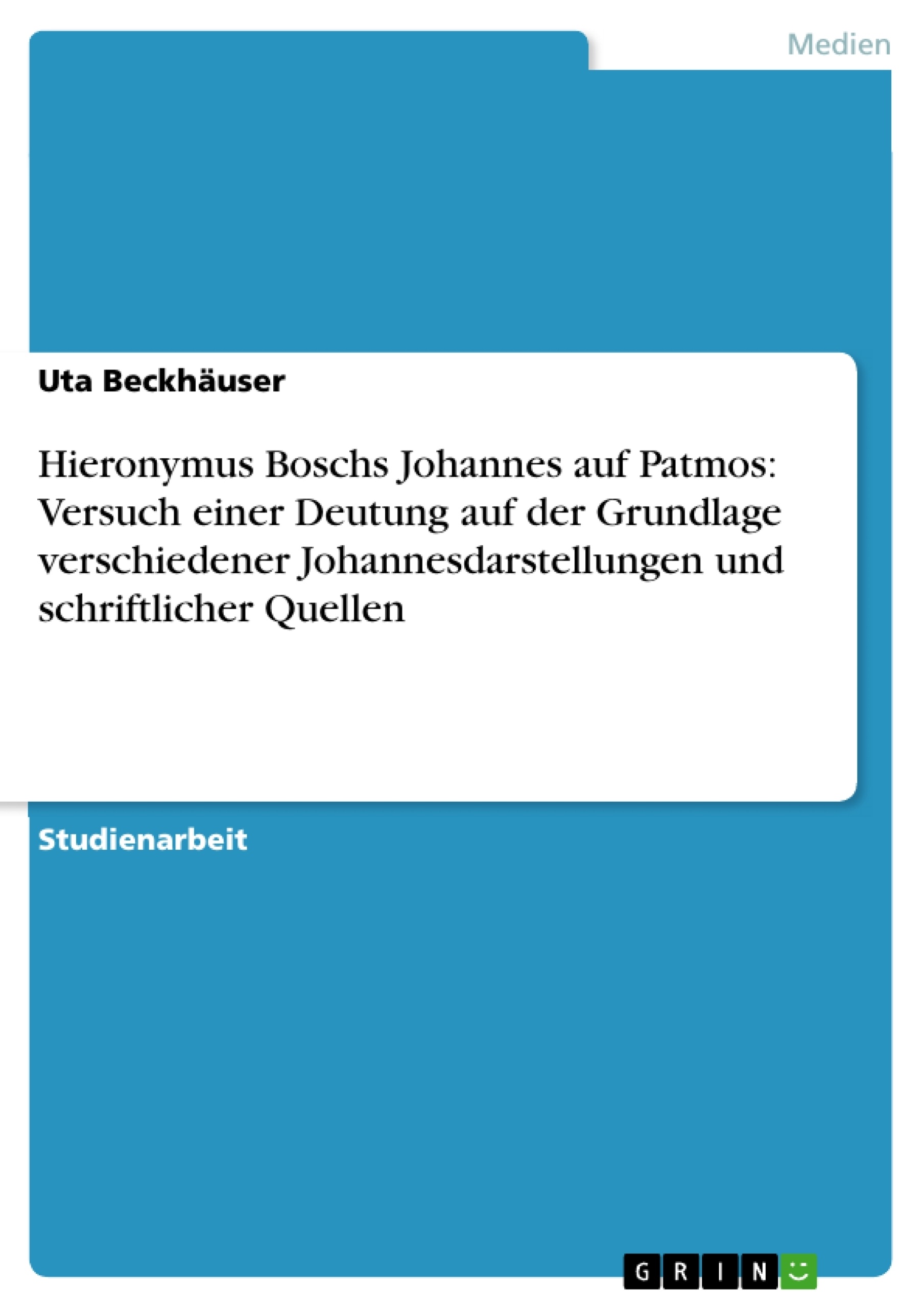Vor über zweitausend Jahren kam ein Denken auf, das die Menschen wie nie zuvor und bis heute in ihren Bann zog. Es entstand aus und neben dem Judentum und neben dem Islam, eine der größten monotheistischen Weltreligionen: das Christentum. Nie wieder sollte eine Religion so viele Menschen vereinen; heute zählt man etwa 1,8 Milliarden Christen. Ihr Stifter, Jesus von Nazareth, predigte Nächstenliebe und kündigte das Reich Gottes an.
Eines seiner zentralen Themen ist die Offenbarung an den Evangelisten Johannes: Im Namen Gottes lässt Jesus das Weltende in verschiedenen Bildern prophezeien. Die Vorstellung davon war durch Unheilserwartungen geprägt und sollte sich durch radikale innerweltliche Veränderungen vollziehen. Die Menschen, die Gott treu blieben, sollten in eine neue und vollendete Welt unter der Herrschaft Gottes geführt werden. Welche Menschen das sind, sollte durch das jüngste Gericht entschieden werden. Johannes wurde beauftragt, diese Vision von der endgültigen Zukunft der Weltgeschichte allen sieben Gemeinden in Kleinasien weiterzutragen.
Keine andere Religion ist in der europäischen bzw. abendländischen Kunst so stark vertreten wie das Christentum. Man kann sogar sagen, dass ausschließlich christliche Motive bis ins Mittelalter dominierten. Nicht zuletzt hing dies auch mit den Auftraggebern zusammen. Zahlreiche Künstler der Renaissance, wie Michelangelo, Raffael und Leonardo, erhielten ihre Aufträge meist vom Papst oder religiösen Herrscherfamilien. Dementsprechend waren die Apokalypse und das damit zusammenhängende jüngste Gericht besonders in der mittelalterlichen Kunst und auch in der Renaissance beliebte Motive, deren Darstellung es ständig zu übertreffen und weiterzuentwickeln galt.
Einer der wohl geheimnisvollsten und faszinierendsten Maler des ausgehenden Mittelalters, der sich mit diesem Thema auseinandersetzte, war der niederländische Maler Hieronymus Bosch (1450-1516). Er hinterließ kaum schriftliche Dokumente, so dass sich viele seiner Werke bis heute jeder eindeutigen Interpretation entziehen. Der Übergang vom 15. zum 16. Jahrhundert war durch zahlreiche Umbrüche gekennzeichnet und beeinflusste auch Bosch stark:
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einleitende Fragestellung
- Argumentationsaufbau
- Hauptteil
- Die Offenbarung an Johannes in der Bibel
- Boschs Johannes auf Patmos: ein Altarfragment
- Ein Vorbild Boschs: Schongauers Johannes auf Patmos
- Hans Memling
- James Marrow vs. Erwin Panofsky: eine Weiterentwicklung kunstgeschichtlicher Interpretationsmöglichkeiten
- Versuch einer Interpretation
- Johannes auf Patmos
- Die sieben Todsünden: das göttliche Sonnenauge über den Sündern
- Das Tondoformat auf der Rückseite der Johannestafel
- Das Auge Gottes ist der Spiegel der Seele
- Bosch und die Alchemie
- Schluss
- Zusammenfassung
- Ausblick: Die Vorstellung eines Weltendes/ einer Erlösung in Religionen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Werk des niederländischen Malers Hieronymus Bosch, insbesondere sein Altargemälde "Johannes auf Patmos", und dessen Bedeutung im Kontext der apokalyptischen Visionen der Offenbarung des Johannes in der Bibel. Die Arbeit zielt darauf ab, die künstlerische Tradition von Johannes-Darstellungen zu beleuchten und die Interpretation von Boschs Werk vor dem Hintergrund der künstlerischen und historischen Kontexte zu analysieren.
- Die Offenbarung des Johannes in der Bibel als Quelle der Inspiration für Künstler
- Die Rolle von Hieronymus Bosch als Künstler des ausgehenden Mittelalters
- Die kunstgeschichtliche Entwicklung von Johannes-Darstellungen
- Die Interpretation von Symbolen und Motiven in Boschs "Johannes auf Patmos"
- Die Rolle der Alchemie in der Kunst des Hieronymus Bosch
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet die Fragestellung der Arbeit und skizziert den Argumentationsaufbau. Das Hauptteil beginnt mit einer Analyse der Offenbarung des Johannes in der Bibel als Grundlage für die Johannes-Darstellungen in der Kunst. Anschließend wird Boschs "Johannes auf Patmos" vorgestellt und in Bezug zu Vorbildern, wie Schongauers und Memlings Johannes-Darstellungen, gesetzt. Es werden verschiedene Interpretationsansätze diskutiert, insbesondere die ikonografische Methode Panofskys und die weiterentwickelte Methode Marrows, die auf Boschs "sieben Todsünden" angewendet wird. Der Schluss fasst die Ergebnisse zusammen und befasst sich mit der Vorstellung vom Weltende und der Erlösung in verschiedenen Religionen.
Schlüsselwörter
Hieronymus Bosch, Johannes auf Patmos, Offenbarung des Johannes, Apokalypse, Kunstgeschichte, Symbolismus, Alchemie, Sieben Todsünden, ikonografische Methode, Erwin Panofsky, James Marrow, Johannes-Darstellungen, Martin Schongauer, Hans Memling.
- Quote paper
- Uta Beckhäuser (Author), 2006, Hieronymus Boschs Johannes auf Patmos: Versuch einer Deutung auf der Grundlage verschiedener Johannesdarstellungen und schriftlicher Quellen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85703