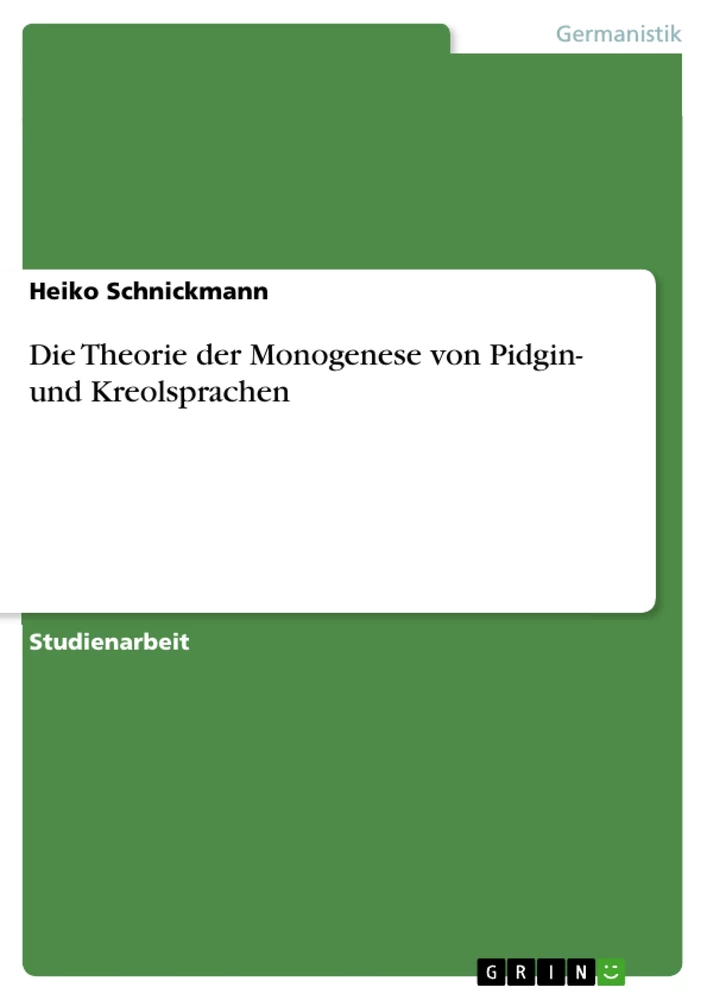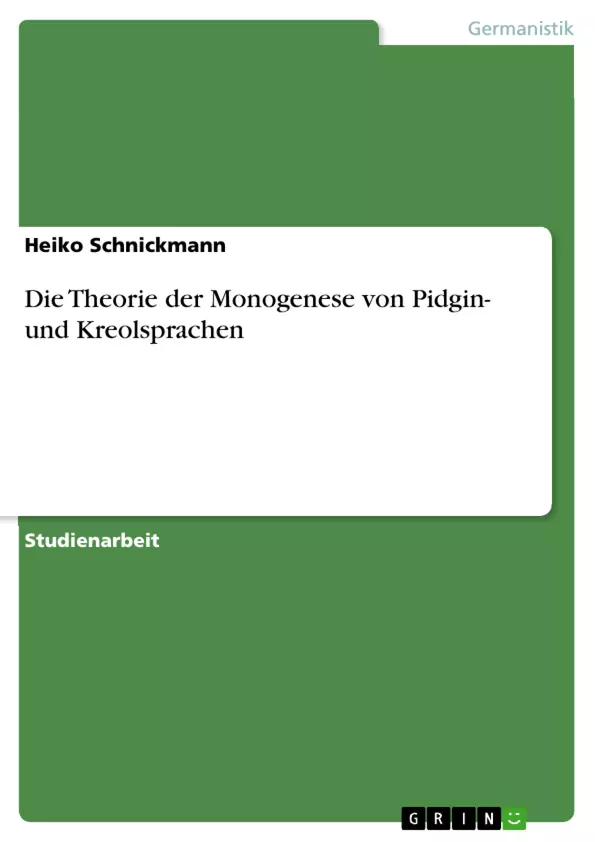Zu Beginn der Neuzeit und am Ende des Mittelalters machten sich die Europäer auf, um die Welt außerhalb ihres Kontinents zu erkunden und zu erobern. Ausgehend davon, dass man eine christliche Mission hatte, die größten Feinde in der Reconquista aus Spanien und somit aus Europa verband hatte und schließlich mit dem Wissen um die eigene Vergangenheit, das der Humanismus und die Renaissance wieder hervorgeholt hatten, machte man sich auf den Weg. Die Technik war weit fortgeschritten und so war die Erkundung der Welt nicht mehr aufzuhalten.
Allerdings gab es ein Problem, mit dem man nicht rechnete. Die Menschen auf die man traf, sprachen keine der bekannten Sprachen. Das war eine denkbar schlechte Grundlage, um diesen unterentwickelten Völkern das Licht der Zivilisation zu bringen. Die Verständigung aber klappte doch und das Ergebnis war, dass sich die europäischen Sprachen auf der ganzen Welt ausbreiteten. Manche von ihnen in einer seltsamen Mischform, in der eine eigenartige Grammatik vorherrscht. Das beschäftigte Linguisten und interessierte Laien schon von Beginn an.
Zunächst wurde beschrieben, was man hörte und dann wurde darüber nachgedacht, was der Grund dafür sein könnte. Mitte des vergangenen Jahrhunderts schließlich gab es eine Theorie, die bis heute in den Einführungsbüchern zur Sprachkontaktforschung präsent ist: Die Theorie der Monogenese. So unwahrscheinlich es auch klingen mag, wurde davon ausgegangen, dass alle diese Mischsprachen eine Wurzel haben, aus der sie entsprungen sind. Diese Pidgin- und Kreolsprachen entstammen alle dem Portugiesischen. Leicht kann man sich vorstellen, dass eine solche Theorie angegriffen werden musste und durch vermeidlich bessere ersetzt wurde.
Der Verfasser dieser Arbeit ging ganz unbefangen an diese Theorie heran. Zunächst bloß fasziniert von der Idee, einmal nachvollziehen zu wollen, wie diese Theorie entstand, entwickelte sich schließlich der Wunsch zu überprüfen, ob diese Theorie wirklich haltbar ist. Der Verfasser stellte sich die simple Frage, die er hier nachgehen wollte und die zur Fragestellung dieser Arbeit wurde: Ist die Theorie der Monogenese von Pidgin- und Kreolsprachen uneingeschränkt stimmig oder muss sie revidiert oder gar falsifiziert werden?
Das Fazit hieraus kann nicht das Nonplusultra für die Kreolistik sein, doch liefert es vielleicht einen kleinen Ansatz im Umgang mit dieser Theorie.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Was sind Pidgin- und Kreolsprachen?
- III. Der Ursprung der Pidginsprachen
- a. Unter welchen Umständen entwickeln sich Pidginsprachen?
- b. Welche Auslöser führen zur Entwicklung eines Pidgin?
- c. Wie bzw. woraus haben sich die Pidginsprachen entwickelt?
- IV. Die Theorie der Monogenese
- V. Die,,Lingua Franca\" des Mittelmeers
- VI. Kurzer Abriss der Geschichte des Portugiesischen Kolonialreichs
- VII. Historische Analyse der These der Monogenese
- VIII. Linguistische Analyse der These der Monogenese
- IX. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Theorie der Monogenese von Pidgin- und Kreolsprachen. Ziel ist es, die Entstehung und Gültigkeit dieser Theorie zu untersuchen und zu beurteilen. Dabei werden die historischen und linguistischen Aspekte der Theorie analysiert, um zu ergründen, ob sie uneingeschränkt stimmig ist oder revidiert bzw. falsifiziert werden muss.
- Entstehung und Entwicklung von Pidgin- und Kreolsprachen
- Die Theorie der Monogenese und ihre historischen Wurzeln
- Die Rolle des Portugiesischen in der Entstehung von Pidgin- und Kreolsprachen
- Linguistische Analysen zur Unterstützung oder Widerlegung der Monogenese-Theorie
- Bewertung der Theorie im Kontext der Kreolistik
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel I: Einleitung
- Kapitel II: Was sind Pidgin- und Kreolsprachen?
- Kapitel III: Der Ursprung der Pidginsprachen
- Kapitel IV: Die Theorie der Monogenese
- Kapitel V: Die,,Lingua Franca\" des Mittelmeers
- Kapitel VI: Kurzer Abriss der Geschichte des Portugiesischen Kolonialreichs
- Kapitel VII: Historische Analyse der These der Monogenese
- Kapitel VIII: Linguistische Analyse der These der Monogenese
Die Einleitung stellt die Ausgangssituation der Erforschung von Pidgin- und Kreolsprachen dar und führt die Theorie der Monogenese ein. Sie beschreibt den historischen Kontext der Entstehung dieser Sprachen und die Bedeutung der Verständigungsprobleme zwischen Europäern und den von ihnen besuchten Völkern. Schließlich wird die Fragestellung der Arbeit formuliert: Ist die Theorie der Monogenese uneingeschränkt stimmig oder bedarf sie einer Revision?
Dieses Kapitel erklärt die Entstehung von Pidginsprachen im Kontext von Sprachkontakt und interkultureller Kommunikation. Es unterscheidet Pidginsprachen von Code-Mixing und Code-Switching und beleuchtet die Besonderheiten der Pidginsprachenentwicklung.
Kapitel III befasst sich mit den Bedingungen und Auslösern für die Entstehung von Pidginsprachen. Es untersucht die Faktoren, die zur Entwicklung eines Pidgin führen, und analysiert die Ursprünge dieser Sprachen im Kontext von Sprachkontakt und kulturellem Austausch.
Hier wird die Theorie der Monogenese vorgestellt, die besagt, dass alle Pidgin- und Kreolsprachen auf eine gemeinsame Wurzel zurückzuführen sind. Das Kapitel erläutert die Grundzüge dieser Theorie und stellt ihre historische und linguistische Bedeutung dar.
Dieses Kapitel befasst sich mit dem historischen Kontext der Monogenese-Theorie und analysiert die Rolle der „Lingua Franca“ des Mittelmeeres in der Entwicklung von Pidgin- und Kreolsprachen.
Kapitel VI stellt die Geschichte des Portugiesischen Kolonialreichs dar und beleuchtet die Bedeutung des Portugiesischen im Kontext der Entstehung von Pidgin- und Kreolsprachen.
Dieses Kapitel analysiert die historische Entwicklung der Monogenese-Theorie und untersucht ihre wissenschaftliche Fundierung im Kontext der historischen Forschung.
Kapitel VIII präsentiert eine linguistische Analyse der Monogenese-Theorie und überprüft ihre Gültigkeit anhand von linguistischen Daten und Untersuchungen.
Schlüsselwörter
Pidginsprachen, Kreolsprachen, Monogenese, Sprachkontakt, Sprachentwicklung, Portugiesisch, Kolonialismus, Lingua Franca, Sprachgeschichte, Kreolistik.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Theorie der Monogenese bei Kreolsprachen?
Sie geht davon aus, dass alle Pidgin- und Kreolsprachen eine gemeinsame Wurzel haben, die vermutlich im Portugiesischen liegt.
Was ist der Unterschied zwischen Pidgin- und Kreolsprachen?
Pidgins entstehen als Behelfssprachen zur Kommunikation bei Sprachkontakt; Kreolsprachen entwickeln sich daraus, wenn sie zur Muttersprache einer Generation werden.
Welche Rolle spielte das portugiesische Kolonialreich?
Durch die weltweite Expansion der Portugiesen im 16. Jahrhundert verbreitete sich ihre Sprache als Basis für viele Kontaktvarietäten weltweit.
Was ist die „Lingua Franca“ des Mittelmeers?
Eine mittelalterliche Verkehrssprache, die als historischer Vorläufer oder Einflussfaktor für die Entwicklung späterer Pidginsprachen gilt.
Ist die Monogenese-Theorie heute noch wissenschaftlich haltbar?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob die Theorie uneingeschränkt stimmig ist oder aufgrund neuerer linguistischer Erkenntnisse revidiert werden muss.
- Quote paper
- Heiko Schnickmann (Author), 2007, Die Theorie der Monogenese von Pidgin- und Kreolsprachen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85733