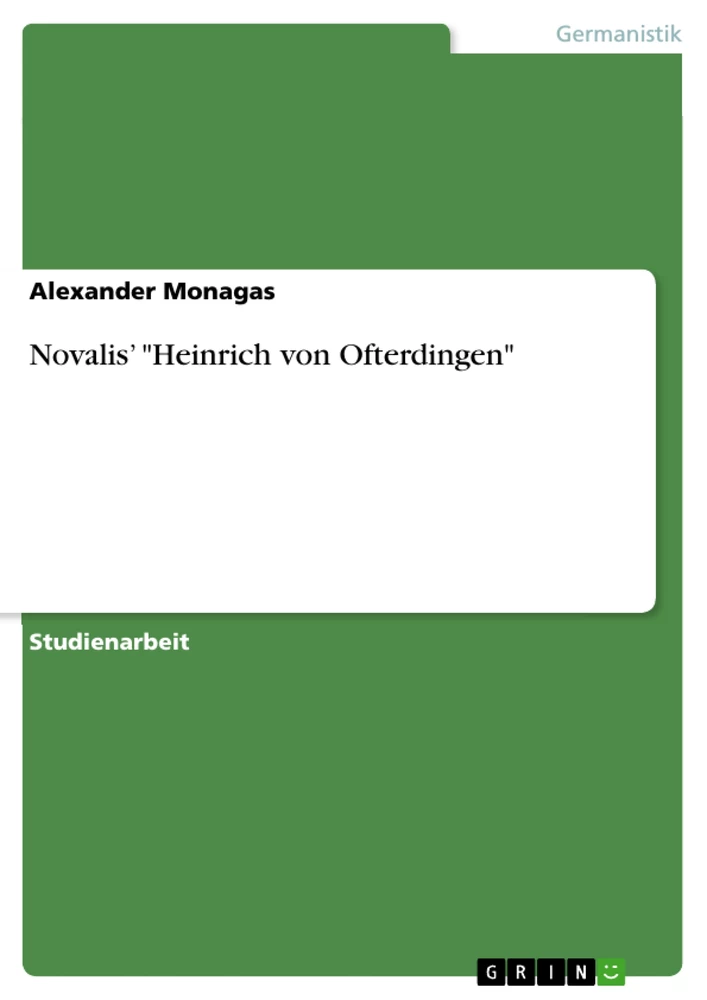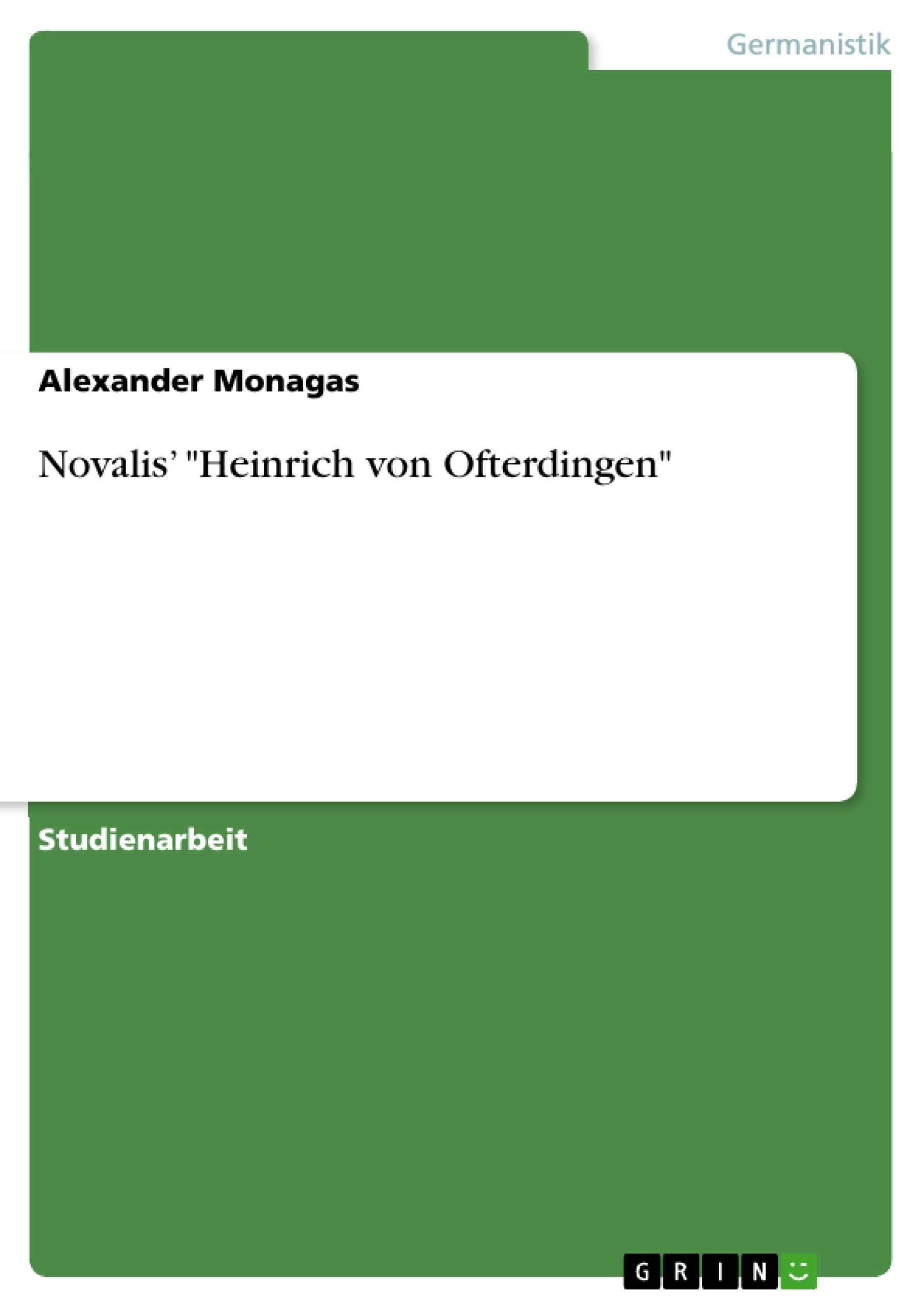Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg wird bis heute in der Forschungsliteratur als der Dichter der (Früh-)Romantik angesehen. Viele seiner romantischen Theorien finden sich im Heinrich von Ofterdingen wieder. Trotz der kurzen Entstehungszeit bleibt der Roman mit dem frühen Tod von Novalis am 25. März 1801 im Alter von nur 29 Jahren Fragment. Ganz bewusst als Gegenentwurf zu Goethes Wilhelm Meister angelegt, fand Novalis – wie von Hardenberg sich nach einem Zweig seiner Vorfahren nannte – auf einer Reise in den Chroniken über „Heinrich von Afterdingen“ den passenden Stoff. Mit der Verlegung der Bildungsreise ins Innere des Protagonisten wollte Novalis die Erkenntnis seines Helden durch eine kritische Poesie transzendental werden lassen.
Immer wieder finden sich im Ofterdingen Kommunikationssituationen, die dem Protagonisten auf seiner Bildungsreise des inneren Ichs den Weg zur poetischen Subjektwerdung ermöglichen. Begleitet von geistigen Mentoren durchläuft Heinrich eine innere Reflexion, die sich mit einer zunehmend gefestigten poetisierten Identität nach außen kehrt. Die so gewonnene innere Reife dient ihm dazu, den für ihn vorherbestimmten Weg zum vollendeten Dichter zu beschreiten. Doch wie hat Novalis diese Poetisierung des Subjekts in Novalis’ Heinrich von Ofterdingen ausgestaltet?
Die folgende Arbeit wird mit Fokus auf dem Primärtext die identitätsstiftende Poetisierung des Subjekts im Heinrich von Ofterdingen von Novalis untersuchen. Es soll dabei gezeigt werden, wie die vielschichtig angelegte Selbstreflexion des Protagonisten – mit Initiation von innen und außen – die mentale Reife auslöst, welche eine poetisierte Interaktion innerhalb des Geschehens als identitätsstiftende Selbstfindungsgrundlage etabliert.Dabei werden gezielt Textstellen herangezogen, die den kommunikativen Charakter verdeutlichen. Unterstützende Aspekte wie die Betrachtung von Natur und Technik, sowie die Betrachtung der Traumerfahrung des Protagonisten stellen zielorientierte Teilbereiche dar, die die Ausgestaltung eines kommunikativen Charakters zur poetischen Subjektwerdung Heinrichs deutlich beeinflussen. Denn gerade im Ofterdingen finden sich eigene philosophische Überlegungen wie auch zeitgenössische Theorien anderer im Roman eingewoben.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Der Dichter als poetischer Kommunikator.
- 2. Die Natur als Spiegel der Seele...............
- 2.1 Natur als weibliche Metaphorik
- 3. Die Moderne als Spannungsfeld der Poetisierung Heinrichs.
- 4. Träume als Initiation einer poetischen Subjektivierung
- 5. Konstruktion einer poetischen Identität
- 5.1 Poetische Identitätsstiftung durch die Liebe..\li>
- II. Schlussbetrachtung
- III. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse der identitätsstiftenden Poetisierung des Subjekts in Novalis' Heinrich von Ofterdingen. Im Zentrum der Untersuchung steht die Frage, wie die Selbstreflexion des Protagonisten, initiiert durch innere und äußere Einflüsse, eine poetisierte Interaktion innerhalb des Geschehens ermöglicht und zu einer identitätsstiftenden Selbstfindungsgrundlage führt.
- Die Rolle des Protagonisten Heinrich von Ofterdingen in der Entwicklung einer poetischen Identität
- Die Bedeutung von Kommunikation und Interaktion für die Subjektwerdung
- Die Verbindung zwischen Natur und Seele sowie die Rolle weiblicher Metaphorik
- Die Integration von Träumen als transformative Erfahrung
- Die Auseinandersetzung mit der modernen Welt und ihre Auswirkungen auf die Poetisierung
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung
Die Einleitung beleuchtet die Relevanz von Novalis als Dichter der Frühromantik und stellt den Roman Heinrich von Ofterdingen als Gegenentwurf zu Goethes Wilhelm Meister vor. Sie beschreibt das Konzept der Bildungsreise des Protagonisten, die von inneren und äußeren Einflüssen geprägt ist, und führt den Leser in die zentrale Thematik der Poetisierung des Subjekts ein.
1. Der Dichter als poetischer Kommunikator.
Dieses Kapitel erörtert den Einfluss der Französischen Revolution auf die Literatur des 18. Jahrhunderts und die sich daraus ergebenden gesellschaftspolitischen Veränderungen. Es analysiert, wie die Frühromantiker den Optimismus auf eine „Aussöhnung der Welt“ als Folge der revolutionären Umbrüche verloren und sich dem Sinnverlust der aufgeklärten Welt gegenüber sahen. Der Autor beleuchtet, wie Novalis in seinem Roman eine idealisierte Vergangenheit als Bezugspunkt für eine ideale Zukunft nutzt.
2. Die Natur als Spiegel der Seele...............
Dieses Kapitel befasst sich mit der Rolle der Natur als Spiegel der Seele in Heinrich von Ofterdingen. Es wird die Bedeutung der Natur als weibliche Metaphorik untersucht und wie sie in der Poetisierung des Subjekts eine entscheidende Rolle spielt.
3. Die Moderne als Spannungsfeld der Poetisierung Heinrichs.
Hier werden die Auswirkungen der modernen Welt auf die Entwicklung des Protagonisten Heinrich von Ofterdingen untersucht. Der Autor analysiert, wie die moderne Gesellschaft die Poetisierung des Subjekts beeinflusst und welche Spannungen daraus entstehen.
4. Träume als Initiation einer poetischen Subjektivierung
Dieses Kapitel erforscht die Rolle von Träumen in der Bildung und Entwicklung des Protagonisten. Der Autor beleuchtet, wie Träume als transformative Erfahrungen die Subjektivierung beeinflussen und die poetische Identität prägen.
5. Konstruktion einer poetischen Identität
In diesem Kapitel wird die Konstruktion der poetischen Identität des Protagonisten analysiert. Der Autor beleuchtet die Bedeutung der Liebe als identitätsstiftendes Element und untersucht, wie die innere und äußere Welt auf die Gestaltung der poetischen Identität einwirken.
Schlüsselwörter
Novalis, Heinrich von Ofterdingen, Frühromantik, Poetisierung des Subjekts, Bildungsreise, Kommunikation, Natur, Träume, Moderne, Identität, Liebe.
- Citar trabajo
- Master of Arts Alexander Monagas (Autor), 2007, Novalis’ "Heinrich von Ofterdingen", Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85762