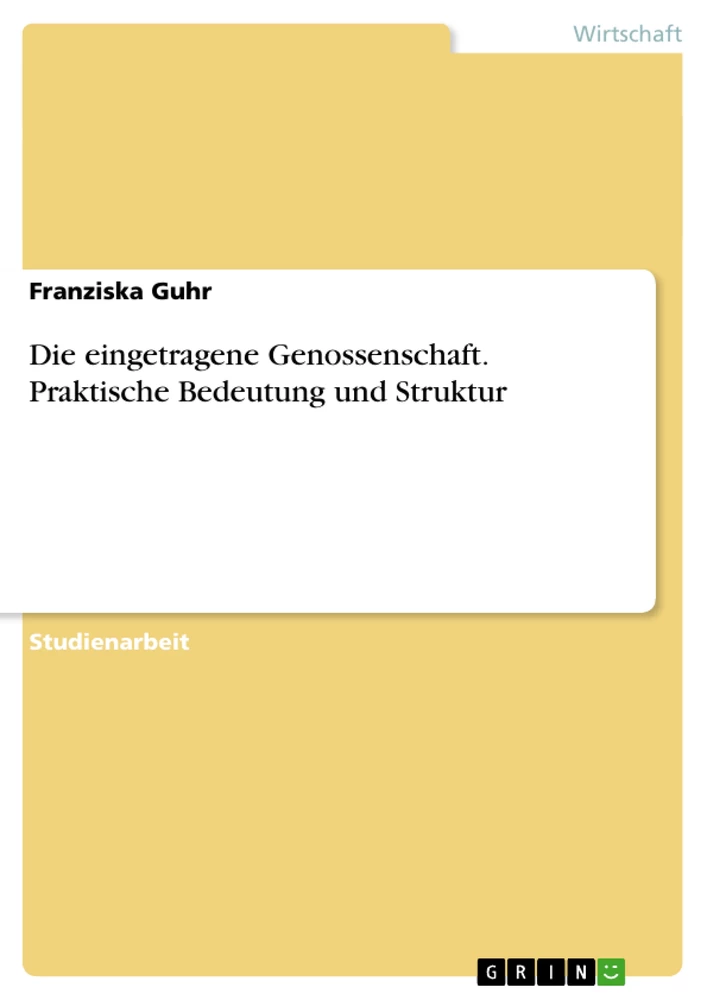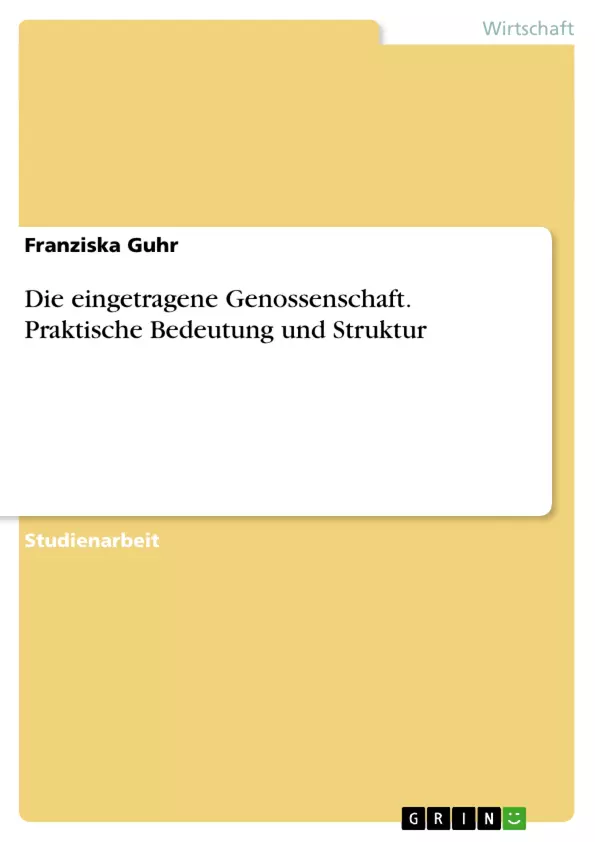Die eingetragene Genossenschaft (eG) ist eine juristische Person des deutschen Rechts und eine Sonderform des wirtschaftlichen Vereins. Gemäß § 1 (1) GenG ist sie als Gesellschaft von nicht geschlossener Mitgliederzahl, welche die Förderung des Erwerbes oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren sozialen oder kulturellen Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb bezweckt, definiert. Aufgrund der offenen Mitgliederzahl und der dadurch entstehenden Unabhängigkeit von dem Mitgliederstand stellt die eG eine Körperschaft dar. Außerdem ist aus der Definition erkennbar, dass ihr vordergründiger Zweck nicht wie bei anderen Gesellschaftsformen in der Gewinnerzielung, sondern in der Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder liegt. Neuerdings können auch kulturelle und soziale Belange als Förderzweck zugelassen werden. Durch eine bestimmte Leistungserbringung, welche Kosten- und Produktivitätsvorteile, Beratungen oder auch Dienstleistungen der Genossenschaft sein können, werden die Mitglieder gefördert und sind daher Gesellschafter und Kunde in einem (genossenschaftliches Identitätsprinzip). Ziel dabei ist es einerseits dem Wettbewerb mit dem durch den freiwilligen Genossenschaftszusammenschluss gebündelten Kapital Stand zu halten und andererseits durch das zur Verfügung stellen des eigenen Vermögens für die anderen Genossen sich gemeinschaftlich zu helfen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführende Bemerkungen und Begriffsdefinitionen
- Praktische Bedeutung der eingetragenen Genossenschaft
- Historische Wurzeln der eingetragenen Genossenschaft
- Die eingetragene Genossenschaft heute
- Genossenschaftliche Strukturtypen nach Dülfer
- Praktische Bedeutung der eG in Deutschland
- Die Reform des Genossenschaftsrechts im Jahre 2006
- Struktur der eingetragenen Genossenschaft
- Gründung
- Finanzierung der Genossenschaft
- Rechtsstellung der Mitglieder
- Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft
- Rechte und Pflichten der Mitglieder
- Nachschusspflicht als indirekte Haftung der Mitglieder
- Organisation
- Der Vorstand als geschäftsführendes und vertretendes Organ
- Der Aufsichtsrat als überwachendes Organ
- Die Generalversammlung zur Mitbestimmung der Genossen
- Genossenschaftliche Pflichtprüfung
- Beendigung der Genossenschaft
- Auflösung
- Umwandlung
- Insolvenz
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die eingetragene Genossenschaft (eG) als Rechtsform, indem sie sowohl ihre praktische Bedeutung als auch ihre strukturellen Aspekte beleuchtet. Die Arbeit verfolgt das Ziel, ein umfassendes Verständnis der eG im deutschen Wirtschaftsrecht zu vermitteln.
- Historische Entwicklung und gesellschaftlicher Kontext der eG
- Rechtsstruktur und Organisation der eG
- Rechte und Pflichten der Mitglieder einer eG
- Finanzierung und wirtschaftliche Bedeutung der eG
- Die Reform des Genossenschaftsrechts 2006 und ihre Auswirkungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einführende Bemerkungen und Begriffsdefinitionen: Dieses Kapitel definiert die eingetragene Genossenschaft (eG) als juristische Person und Sonderform des Wirtschaftsvereins, wobei ihr Zweck in der Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder liegt. Es wird die offene Mitgliederzahl und die daraus resultierende Unabhängigkeit vom Mitgliederstand hervorgehoben. Die Möglichkeit, auch kulturelle und soziale Belange zu fördern, wird ebenfalls erwähnt. Das Kapitel unterstreicht den Unterschied zwischen der Gewinnerzielung als primäres Ziel anderer Gesellschaftsformen und der Förderung der Mitglieder bei der eG, wobei das genossenschaftliche Identitätsprinzip (Gesellschafter und Kunde in einem) eine zentrale Rolle spielt. Schließlich wird darauf hingewiesen, dass ein genossenschaftlicher Zweckverband nicht zwingend die Rechtsform der eG benötigt.
Praktische Bedeutung der eingetragenen Genossenschaft: Dieses Kapitel beleuchtet die historischen Wurzeln der eG, beginnend mit frühen Formen der gegenseitigen Hilfe in germanischen Sippenverbänden und mittelalterlichen Zunftordnungen. Es wird der Entwicklungsschub im Zuge der Industrialisierung und dem liberalen Kapitalismus betont, der zu wirtschaftlichen und sozialen Ungleichgewichten führte. Die Entstehung der eG als Reaktion auf diese Ungleichgewichte und als Instrument der Selbsthilfe, insbesondere in England und Deutschland (durch die Beiträge von Delitzsch und Raiffeisen), wird detailliert dargestellt. Die Entwicklung der modernen Genossenschaft mit klarem Blick auf soziale Notwendigkeiten und die Möglichkeit, durch Zusammenschluss größere Kapitalmengen aufzubringen und somit konkurrenzfähig zu sein, wird hervorgehoben.
Struktur der eingetragenen Genossenschaft: Dieses Kapitel beschreibt die Struktur der eG umfassend, von der Gründung über die Finanzierung bis hin zur Beendigung. Es behandelt die Rechtsstellung der Mitglieder, einschließlich Erwerb und Verlust der Mitgliedschaft, Rechte und Pflichten sowie die Nachschusspflicht. Die verschiedenen Organe der eG – Vorstand, Aufsichtsrat und Generalversammlung – werden detailliert erklärt, wobei deren jeweilige Funktionen und Verantwortlichkeiten im Kontext der genossenschaftlichen Selbstverwaltung hervorgehoben werden. Zusätzlich wird die genossenschaftliche Pflichtprüfung und die verschiedenen Möglichkeiten der Beendigung einer Genossenschaft (Auflösung, Umwandlung, Insolvenz) erläutert.
Schlüsselwörter
Eingetragene Genossenschaft (eG), Genossenschaftsrecht, Genossenschaftsprinzip, Mitgliederrechte, Mitgliederpflichten, Organisation, Finanzierung, Gründung, Auflösung, Umwandlung, Insolvenz, Selbsthilfe, Wirtschaftsverein, Genossenschaftsgesetz (GenG), Rechtsform.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Die eingetragene Genossenschaft (eG)
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit bietet einen umfassenden Überblick über die eingetragene Genossenschaft (eG) im deutschen Recht. Sie behandelt die historische Entwicklung, die praktische Bedeutung, die Rechtsstruktur, die Organisation, die Rechte und Pflichten der Mitglieder, die Finanzierung sowie die Gründung und Beendigung einer eG. Der Text enthält ein Inhaltsverzeichnis, eine Zusammenfassung der Kapitel, die Zielsetzung und die wichtigsten Themenschwerpunkte sowie ein Stichwortverzeichnis.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit deckt folgende Themen ab: Einführende Bemerkungen und Begriffsdefinitionen; die praktische Bedeutung der eG, inklusive ihrer historischen Wurzeln und der Reform des Genossenschaftsrechts 2006; die Struktur der eG, einschließlich Gründung, Finanzierung, Rechtsstellung der Mitglieder (Rechte, Pflichten, Nachschusspflicht), Organisation (Vorstand, Aufsichtsrat, Generalversammlung) und Beendigung (Auflösung, Umwandlung, Insolvenz). Ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen wird ebenfalls angedeutet.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Hausarbeit zielt darauf ab, ein umfassendes Verständnis der eingetragenen Genossenschaft (eG) als Rechtsform im deutschen Wirtschaftsrecht zu vermitteln. Sie beleuchtet sowohl die praktische Bedeutung der eG als auch ihre strukturellen Aspekte.
Welche sind die wichtigsten Themenschwerpunkte?
Die wichtigsten Themenschwerpunkte sind die historische Entwicklung und der gesellschaftliche Kontext der eG, die Rechtsstruktur und Organisation, die Rechte und Pflichten der Mitglieder, die Finanzierung und wirtschaftliche Bedeutung sowie die Auswirkungen der Genossenschaftsrechtsreform von 2006.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist in Kapitel unterteilt, die jeweils einen Aspekt der eingetragenen Genossenschaft behandeln. Jedes Kapitel wird im Inhaltsverzeichnis detailliert aufgeführt und im Abschnitt "Zusammenfassung der Kapitel" kurz zusammengefasst.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Eingetragene Genossenschaft (eG), Genossenschaftsrecht, Genossenschaftsprinzip, Mitgliederrechte, Mitgliederpflichten, Organisation, Finanzierung, Gründung, Auflösung, Umwandlung, Insolvenz, Selbsthilfe, Wirtschaftsverein, Genossenschaftsgesetz (GenG), Rechtsform.
Was ist eine eingetragene Genossenschaft (eG)?
Eine eingetragene Genossenschaft (eG) ist eine juristische Person und eine Sonderform des Wirtschaftsvereins. Ihr Zweck liegt in der Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft ihrer Mitglieder. Sie zeichnet sich durch eine offene Mitgliederzahl und die Möglichkeit aus, auch kulturelle und soziale Belange zu fördern. Im Gegensatz zu anderen Gesellschaftsformen steht nicht die Gewinnerzielung im Vordergrund, sondern die Förderung der Mitglieder.
Welche Bedeutung hat die Genossenschaftsrechtsreform von 2006?
Die Reform des Genossenschaftsrechts im Jahr 2006 wird in der Hausarbeit als wichtiger Aspekt der Entwicklung der eG behandelt und ihre Auswirkungen auf die Rechtsform werden beleuchtet (jedoch nicht im Detail erläutert).
Welche Organe hat eine eG?
Eine eG hat drei Organe: den Vorstand (geschäftsführend und vertretend), den Aufsichtsrat (überwachend) und die Generalversammlung (Mitbestimmung der Genossen).
Wie wird eine eG beendet?
Eine eG kann durch Auflösung, Umwandlung oder Insolvenz beendet werden.
- Quote paper
- Franziska Guhr (Author), 2006, Die eingetragene Genossenschaft. Praktische Bedeutung und Struktur, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85809