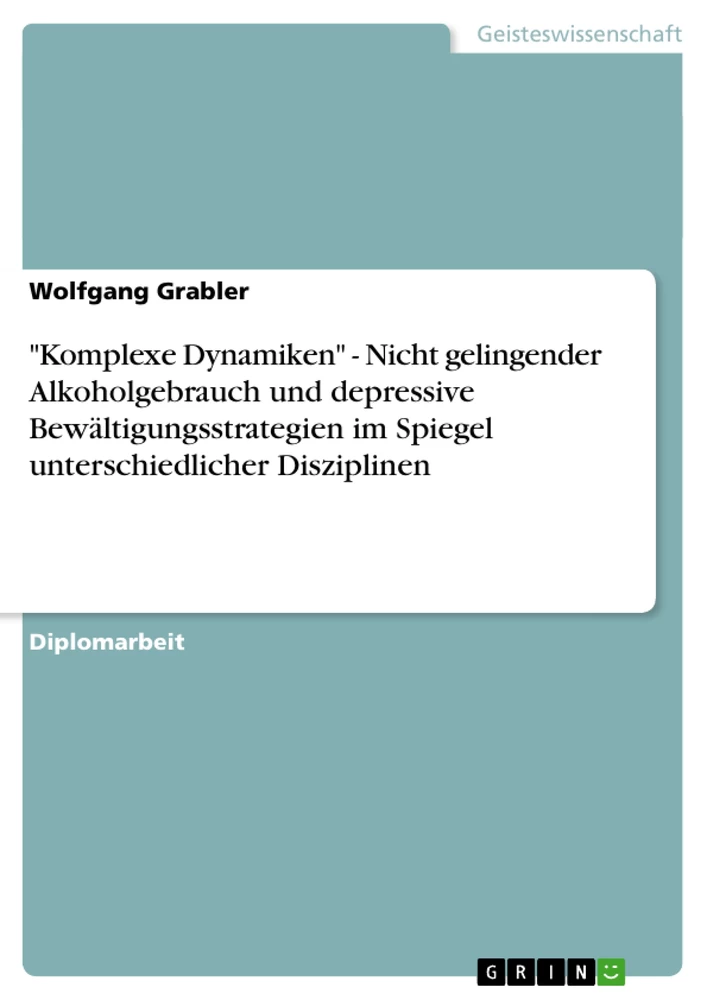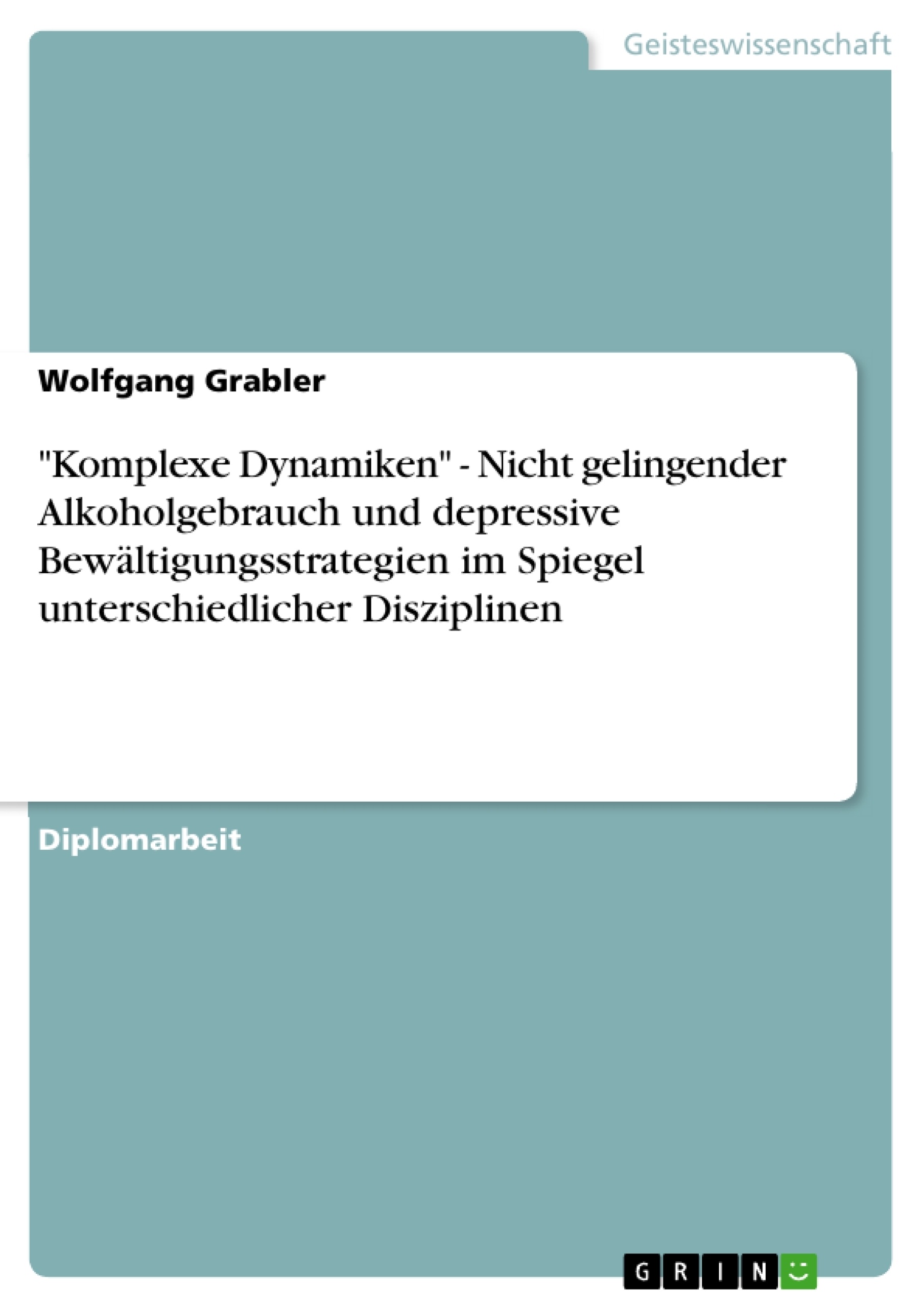Anliegen: Vor dem Hintergrund biopsychosozialer Faktoren, die für die Phänomene der Alkoholabhängigkeit und der Depression in ihrer Entstehung und ihrem Verlauf ausschlaggebend sein können, sollen biologische, psychische und soziale Bedeutungen abgeklärt werden. Daneben soll der komplexe Zusammenhang zwischen Alkoholabhängigkeit und Depression dargestellt werden. Eine multidisziplinäre Sichtweise stellt die Phänomene dar, vergleicht sie und bringt diese miteinander in Verbindung. Dabei wird die Bedeutung der Lebensbewältigung im Alltag hervorgehoben, der als Schnittstelle der subjektiven Erfahrungs- und Bewältigungsmuster mit den sie bedingenden „objektiven“ gesellschaftlichen Strukturen verstanden wird. Somit wird der gesellschaftliche Ort für diese Phänomene aufgeschlossen, um diese speziellen Verhaltensweisen zu verstehen.
Ergebnisse und Schlussfolgerungen: Alkoholabhängigkeit und Depression sind Bewältigungsstrategien, die sich wechselseitig beeinflussen können. Diese Phänomene können als Anpassungsverhalten an anomische Verhältnisse betrachtet werden. Durch ein Ungleichgewicht individueller und sozialer Ressourcen kann es zu einer psychosozialen Missbalance kommen, die Menschen mit allen Mitteln ausgleichen wollen, sei es durch riskanten Alkoholgebrauch und/oder depressiven Verhaltensweisen. Für die Entstehung und den Verlauf dieser Phänomene und somit auch für Hilfs- und Versorgungssysteme sind soziale Faktoren ausschlaggebend.
Schlüsselwörter: Lebensbewältigung - Risikogesellschaft - Alltag - nicht gelingender Alkoholgebrauch - Depression
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- 1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch
- 1.1 Begriffsklärungen
- 1.2 Erklärungsansätze und Typologien
- 1.3 Gesellschaft und Alkohol
- 2. Depressive Bewältigungsstrategien
- 2.1 Begriffsklärungen
- 2.2 Erklärungsansätze und Verlaufsformen
- 2.3 Depressive Bewältigungsstrategien und Gesellschaft
- 3. Das Verhältnis von Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien
- 3.1 Zusammenhang beider Phänomene
- 3.2 Die Rolle der Gesellschaft
- 4. Perspektiven der Sozialen Arbeit
- 4.1 Kritik am Krankheitskonzept
- 4.2 Professionelle Handlungsstrategien
- 4.3 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht den komplexen Zusammenhang zwischen nicht gelingendem Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien unter Berücksichtigung biopsychosozialer Faktoren. Ziel ist es, die biologischen, psychischen und sozialen Bedeutungen beider Phänomene zu klären und deren wechselseitige Beeinflussung darzustellen. Der Fokus liegt auf der Betrachtung dieser Phänomene als Anpassungsmechanismen an gesellschaftliche Bedingungen und auf der Rolle der Lebensbewältigung im Alltag.
- Biopsychosoziale Faktoren bei Alkoholmissbrauch und Depression
- Wechselseitige Beeinflussung von Alkoholmissbrauch und Depression
- Anpassungsstrategien in anomischen Verhältnissen
- Rolle sozialer Ressourcen und Ungleichgewichte
- Lebensbewältigung im Alltag als Schnittstelle
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und begründet die Wahl der Begriffe „nicht gelingender Alkoholgebrauch“ und „depressive Bewältigungsstrategien“ im Kontext der Alltags- und Lebensweltorientierung nach Thiersch und Böhnisch. Sie betont den multidisziplinären Ansatz und die Bedeutung des Alltags als Schnittstelle zwischen subjektiver Erfahrung und objektiven gesellschaftlichen Strukturen. Das Verständnis des Alltags als sowohl praktischer und problematischer als auch theoretischer Ort, an dem sich verschiedene Diskussionslinien kreuzen, wird hervorgehoben. Der Ansatz ist bewusst lebensweltorientiert und zielt darauf ab, das Subjekt in seinen Verhältnissen zu verstehen, ohne dabei Angebote oder Optionen für einen "gelingenderen" Alltag vorschreiben zu wollen.
1. Nicht gelingender Alkoholgebrauch: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Auseinandersetzung mit nicht gelingendem Alkoholgebrauch. Es beginnt mit Begriffsklärungen zu Alkoholismus, Alkoholabhängigkeit und Sucht, bevor verschiedene Erklärungsansätze und Typologien beleuchtet werden. Genetische Dispositionen, biologische Modelle, psychologische Erklärungsmodelle und der Ansatz der klinischen Sozialarbeit werden diskutiert. Schließlich wird der Einfluss der Gesellschaft auf den Alkoholkonsum analysiert, wobei der gesellschaftliche Kontext und die damit verbundenen Risikofaktoren im Mittelpunkt stehen. Die Zusammenfassung der verschiedenen Unterkapitel zeigt die Komplexität des Themas und die Notwendigkeit eines multidisziplinären Ansatzes zur Erklärung und Behandlung nicht-gelingenden Alkoholgebrauchs.
2. Depressive Bewältigungsstrategien: Dieses Kapitel widmet sich den depressiven Bewältigungsmustern. Es beginnt mit einer Definition der Depression in ihren verschiedenen Ausprägungen (depressive Störung, depressive Episode, Major Depression) und klärt den Begriff der „depressiven Bewältigungsstrategien“. Anschließend werden biologische und psychologische Erklärungsansätze sowie der Einfluss gesellschaftlicher Faktoren auf die Entstehung und den Verlauf depressiver Bewältigungsstrategien detailliert behandelt. Die Kapitelzusammenfassung beleuchtet die vielschichtigen Ursachen und die Bedeutung sozialer Umstände für das Verständnis und die Behandlung depressiver Erkrankungen. Es wird deutlich, dass Depression nicht nur ein individuelles Problem, sondern auch ein gesellschaftliches Phänomen ist.
3. Das Verhältnis von Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien: Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen nicht gelingendem Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien. Es analysiert, wie sich beide Phänomene wechselseitig beeinflussen und welche Rolle gesellschaftliche Faktoren dabei spielen. Die Zusammenfassung fasst die zentralen Argumente zusammen und unterstreicht die Bedeutung der Interdependenz beider Phänomene im Kontext sozialer Bedingungen. Es wird die komplexe Interaktion zwischen individueller Vulnerabilität und gesellschaftlichen Einflüssen auf die Entstehung und Aufrechterhaltung dieser problematischen Verhaltensweisen beleuchtet.
Schlüsselwörter
Lebensbewältigung, Risikogesellschaft, Alltag, nicht gelingender Alkoholgebrauch, Depression, biopsychosoziale Faktoren, Anpassungsstrategien, soziale Ressourcen, multidisziplinärer Ansatz.
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Nicht gelingender Alkoholgebrauch und depressive Bewältigungsstrategien
Was ist der Gegenstand der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht den komplexen Zusammenhang zwischen nicht gelingendem Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien. Sie betrachtet diese Phänomene unter Berücksichtigung biopsychosozialer Faktoren und analysiert deren wechselseitige Beeinflussung im Kontext gesellschaftlicher Bedingungen und der Lebensbewältigung im Alltag.
Welche Begriffe werden in der Arbeit verwendet und warum?
Die Arbeit verwendet die Begriffe „nicht gelingender Alkoholgebrauch“ und „depressive Bewältigungsstrategien“. Diese Wortwahl ist bewusst gewählt, um einen lebensweltorientierten Ansatz zu betonen und das Subjekt in seinen Verhältnissen zu verstehen, ohne vorgefertigte Lösungen oder Bewertungen anzubieten.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die biologischen, psychischen und sozialen Bedeutungen von nicht gelingendem Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien zu klären und deren wechselseitige Beeinflussung darzustellen. Der Fokus liegt auf der Betrachtung dieser Phänomene als Anpassungsmechanismen an gesellschaftliche Bedingungen und auf der Rolle der Lebensbewältigung im Alltag.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt biopsychosoziale Faktoren bei Alkoholmissbrauch und Depression, die wechselseitige Beeinflussung beider Phänomene, Anpassungsstrategien in anomischen Verhältnissen, die Rolle sozialer Ressourcen und Ungleichgewichte sowie die Lebensbewältigung im Alltag als Schnittstelle.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Einleitung, Nicht gelingender Alkoholgebrauch, Depressive Bewältigungsstrategien und Das Verhältnis von Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien. Jedes Kapitel beinhaltet Unterkapitel, die die jeweiligen Themenbereiche detailliert behandeln. Ein abschließendes Kapitel befasst sich mit Perspektiven der Sozialen Arbeit.
Was wird im Kapitel „Nicht gelingender Alkoholgebrauch“ behandelt?
Dieses Kapitel bietet Begriffsklärungen (Alkoholismus, Alkoholabhängigkeit, Sucht), beleuchtet verschiedene Erklärungsansätze (genetische Dispositionen, biologische und psychologische Modelle, klinische Sozialarbeit) und analysiert den gesellschaftlichen Einfluss auf den Alkoholkonsum.
Was wird im Kapitel „Depressive Bewältigungsstrategien“ behandelt?
Dieses Kapitel definiert Depression in ihren verschiedenen Ausprägungen und klärt den Begriff der „depressiven Bewältigungsstrategien“. Es behandelt biologische und psychologische Erklärungsansätze und den Einfluss gesellschaftlicher Faktoren auf Entstehung und Verlauf depressiver Bewältigungsstrategien.
Was wird im Kapitel „Das Verhältnis von Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien“ behandelt?
Dieses Kapitel untersucht den Zusammenhang zwischen nicht gelingendem Alkoholgebrauch und depressiven Bewältigungsstrategien, analysiert deren wechselseitige Beeinflussung und die Rolle gesellschaftlicher Faktoren.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Lebensbewältigung, Risikogesellschaft, Alltag, nicht gelingender Alkoholgebrauch, Depression, biopsychosoziale Faktoren, Anpassungsstrategien, soziale Ressourcen, multidisziplinärer Ansatz.
Welche Perspektiven der Sozialen Arbeit werden aufgezeigt?
Das letzte Kapitel widmet sich der Kritik am Krankheitskonzept, professionellen Handlungsstrategien und einem Ausblick aus der Perspektive der Sozialen Arbeit.
- Quote paper
- Mag. (FH) Wolfgang Grabler (Author), 2007, "Komplexe Dynamiken" - Nicht gelingender Alkoholgebrauch und depressive Bewältigungsstrategien im Spiegel unterschiedlicher Disziplinen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85819