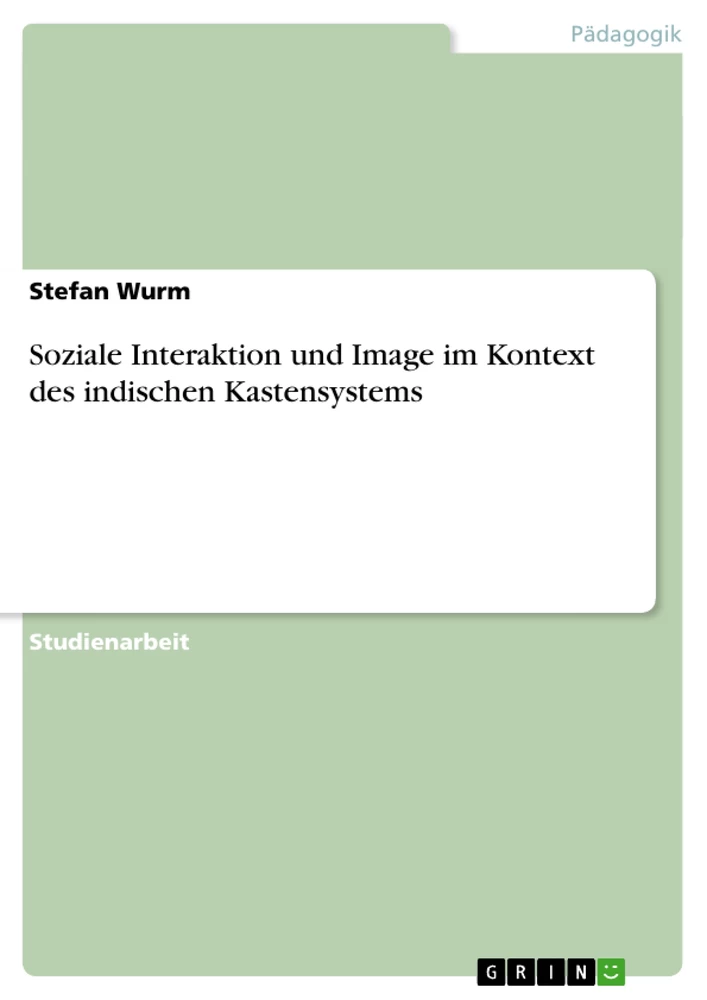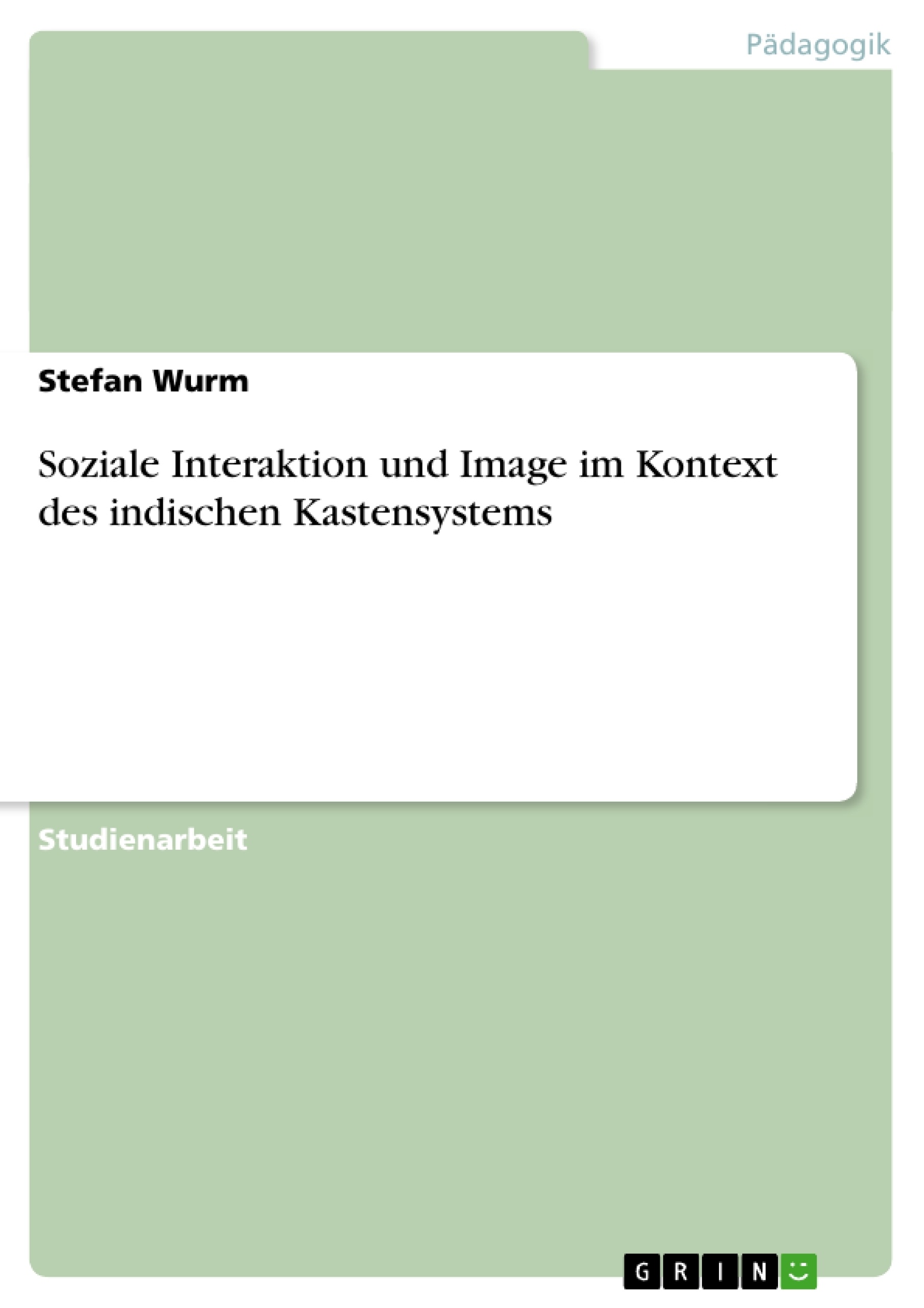Es wird versucht einen Konnex zwischen den Ansätzen von Goffman und religiösen bzw. kulturellen Unterschieden herzustellen. Dazu sollen auch Erfahrungen aus mehren theoretischen Vorbereitungswochenenden für ein Indienaustauschprogramm einfließen.
Der Aufbau dieser Arbeit ist bewusst schlicht ausgestaltet. Zu Beginn werden die wichtigsten Inhalte der „Techniken der Imagepflege“ prägnant dargestellt. Daraufhin wird der Versuch unternommen, einige Verweise auf kulturelle Unterschiede zu unternehmen. Abschließend wird der Autor einen persönlichen Kommentar zur Thematik abgeben.
Inhaltsverzeichnis
1. Einleitung
2. Ausgangspunkt: Erving Goffman – ein Außenseiter?
3. Image
4. Techniken der Imagepflege
5. Die Angemessenheit der Techniken
6. Ein Aufeinanderprallen von zwei Vorstellungen? Rituelle Ordnung und indisches Kastenwesen
7. Das heutige Kastensystem und dessen Auswirkung auf die soziale Interaktion
8. Bemerkungen des Autors - Westliche Vorstellungen treffen indische Kultur
1. Einleitung
Inspiriert von einem Gespräch in den Weihnachtsferien und einem später durchgeführten Interview über die Entstehung der Weltreligionen und die damit einhergehenden Unterschiede in Kultur und persönlicher Interaktion zwischen Österreich und Indien mit meinem Großcousin DDr. Alois Wurm, sollte diese Seminararbeit ursprünglich unter dem Titel „Image und Interaktion in Indien“ stehen.
Allerdings liegt es auf der Hand, dass diese Thematik den Rahmen dieser Ausarbeitung eindeutig sprengen würde und eine zu große Menge an Hintergrundliteratur notwendig wäre. Dennoch wird versucht einen Konnex zwischen den Ansätzen von Goffman und religiösen bzw. kulturellen Unterschieden herzustellen. Dazu sollen auch Erfahrungen aus mehren theoretischen Vorbereitungswochenenden für ein Indienaustauschprogramm im Februar 2006, gehalten vom Team von Enchada – dem entwicklungspolitischen Projekts der katholischen Jugend Österreich – in der Zeit zwischen Oktober 2005 und Jänner 2006, einfließen.
Der Aufbau dieser Arbeit ist bewusst schlicht ausgestaltet. Zu Beginn werden die wichtigsten Inhalte der „Techniken der Imagepflege“ prägnant dargestellt. Daraufhin wird der Versuch unternommen, einige Verweise auf kulturelle Unterschiede zu unternehmen. Abschließend wird der Autor einen persönlichen Kommentar zur Thematik abgeben.
2. Ausgangspunkt: Erving Goffman – ein Außenseiter?
„Goffman hat in weiten Teilen das Image eines Außenseiters […]“[1] schreibt Karl Lenz in seinem Artikel über Erving Goffman – Werk und Rezeption.
Trotzdem – oder vielleicht weil sich ein Außenseiter mit vielen kuriosen Dingen aus dem Alltag beschäftigt hat – zählt Erving Goffman unbestritten zu den meistgelesenen Autoren in der Soziologie und viele seiner Konzepte haben auch in Nachbardisziplinen weite Verbreitung gefunden.[2]
Erving Goffman untersucht in seinen Essays zur Face-to-Face Behavior – auf dessen Auszug über die Techniken der Imagepflege diese Übersicht explizit eingeht – die direkte Interaktion. Er schenkt dabei vor allem kleinen Verhaltensmomenten Aufmerksamkeit und geht davon aus, dass jede Person in direkter Interaktion durch andere und sich selbst einer Beurteilung unterliegt.[3]
Wie eine Situation ausgehandelt wird (also die Rahmenabstimmung), geht nach Goffman notwendig mit dem Entwurf von Selbstbildern einher. Die Beteiligten einer Interaktion einigen sich nicht lediglich darüber, was vor sich geht, sondern damit auch immer über ihre Position in der Situation und ihr Verhältnis zueinander.[4]
Weiters führt er den Begriff der rituellen Ordnung ein; diese entspricht der sozialen Ordnung, denn wo soziale Unterschiede, Rollen, Rang, Schichten usw. vorhanden sind, gibt es auch Rituale, die diese Strukturen einführen, erneuern und bestätigen. Die wechselseitige Bestätigung der erwähnten Selbstbilder und die einander signalisierte Bereitschaft zur Kooperation bei der Bewahrung der Selbstbilder stellen den Ausgangspunkt der Analyse bei Goffman dar. Dies ist für ihn der Zustand einer "expressiven Ordnung", eines emotionalen Gleichgewichtes der Interaktion. Expressiv deshalb, weil sie allen Beteiligten eine bestimmte Aufmerksamkeitslenkung und ein bestimmtes Engagement abverlangt bzw. darin ihre Voraussetzung hat. Diese Ordnung kann sowohl verbal als auch nonverbal realisiert und aufrechterhalten werden und fungiert für alle Beteiligten als eine normative Orientierung: Sie folgen der Regel, das eigene Selbstbild zu achten und das der anderen zu bedenken bzw. zu schonen.[5]
Die Rolle von Ritualen zur Einführung von Strukturen lässt sich auch an den drei Ebenen der Identitätsfindung gut nachzeichnen. Hier wird davon ausgegangen, dass je größer ein Ritual ist, desto mehr Distanz zwischen Akteur und Ritus geschaffen wird. So würde sich das Individuum im Gespräch mit sich selbst auf Ebene eins wieder finden, auf der zweiten Ebene finden soziale Interaktion und Rollenspiele statt. Die Identitätsfindung auf der dritten Ebene findet vor allem durch Massenzeremonien wie zum Beispiel politische Rituale an Nationalfeiertagen statt.[6]
3. Image
Auf der erwähnten zweiten Ebene findet der direkte oder indirekte Kontakt mit anderen Menschen statt und Goffman unterstellt diesen, dass jede/r eine bestimmte Strategie im Verhalten verfolgt. Unter dieser Vorrausetzung definiert er Image als positiven sozialen Wert, den man für sich durch die Verhaltensstrategie erwirbt, von der die anderen annehmen, man verfolge sie in einer bestimmten Interaktion.[7]
Das Image spielt, laut Goffman, eine wichtige Rolle, wenn es um die Herstellung sozialer Ordnung geht. Durch das Image werden Interaktionen mit Erwartungssicherheiten versorgt; stabile Verhaltenserwartungen vergrößern die Erfolgschancen von Handlungen, halten ihr Risiko gering, da Handlungen bis zu einem gewissen Grad erwartet werden und man sich darauf einstellen kann.[8]
[...]
[1] Hettlage 1991, S. 25
[2] Vgl. Hettlage 1991, S. 25
[3] Vgl. Goffman 1994, S. 7 und Eiden 2004.
[4] Vgl. Rothe, http://ik.euv-frankfurt-o.de/module/modul_II/zentrale_bereiche/image/image_norm.html, Zugriff am 10.1.2006
[5] Vgl. Rothe, http://ik.euv-frankfurt-o.de/module/modul_II/zentrale_bereiche/image/image_norm.html, Zugriff am 10.1.2006
[6] Vgl. Eiden 2004
[7] Vgl. Goffman 1994, S. 10
[8] Vgl. Rothe, http://ik.euv-frankfurt-o.de/module/modul_II/zentrale_bereiche/image/image_norm.html, Zugriff am 10.1.2006
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst das indische Kastensystem die soziale Interaktion?
Die rituelle Ordnung des Kastenwesens legt Positionen, Ränge und Rollen fest, die in der täglichen Face-to-Face-Interaktion durch spezifische Verhaltensweisen und Rituale bestätigt werden.
Was versteht Erving Goffman unter „Techniken der Imagepflege“?
Es handelt sich um Strategien, mit denen Individuen in sozialen Situationen versuchen, ein positives Selbstbild (Image) aufrechtzuerhalten und das Image ihrer Interaktionspartner zu schonen.
Was definiert Goffman als „Image“?
Goffman definiert Image als den positiven sozialen Wert, den eine Person durch eine Verhaltensstrategie erwirbt, von der andere annehmen, dass sie diese in einer bestimmten Interaktion verfolgt.
Welche Bedeutung haben Rituale für die soziale Ordnung?
Rituale dienen dazu, soziale Strukturen einzuführen, zu erneuern und zu bestätigen. Sie schaffen Erwartungssicherheit und verringern das Risiko in sozialen Interaktionen.
Was passiert beim Aufeinandertreffen westlicher und indischer Vorstellungen?
Die Arbeit reflektiert kulturelle Unterschiede in der rituellen Ordnung und persönlichen Interaktion, die besonders bei Austauschprogrammen zu Missverständnissen oder neuen Erkenntnissen führen können.
- Quote paper
- Stefan Wurm (Author), 2005, Soziale Interaktion und Image im Kontext des indischen Kastensystems, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85843