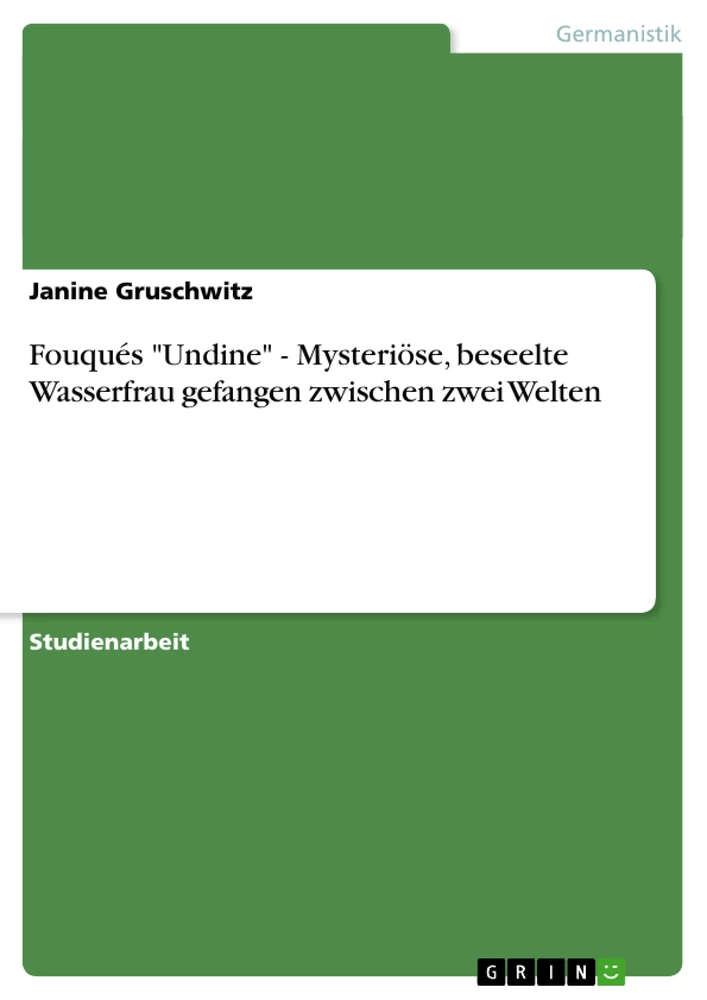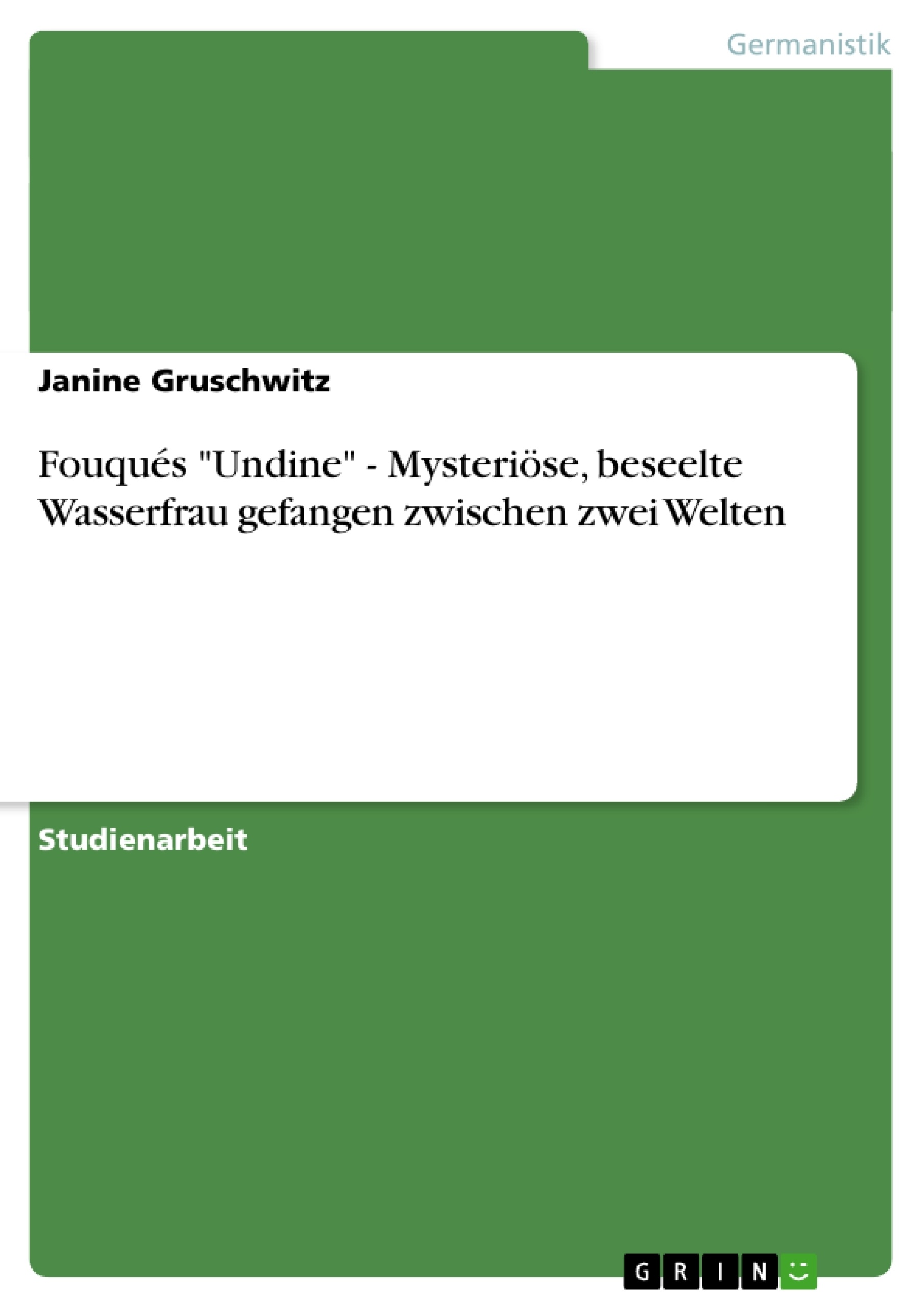Von Beginn der Rezeptionsgeschichte an ist nahezu jedes resümierende Urteil über Fouqués umfangreiches Werk ambivalent […]. In den ersten zwei Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts gehört Fouqué zu den beliebtesten (Unterhaltungs-)Schriftstellern; mit der ›Undine‹, dem ›Zauberring‹ und dem ›Held des Nordens‹ macht er das poetische und das politische Programm der Romantik in literarischer Hinsicht populär.
Doch besonders mit der zuerst genannten Erzählung „Undine“ (1811) machte sich Friedrich de la Motte Fouqué (1777-1843) seinen Namen in der Literatur-geschichte. Bis heute gilt er in erster Linie als Autor dieses einen Werkes, denn „die Geschichte von dem unschuldigen Wassermädchen und ihrem treulosen Geliebten wirkt auf uns in unverminderter Frische und Schönheit.“ Was macht diese Erzählung aber aus, dass sie einen solchen Reiz auf die Leser damaliger und auch heutiger Zeit auszuüben vermag? Vor allem, da der Stoff der Geschichte sogar noch aus dem 16. Jahrhundert von dem Naturwissenschaftler Paracelsus stammt. Es stellen sich daher die Fragen, was dieses Undine-Motiv so außergewöhnlich macht und welche Aspekte der Vorlage Fouqué für seinen Text übernommen hat. Darüber hinaus bietet sich eine genaue Charakterisierung der Hauptfigur Undine an, deren Verhalten bereits zu Beginn der Geschichte eine faszinierende Andersartigkeit ausweist. Höhepunkt der Erzählung stellt dann allerdings die folgenreiche Beseelung des geheimnisvollen Elementargeistes dar. Interessant ist in diesem Zusammenhang nicht nur der drastische Charakterumschwung Undines, sondern auch ihre bewusste Abkehr von ihren geisterhaften Verwandten und ihrem heimischen Element dem Wasser. Weitere Spannung erhält der Text wiederum durch eine Dreieckskonstellation: Undine, immer noch teilweise eine Wasserfrau, trifft auf die menschliche Bertalda, die ebenfalls um die Liebe des Ritters Huldbrand kämpft – und am Ende siegt. Wie Pfeiffer in diesem Zusammenhang bestätigt:
Von vornherein können wir uns einer trüben Ahnung nicht erwehren, daß das Ende kein glückliches sein werde, und stets wird diese Ahnung in geschickter Weise bei uns rege gehalten durch die mannigfachen Erscheinungen aus der Welt der Elementargeister.
Deren Gesetzte sind es auch, die Undine letztlich in ihr Element zurückkehren lassen und sie zwingen, ihren Geliebten für seinen Treuebruch mit dem Tod zu bestrafen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung in die Thematik
- 2. Paracelsus als Inspiration für Fouqués Undine
- 2.1 Die Vorlage: Paracelsus & seine Elementargeister
- 2.2 Gemeinsamkeiten zu Fouqué
- 3. Undine – die geisterhafte Wasserfrau
- 3.1 Irgendetwas ist anders.
- 3.2 Undine bekommt eine Seele
- 4. Gefangen zwischen zwei Welten
- 4.1 Abkehr von den Elementargeistern
- 4.2 Dreiecksbeziehung - Wassernixe gegen Menschenfrau
- 4.3 Endgültige Niederlage - Undine kehrt in ihr Element zurück
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit setzt sich zum Ziel, die Bedeutung von Fouqués "Undine" in der literarischen Tradition der Romantik zu beleuchten und die Inspiration des Werkes durch Paracelsus' Überlegungen zu den Elementargeistern zu untersuchen. Die Arbeit analysiert dabei die charakterliche Entwicklung der Titelfigur Undine sowie die Spannungen, die aus ihrer Existenz zwischen den Welten der Menschen und der Geister entstehen.
- Paracelsus' Konzept der Elementargeister als Inspirationsquelle für Fouqués "Undine"
- Die Besonderheit der Wasserfrau Undine: Ihr Wesen, ihre seelische Entwicklung und ihre Andersartigkeit
- Die Ambivalenz von Undines Beziehung zum Menschen: Sehnsucht nach Liebe und Integration, aber auch die Gefahr des Treuebruchs
- Der Konflikt zwischen Undines Natur als Wasserwesen und ihrem Streben nach menschlicher Liebe
- Die Rolle der Dreieckskonstellation in der Erzählung: Undine, Bertalda und Huldbrand
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Bedeutung von Fouqués Werk "Undine" für die Romantik beleuchtet und die Ausgangssituation der Geschichte von Undine und ihrer besondere Andersartigkeit vorgestellt.
Kapitel zwei untersucht die naturwissenschaftlichen Überlegungen von Paracelsus zu den Elementargeistern und deren Bedeutung als Vorlage für Fouqués Erzählung. Es werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Paracelsus' Konzept und Fouqués literarischer Umsetzung herausgestellt.
Das dritte Kapitel zeichnet die Entwicklung der Figur Undine nach: Ihre anfängliche seelenlose Existenz, ihre Beseelung durch die Heirat und ihre Bewusstwerdung ihrer Andersartigkeit.
Kapitel vier beleuchtet die Spannungen, die aus Undines Doppelleben resultieren: ihre Abkehr von den Elementargeistern, ihre Beziehung zum Menschen Huldbrand und der Konflikt mit Bertalda sowie die Tragödie, die sich aus dem Treuebruch ergibt.
Schlüsselwörter
Fouqué, Undine, Paracelsus, Elementargeister, Wasserfrau, Seele, Liebe, Treue, Dreieckskonstellation, Romantik, literarische Tradition.
Häufig gestellte Fragen
Wer ist der Autor von "Undine"?
Die Erzählung wurde 1811 von Friedrich de la Motte Fouqué verfasst.
Welche Rolle spielte Paracelsus für das Werk?
Fouqué nutzte die naturwissenschaftlichen Überlegungen von Paracelsus aus dem 16. Jahrhundert über Elementargeister als Inspirationsquelle für seine Wasserfrau.
Wie verändert sich Undines Charakter im Verlauf der Geschichte?
Undine ist anfangs ein seelenloser Elementargeist. Durch die Heirat mit Ritter Huldbrand erhält sie eine Seele, was zu einem drastischen Charakterumschwung und menschlichen Gefühlen führt.
Was ist der zentrale Konflikt in "Undine"?
Der Konflikt liegt in Undines Existenz zwischen zwei Welten – dem Reich der Wassergeister und der menschlichen Gesellschaft – sowie in der Dreiecksbeziehung mit Bertalda und Huldbrand.
Warum muss Undine Huldbrand am Ende bestrafen?
Nach den Gesetzen der Elementargeister ist sie gezwungen, ihren Geliebten für seinen Treuebruch mit dem Tod zu bestrafen, als sie in ihr Element zurückkehrt.
- Arbeit zitieren
- Janine Gruschwitz (Autor:in), 2006, Fouqués "Undine" - Mysteriöse, beseelte Wasserfrau gefangen zwischen zwei Welten, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85854