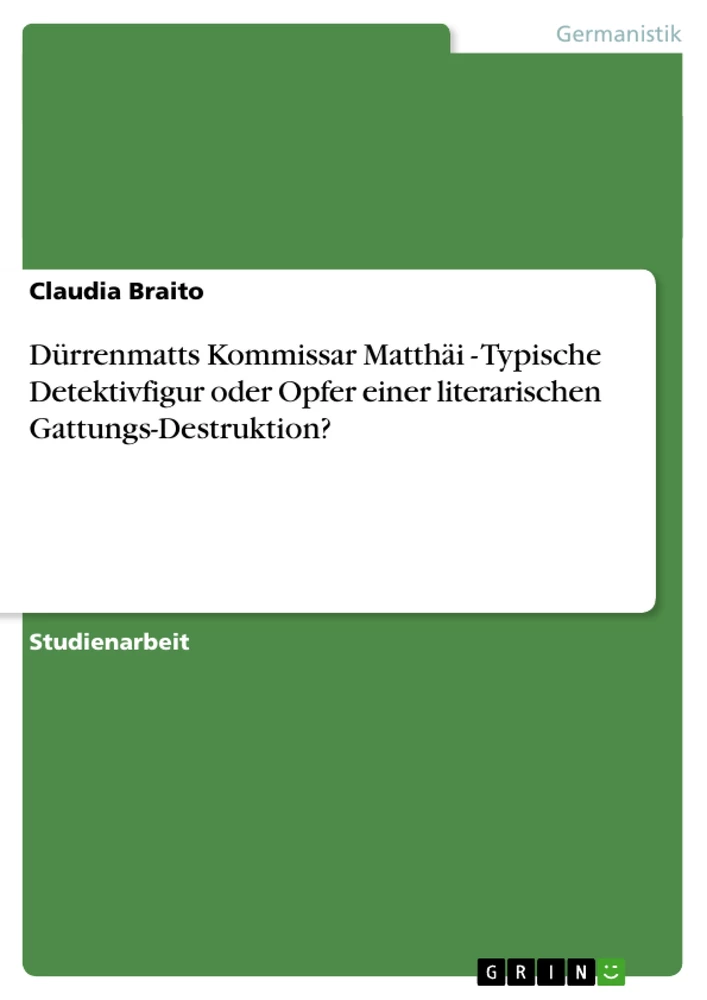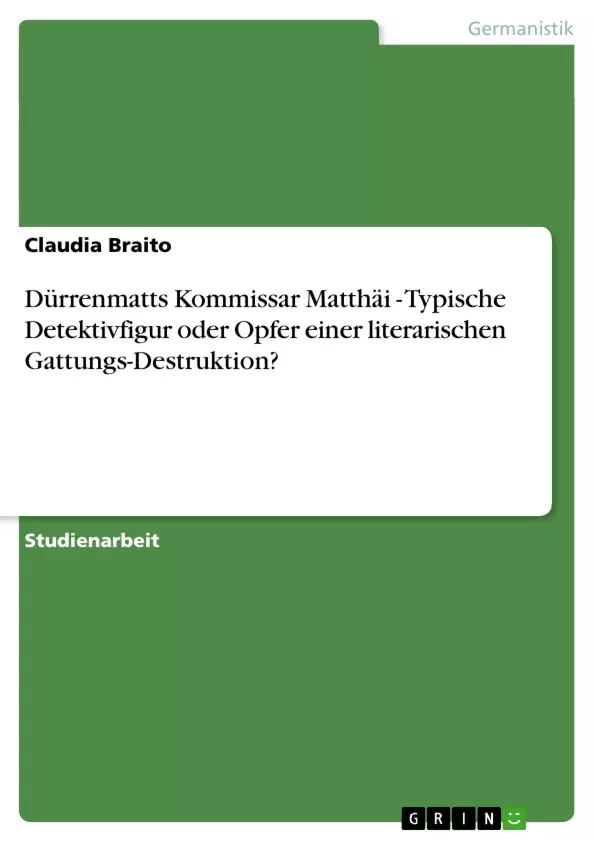1 Einleitung
[...]
Kapitel zwei enthält eine ausführliche Charakterisierung Kommissar Matthäis. Ausgehend von Peter Nussers „Elementen[n] und Strukturen des idealtypischen Detektivromans“ sollen die Merkmale der Gestalt eines „typischen“ Detektivs sowie seine Arbeitsweise mit denen von Matthäi verglichen werden. Die Charakterisierung erfolgt über das äußere Erscheinungsbild und Verhalten des Kommissars, seine soziale Situation und sein psychisches Verhalten. Unter Einbeziehung seiner Mitarbeiter wird zudem erörtert, inwiefern Matthäi dem Bild eines isolierten Ermittlers entspricht. Matthäis Weg vom Genie zum Wahnsinnigen wird dargelegt und begründet. Auch die Methoden und das Verfahren des Kommissars werden dahingehend charakterisiert. Verglichen wird der Matthäi des Romans dabei mit der Darstellung Heinz Rühmanns als Kommissar Matthäi in Es geschah am hellichten Tag. Es soll erörtert werden, inwiefern die beiden Kommissare sich bei ihrer Suche nach einem Mörder sowohl in ihrer Arbeitsweise als auch in ihrem Verhalten gleichen bzw. unterscheiden.
In Kapitel drei wird Matthäis Weg vom Genie zum Wahnsinnigen unter dem Einfluss des Unberechenbaren beschrieben. Die Bedeutung des Zufalls als unberechenbare Größe in der Arbeit eines Detektivs wird eruiert, das Scheitern Matthäis an seiner Weigerung, das Absurde in seine Ermittlungen miteinzuberechnen, nachvollzogen. Anhand der „21 Punkte zu den >Physikern<“ sollen die Auswirkungen des Zufalls nicht nur auf den rationalen Detektiv, sondern auch auf den gesamten Handlungsverlauf geschildert werden.
Kapitel vier befasst sich mit der Frage, ob es möglich ist, dass ein Detektivroman - vor allem für die zentrale Figur - derart endet. Dürrenmatts Konzept vom Zufall wird beschrieben, die Frage, ob die Rahmenhandlung und das damit verbundene Happyend durch die Aufklärung des Falles diesem Konzept entgegenstehen, wird gestellt. Die Dekonstruktion des Handlungsinhalts, bei gleichzeitigem, annäherndem Beibehalten der Struktur eines Kriminalromans, soll erläutert, das Vorliegen eines Requiems auf den Kriminalroman diesbezüglich eruiert werden. Die „aufklärerische Intention“ des Romans wird anhand Dürrenmatts Kritik an Schriftstellern „idealtypischer“ Kriminalromane sowie an der Verfilmung Es geschah am hellichten Tag beschrieben.
Das letzte Kapitel fasst die Ergebnisse der Untersuchungen noch einmal kurz zusammen, ein Bogen zurück wird geschlagen
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Charakterisierung Kommissar Matthäis
- Merkmale der Gestalt - Vom Genie zum Wahnsinnigen
- Die Arbeitsweise eines rationalen Detektivs
- Der Apparat hinter Matthäi
- Matthäi - Ein Logiker am Zufall gescheitert?
- Demontage des Detektivromans - „Das Versprechen“ als tatsächliches Requiem auf den Kriminalroman?
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht Friedrich Dürrenmatts Roman „Das Versprechen“ und die darin dargestellte Figur des Kommissar Matthäi. Die Arbeit analysiert Matthäis Charakter, seine Arbeitsweise und seine Rolle im Kontext des Detektivromans. Besonderes Augenmerk liegt auf der Frage, ob Matthäi ein typischer Detektiv ist oder ob er die literarische Gattung des Kriminalromans dekonstruiert.
- Charakterisierung von Kommissar Matthäi und Vergleich mit dem idealtypischen Detektiv
- Die Rolle des Zufalls in Matthäis Ermittlungen und dessen Einfluss auf den Handlungsverlauf
- Analyse von Dürrenmatts Kritik am traditionellen Kriminalroman
- Die Frage nach „Das Versprechen“ als Requiem auf den klassischen Detektivroman
- Vergleich der Romanfigur mit der Verfilmung (Heinz Rühmann)
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht die Charakterisierung Kommissar Matthäis in Dürrenmatts „Das Versprechen“, die Rolle des Zufalls und die Frage, ob der Roman ein Requiem auf den traditionellen Kriminalroman darstellt. Die Analyse soll klären, ob Matthäi einer idealtypischen Detektivfigur entspricht oder ob er Opfer einer Genre-Destruktion wird.
Charakterisierung Kommissar Matthäis: Dieses Kapitel charakterisiert Kommissar Matthäi umfassend, indem es seine äußeren Merkmale, sein Verhalten, seine soziale Situation und seine Psyche beleuchtet. Es vergleicht Matthäis Eigenschaften und Arbeitsweise mit dem idealtypischen Detektiv nach Peter Nussers Definition. Der Vergleich mit der Darstellung Heinz Rühmanns in der Verfilmung „Es geschah am hellichten Tag“ wird ebenfalls vorgenommen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen. Matthäis Entwicklung vom Genie zum Wahnsinnigen wird nachvollzogen und begründet.
Matthäi - Ein Logiker am Zufall gescheitert?: Dieses Kapitel analysiert Matthäis Scheitern im Angesicht des Zufalls und der Unberechenbarkeit. Es untersucht die Bedeutung des Zufalls in der Detektivarbeit und wie Matthäis Weigerung, das Absurde in seine Ermittlungen einzubeziehen, zu seinem Scheitern beiträgt. Die "21 Punkte zu den Physikern" Dürrenmatts werden herangezogen, um die Auswirkungen des Zufalls auf den rationalen Detektiv und den gesamten Handlungsverlauf zu veranschaulichen.
Demontage des Detektivromans - „Das Versprechen“ als tatsächliches Requiem auf den Kriminalroman?: Dieses Kapitel befasst sich mit der Frage, ob Dürrenmatts Roman eine Dekonstruktion des traditionellen Detektivromans darstellt. Es untersucht Dürrenmatts Konzept des Zufalls und analysiert, ob das Happyend der Rahmenhandlung diesem Konzept widerspricht. Die Analyse fokussiert auf die Dekonstruktion des Handlungsinhalts bei gleichzeitiger Beibehaltung der Struktur eines Kriminalromans und untersucht die "aufklärerische Intention" des Romans im Kontext von Dürrenmatts Kritik an traditionellen Kriminalromanen und deren Verfilmungen.
Schlüsselwörter
Kommissar Matthäi, Friedrich Dürrenmatt, Das Versprechen, Detektivroman, Kriminalroman, Zufall, Rationalität, Genre-Destruktion, Idealtypische Detektivfigur, Heinz Rühmann, Es geschah am hellichten Tag.
Häufig gestellte Fragen zu Friedrich Dürrenmatts "Das Versprechen"
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit analysiert Friedrich Dürrenmatts Roman "Das Versprechen" mit besonderem Fokus auf die Figur des Kommissar Matthäi. Sie untersucht Matthäis Charakter, seine Arbeitsweise und seine Rolle im Kontext des Detektivromans. Ein zentrales Thema ist die Frage, ob Matthäi den traditionellen Kriminalroman dekonstruiert oder ob er ein typischer Detektiv ist.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die Charakterisierung von Kommissar Matthäi im Vergleich zu idealtypischen Detektivfiguren, die Rolle des Zufalls in Matthäis Ermittlungen und dessen Einfluss auf den Handlungsverlauf, Dürrenmatts Kritik am traditionellen Kriminalroman, die Frage nach "Das Versprechen" als Requiem auf den klassischen Detektivroman und ein Vergleich der Romanfigur mit der Verfilmung von Heinz Rühmann.
Wie wird Kommissar Matthäi charakterisiert?
Die Arbeit charakterisiert Kommissar Matthäi umfassend, beleuchtet seine äußeren Merkmale, sein Verhalten, seine soziale Situation und seine Psyche. Es findet ein Vergleich mit dem idealtypischen Detektiv statt und die Entwicklung Matthäis vom Genie zum Wahnsinnigen wird nachvollzogen und begründet. Ein Vergleich mit der Darstellung Heinz Rühmanns in der Verfilmung "Es geschah am hellichten Tag" wird ebenfalls durchgeführt.
Welche Rolle spielt der Zufall in der Arbeit?
Die Arbeit analysiert Matthäis Scheitern im Angesicht des Zufalls und der Unberechenbarkeit. Sie untersucht die Bedeutung des Zufalls in der Detektivarbeit und wie Matthäis Weigerung, das Absurde in seine Ermittlungen einzubeziehen, zu seinem Scheitern beiträgt. Die "21 Punkte zu den Physikern" Dürrenmatts werden herangezogen, um die Auswirkungen des Zufalls zu veranschaulichen.
Ist "Das Versprechen" ein Requiem auf den traditionellen Kriminalroman?
Die Arbeit untersucht die Frage, ob Dürrenmatts Roman eine Dekonstruktion des traditionellen Detektivromans darstellt. Sie analysiert Dürrenmatts Konzept des Zufalls und untersucht, ob das Happyend der Rahmenhandlung diesem Konzept widerspricht. Die Analyse fokussiert auf die Dekonstruktion des Handlungsinhalts bei gleichzeitiger Beibehaltung der Kriminalromanstruktur und untersucht die "aufklärerische Intention" des Romans im Kontext von Dürrenmatts Kritik an traditionellen Kriminalromanen und deren Verfilmungen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Charakterisierung Kommissar Matthäis, ein Kapitel zu Matthäis Scheitern am Zufall, ein Kapitel zur Demontage des Detektivromans und eine Zusammenfassung.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kommissar Matthäi, Friedrich Dürrenmatt, Das Versprechen, Detektivroman, Kriminalroman, Zufall, Rationalität, Genre-Destruktion, Idealtypische Detektivfigur, Heinz Rühmann, Es geschah am hellichten Tag.
- Citar trabajo
- Claudia Braito (Autor), 2007, Dürrenmatts Kommissar Matthäi - Typische Detektivfigur oder Opfer einer literarischen Gattungs-Destruktion?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85885