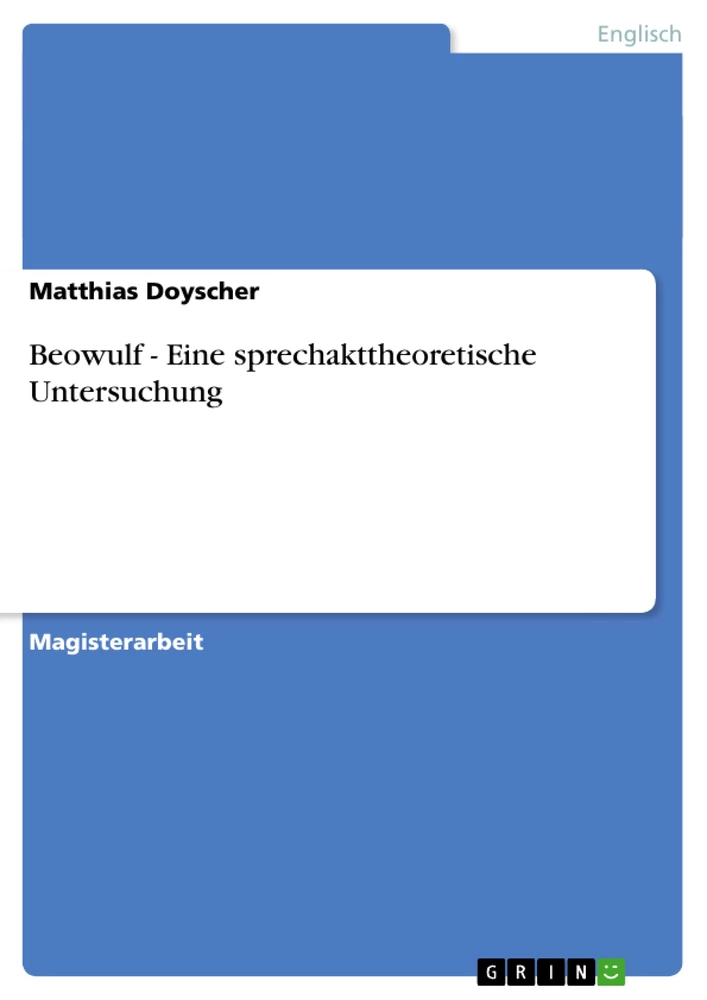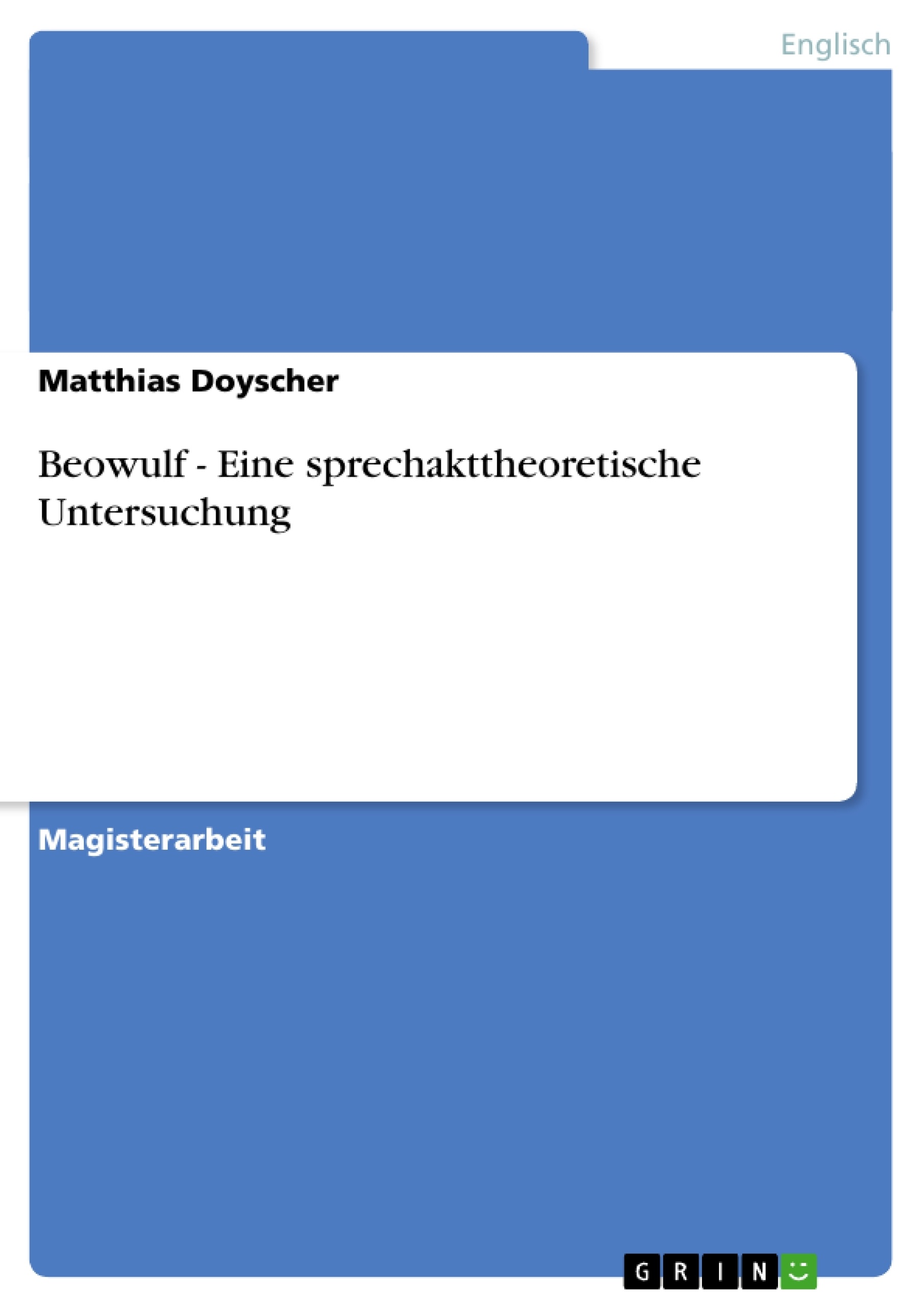Das Beowulf-Epos gilt als das bedeutendste Werk der altenglischen Dichtung. Es ist zugleich das älteste komplett erhaltene germanische Heldenepos. Die Forschung hat bisher die Analyse der in direkter Rede gehaltenen Passagen der epischen Dichtung des Beowulf aus sprechakttheoretischer Sicht weitgehend außer Acht gelassen.
In dieser Arbeit erfolgt die sprechakttheoretische Analyse der im Beowulf geäußerten Spruchweisheiten, d. h. es werden die illokutionären Kräfte direkter Rede untersucht. Eine solche Analyse ermöglicht es dann, bestimmte Muster illokutionärer Kräfte von Spruchweisheiten herauszuarbeiten.
Ein besonderes Augenmerk bei der Analyse von Texten einer anderen Kultur, also nicht nur der frühmittelalterlichen angelsächsischen Kultur, muss auf das Verstehen des Denkens der damaligen Zeit gelegt werden. Aus diesem Grund wird ausführlich auf den kulturellen Kontext und die Funktion von Spruchweisheiten in der angelsächsischen Gesellschaft eingegangen.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- GNOMIK IN DER ALTENGLISCHEN DICHTUNG
- DEFINITIONEN
- MAXIMEN UND GNOMAI IN ABGRENZUNG ZU SPRICHWÖRTERN
- VERBEN: SCULON UND BEON
- WEITERE ELEMENTE
- SPRUCHWEISHEITEN AUS KULTURELLER SICHT
- Wissen in der angelsächsischen Gesellschaft
- Die Funktion von Spruchweisheiten aus kultureller Perspektive
- Typisierung, Objektivierung, Institutionalisierung und Reifizierung
- Zusammenfassung
- DIE STRUKTURELLE FUNKTION VON SPRUCHWEISHEITEN INNERHALB EINER DICHTUNG
- EINE THEORIE ILLOKUTIONÄRER AKTE
- ILLOKUTIOonäre Kräfte UND PROPOSITIONEN
- DIE SECHS KOMPONENTEN DER ILLOKUTIONÄRE Kraft
- Der illokutionäre Zweck II
- Durchsetzungmodus μ
- Bedingung des propositionalen Gehalts 0
- Vorbereitende Bedingungen Σ
- Aufrichtigkeitsbedingung Y
- Der Grad der Stärke der Aufrichtigkeitsbedingung (n)
- ILLOKUTIONÄRE STAMMKRÄFTE
- EINFACHE ILLOKUTIONÄRE KRÄFTE
- ANALYSE DER ILLOKUTIONÄREN KRÄFTE VON SPRUCHWEISHEITEN IM BEOWULF
- KÜSTENWÄCHTER. ZEILEN 287B – 289
- BEOWULF. ZEILEN 440B – 441
- BEOWULF. ZEILE 455B
- BEOWULF. ZEILEN 572B-573
- BEOWULF. ZEILEN 1384B-1389
- Zeilen 1384b-1385
- Zeilen 1386-1387a
- Zeilen 1387b-1389
- ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der sprechakttheoretischen Untersuchung von Spruchweisheiten im Beowulf-Epos. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Analyse der illokutionären Kräfte, die durch die direkte Rede in der epischen Dichtung vermittelt werden. Ziel ist es, Muster illokutionärer Kräfte in Bezug auf Spruchweisheiten zu identifizieren. Dabei wird die Subjektivität der gefundenen Ergebnisse berücksichtigt, da die Interpretation des Kontextes eine wichtige Rolle spielt.
- Sprachliche Handlungstheorie und Illokutionslogik im Kontext der altenglischen Literatur
- Analyse der illokutionären Kräfte von Spruchweisheiten im Beowulf
- Funktion von Spruchweisheiten in der frühmittelalterlichen angelsächsischen Kultur
- Kultureller Einfluss auf die Interpretation von direkten Reden im Beowulf
- Subjektivität der Interpretation und Kontextualisierung in der sprechakttheoretischen Analyse
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Gnomik in der altenglischen Dichtung und beleuchtet die Funktion von Spruchweisheiten in der angelsächsischen Gesellschaft und Kultur. Es werden Definitionen und Abgrenzungen zu Sprichwörtern sowie die strukturelle Funktion von Spruchweisheiten innerhalb einer Dichtung beleuchtet. Das zweite Kapitel erläutert die Theorie illokutionärer Akte anhand der Monographien von John R. Searle und Daniel Vanderveken sowie Eckard Rolf. Es werden die sechs Komponenten der illokutionären Kraft, die illokutionären Stammkräfte und die einfachen illokutionären Kräfte vorgestellt. Das dritte Kapitel analysiert die illokutionären Kräfte von Spruchweisheiten in ausgewählten Passagen des Beowulf. Hierbei werden verschiedene Textstellen aus dem Epos betrachtet und deren illokutionäre Kraft interpretiert.
Schlüsselwörter
Sprechakttheorie, Illokutionslogik, Gnomik, Spruchweisheiten, Beowulf, Altenglische Dichtung, Frühmittelalterliche Kultur, Direkte Rede, Illokutionäre Kräfte, Kontextanalyse, Subjektivität der Interpretation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der sprechakttheoretischen Untersuchung des Beowulf?
Die Arbeit analysiert die illokutionären Kräfte von Spruchweisheiten in der direkten Rede des Epos, um Muster sprachlichen Handelns aufzuzeigen.
Was versteht man unter einer "illokutionären Kraft"?
Es bezeichnet die Absicht oder die Handlung, die ein Sprecher mit einer Äußerung vollzieht (z.B. raten, warnen, behaupten).
Warum ist Gnomik in der altenglischen Dichtung wichtig?
Gnomik bezieht sich auf Spruchweisheiten (Maximen), die in der angelsächsischen Gesellschaft zur Objektivierung und Weitergabe von Wissen und Normen dienten.
Welche Rolle spielen die Verben "sculon" und "beon"?
Diese Verben werden in Spruchweisheiten genutzt, um auszudrücken, wie Dinge "sein sollen" oder natürlicherweise "sind", was ihre normative Kraft unterstreicht.
Auf welchen Theoretikern basiert die Analyse?
Die Untersuchung stützt sich auf die Sprechakttheorien von John R. Searle und Daniel Vanderveken.
Welche Figuren im Beowulf werden analysiert?
Die Arbeit untersucht unter anderem die direkten Reden des Küstenwächters und von Beowulf selbst in Bezug auf ihre gnomischen Aussagen.
- Quote paper
- Matthias Doyscher (Author), 2006, Beowulf - Eine sprechakttheoretische Untersuchung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/85911